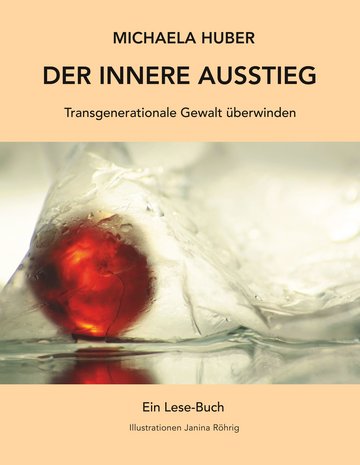Gebt mir Antwort!
Transgenerationale Fragen
Mit brüchiger Stimme hat Hildegard Knef als 74Jährige 1999 eines ihrer letzten Lieder eingesungen, und es klang, als würde sie sowohl ihre Eltern im Nachhinein, als auch sich selbst auffordern:
Gib mir Antwort! (Aus der CD: 17 Millimeter)
In diesem Lied heißt es unter anderem:
„Versuche keinen Trick. Du lügst dir keinen Fluchtweg frei ins Grab…
Die Gesichter deiner Lieben durch die Zeit
Verdunkelt und umwölkt von Traurigkeit.
Gib mir Antwort!
Wer war froh, dass es dich gab?
Was du hinterlässt
War nur ein schales Fest
Du bestehst ihn nicht
Den großen Abschlusstest.
Gib mir Antwort!“
Wer dieses Lied je gehört hat, das Rufen dieser brüchigen Stimme vernommen hat, spürt: Diese Frau ist bitter und auch bitterböse. Sie hadert mit ihrem Schicksal, dass sie keine Antwort bekommen hat, jedenfalls bislang (das „Gib mir Antwort!“ hallt immer wieder nach in diesem Chanson.)
Ja, wir brauchen Antworten. Lebenslang. Von unseren Vorfahren, und von uns selbst. Damit wir lernen aus der Geschichte. Denn am Ende wollen wir uns doch nicht belügen, nicht wahr?
Wir haben fast alle nette Familien-Anekdoten gespeichert. Über unsere Familienmitglieder und über uns selbst. Was aber ist mit den bitteren, den traurigen, den schlimmen, den bösen Geschichten? Wieviel haben wir davon erfahren, was haben wir erspürt vom Leid, das unsere Eltern und Großeltern etc. durchgemacht haben? Was davon haben wir wie selbstverständlich weitergetragen, weitergelebt? Was hat man uns selbst angetan? Was haben wir zwar direkt und indirekt abbekommen, aber versucht, es später in unserem Leben selbst ganz anders zu machen als das, was wir selbst erlitten haben? Und in welchen Bereichen des Lebens und Verstehenwollens bleiben Fragen offen?
In Psychotherapien lernen Menschen, sich ihre Lebensgeschichte anzuschauen und zu begreifen, was geschehen ist. Meist geht es dabei zunächst nur um das individuelle Erleben: Wie war Mama oder Papa zu mir? Weniger häufig gehen die Fragen weiter in die Tiefe: Was haben meine Vorfahren, besonders meine Eltern erlebt, bevor es mich gab? Was haben sie mit sich herumgetragen, ohne es zu verarbeiten? Was haben sie davon direkt oder indirekt an mich weitergegeben? Was ist nun meine Aufgabe, was soll ich davon noch verarbeiten – und was weise ich zurück, weil es nicht zu mir und meinem Leben oder doch zumindest nicht zu dem Leben meiner Kinder gehören sollte?
Was traumatische Erfahrungen angeht, sprechen wir von „transgenerationaler Traumatisierung“, wenn vorherige Generationen ihre eigenen unverarbeiteten Traumata an ihre Kinder weiterreichen.
Lesen Sie hier in diesem Teil des Buches einige Beispiele dafür, subtile und brutale, traurige und bewundernswert tapfere. Beginnend bei dem, was ein „nicht bösartiger, sondern kreativer und eigentlich auch lieber Vater“ doch an Schlimmem verursacht hat. Und eine „ängstliche, aber nicht grausame“ Mutter, die sich „nur“ ständig innerlich auf der Flucht befand. Beides Geschichten von Menschen, die den Krieg in den Knochen hatten – ein Krieg, der sie gebrochen zurückließ. Danach lesen Sie vielleicht die konkrete Schilderung einer Anonyma, wie es war, als Kind einer grausamen Mutter ausgesetzt zu sein. Und dann den Text von Klara Sommer über den harten Weg, sich loslösen zu müssen von einer brutalen, alkoholkranken Mutter – 20 Jahre nach der Flucht vor ihr.
Warum so viele Texte zu Müttern?
Die meisten, die hier in diesem Buch Beiträge geleistet haben, sind – zumindest äußerlich – Frauen. Sie haben erlebt, dass die brutalen aktiven Gewalttäter – vor allem im Bereich sexualisierte Gewalt – Männer waren, und fürchten diese. Wogegen sie aber kaum eine Abwehrmöglichkeit haben, sind Frauen. Und am wenigsten können Sie sich gegen ihre Mütter schützen.
„Wenn du den ultimativen Schmerz in den Augen der gequälten Kinder sehen willst, dann musst du sie nach ihrer Mutter fragen“ hat einmal der amerikanische Kinder-Anwalt und Buchautor Andrew Vachss gesagt (zit. in Huber, 2010), und weiter: Er habe als Kinderanwalt hunderte von kleinen Mädchen gesprochen, die sexualisierte Gewalt erlebt hatten, „und wenn sie den schlimmsten Schmerz beschrieben – dann war das nicht, vergewaltigt worden oder Sodomie ausgesetzt gewesen zu sein. Es war der Augenblick, als sie es ihrer Mutter erzählten und die sagte: ‚Ach geh weg‘. Das war das Schlimmste. Das war der ultimative Schmerz.“ (ebd., S. →). Es gibt keine intensivere frühe Bindung als die zwischen Mutter und Kind. Wir alle haben unsere Mütter „studiert“. Haben ihren Geruch bis heute in der Nase, sind bis in die Texturen unseres Wesens lebenslang verwoben mit ihr. Ob wir das wollen oder nicht. Auch wenn wir uns äußerlich distanzieren, innerlich bleiben wir immer das Kind unserer Mutter, egal wie diese sich uns gegenüber benommen hat. Das ist Biologie.
Wenn ein Kind sich später innerlich und äußerlich von der Mutter distanzieren muss, vielleicht sogar gegen deren Willen, ist das eine ganz besonders schwierige, ja oft qualvolle Angelegenheit. Mütter in traumatischen und traumatisierten Familien sind oft durchaus gutwillig. Manchmal aber verabscheuen sie an ihrem Kind all das, was sie an sich selbst ablehnen: klein und schwach und hilflos (gewesen) zu sein. Dann quälen sie besonders das Kind, das ihnen am ähnlichsten ist, oder zum Beispiel ihr Erstgeborenes oder das Kind, das sie eigentlich nicht (auch noch) wollten.
Doch auch die Mütter, die nicht offen aggressiv ihren Töchtern und Söhnen zusetzen, können diese zutiefst verletzen, indem sie sie nicht schützen, ihnen verleugnend oder deren Leid bagatellisierend begegnen. Manche Mütter können, weil sie sich mit ihren eigenen Traumatisierungen nicht auseinandergesetzt haben, Gefahren für ihre Kinder nicht erkennen. Sie sind vielleicht gewohnt, sich innerlich leer zu machen, wenn Gefahren auf sie zukommen, und können so ihre Kinder nicht schützen. Sie lassen ihre Kinder im Stich, wenn diese sie besonders brauchen. Sie sind vielleicht selbst psychisch angeschlagen und mehr mit sich beschäftigt als mit ihrem Kind. Sie sind möglicherweise abhängig vom (misshandelnden) Mann oder Freund und wenden sich ab, wenn sie bemerken, wie sehr ihr Kind leidet. Oder sie empfinden sogar eine Art sadistischer Befriedigung, wenn es ihrem Kind nicht besser geht, als es ihnen selbst als Kind ergangen ist.
Aber – und das gehört gesellschaftlich zu den größten Tabus, deshalb sage ich es hier noch einmal: Manche Mütter sind so grausam behandelt worden, dass sie selbst ganz bewusst und bis ins Mark eiskalt, grausam und brutal geworden sind. Dann verfolgen sie ihr Kind geradezu mit ihrem Hass, als müssten sie in ihrem Sohn oder – noch häufiger – ihrer Tochter, die ihnen so ähnlich ist, ihr eigenes inneres leidendes Kind mit aller Härte bestrafen für alles, was es nicht hat verhindern können, für alles erlittene Leid.
Viele traumatisierte Menschen sind nicht „eine“ Persönlichkeit. Sondern sie bestehen aus vielen unterschiedlichen Zuständen, Impulsen, Anteilen, Teilidentitäten, zwischen denen sie je nach äußerem oder innerem Anlass wechseln. Eines Teils kann die Mutter oder der Vater liebevoll und zugewandt sein, während andere Zustände bei Gelegenheit – vielleicht unter Stress – in ihr oder ihm hervorkommen, die desorientiert, voller Angst oder rasend vor Wut sein können. Kindern sind solche Mütter oder Väter ein Rätsel, das sie nicht selten lebenslang zu ergründen versuchen. Vielleicht hilft es sich vorzustellen, dass auch Mama oder Papa, die viel durchgemacht haben in ihrem Leben, nicht „eins“ waren. Sondern mal so und mal so. Dass sie sich selbst nicht kannten. Dass sie vielleicht auch alles taten, sich gewiss niemals näher mit sich beschäftigen zu müssen. Etwa indem sie sich in Arbeit stürzten, oder in eine Sucht. Dass sie Antworten schuldig geblieben sind, die von ihren Kindern gesucht und hoffentlich gefunden werden müssten.
Die Brüche und die Kontrollverluste der eigenen Eltern als später groß gewordene Tochter oder Sohn zu erkennen, ist sehr schmerzhaft. Denn die meisten haben ihre Mutter, und viele auch ihren Vater geliebt und lebenslang eine Sehnsucht, doch noch die Geborgenheit zu erleben, von der sie spüren, dass sie sie bräuchten. Ein Kind liebt ganz besonders die Mutter, das ist biologisch so vorgesehen. Es ist schließlich lange abhängig von ihr. Und es braucht Zeit, um sich von einer Mutter lossagen zu können, die den Titel „Mutter“ im sozialen Sinne vielleicht nur eingeschränkt oder gar nicht verdient hat. Während Väter …. Ja was ist eigentlich mit den Vätern los? Verschwinden sie so oft aus dem Blickfeld der Kinder, weil sie selbst keine guten väterlichen Vorbilder hatten? Fragen über Fragen tun sich auf.
In diesem Teil des Buches finden Sie nicht nur die Texte heute jugendlicher oder erwachsener Kinder über Väter und...