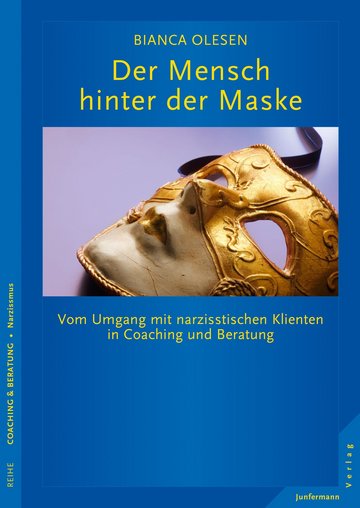1. Was ist Narzissmus?
1.1 Mythos und Wirklichkeit
„Was ich mir vom Leben wünsche? Ich habe mich so lange hinter meiner Maske versteckt. Ich möchte gefunden werden. Wie früher beim Versteckspielen möchte ich gefunden werden. Und dann geliebt werden, so, wie ich bin. Das möchte ich am allermeisten. Und ich habe so wahnsinnige Angst davor, dass ich weglaufen könnte. Aber ganz tief drinnen will ich endlich gefunden werden.“
(Klient im Verlauf des Coachings)
Der Begriff Narzissmus leitet sich ab von der Sagengestalt des jungen Narziss (gr. Narkissos) aus der griechischen Mythenwelt. Er war der schöne und stolze Sohn des Flussgottes Kephissos und der Wassernymphe Leiriope. Es kursieren verschiedene Versionen der Sage. In der wohl bekanntesten Fassung – von Ovid – gerät Narziss in eine Art Wahn: Er verliebt sich in sein Spiegelbild, das er im Wasser erkennt, und versucht verzweifelt, es zu greifen und festzuhalten. Am Ende stirbt der schöne Jüngling, da er sich nicht mehr von seinem eigenen Anblick im Wasser abwenden kann.
Ungeachtet der Abweichungen in den jeweiligen Versionen stimmen alle darin überein, dass sie das Leiden und Sterben von Narziss mit dem Ins-Wasser-Schauen in Zusammenhang bringen.
Abbildung 1.1: Narziss aus der griechischen Mythologie
(Gemälde von Caravaggio, 1598/99, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rom)1
Im Mythos von Narziss finden sich bereits zentrale Aspekte, die für das Erscheinungsbild und die Entstehung des Narzissmus eine wichtige Rolle spielen. Ich möchte sie hier als Einstieg in das Thema genauer beleuchten, da sie für ein grundlegendes Verständnis hilfreich sind.
I. Die Rolle des kindlichen Umfelds
Mutter und Vater spielen nur zu Beginn der Sage eine Rolle. Sie wirken anscheinend ausschließlich an seiner Entstehung mit. In anderer Weise sind Kephissos und Leiriope als Eltern nicht präsent. Weder Mutter noch Vater sind als Spiegel seines Selbst emotional anwesend. Daher fehlt Narziss jede Möglichkeit, sein wahres Selbst zu erkennen: sein Wesen und seine Fähigkeiten, aber auch seine Grenzen und zudem die Tatsache, dass seine Freiheit die Grenzen anderer berührt.
Mit „Selbst“ bezeichne ich hier die Gesamtheit aller Kognitionen, die ein Mensch über sich bildet als Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ (in Abgrenzung zu der Frage: „Was tue und was besitze ich?“). Dieses Selbst bildet der Mensch im Kontakt zu sich selbst, das heißt in Beobachtung körperlicher, seelischer und geistiger, also innerer Prozesse, unabhängig davon, ob er dabei im Kontakt zu anderen Menschen, Tieren, der Natur, Dingen oder seiner Spiritualität ist oder allein. Das Selbst(bild) in diesem Sinne sehe ich dabei in Anlehnung an die Gestalttherapie prozesshaft: Es unterliegt im Verlauf des Lebens einem ständigen Wandlungsprozess mit dem Ziel des Ich-selbst-Werdens, wenngleich zentrale Bedürfnisse und emotionale Prozesse über die Zeit hinweg konstant bleiben. Und in Anlehnung an den Sozialpsychologen Elliot Aronson (Aronson, Wilson & Akert, 2008) meine ich, dass eine aufgrund umgeleiteter Aufmerksamkeit oder mangelnder Selbstwahrnehmungsfähigkeit fehlende Selbstaufmerksamkeit („Awareness“ in der Gestalttherapie) ein konstantes Selbst(bild) verhindert. Insofern ist die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung zentral für die Ausbildung eines konstanten, „wahren“ Selbst: „Das bin ich!“ (in Abgrenzung zu: „So soll ich mich verhalten, um dazuzugehören“). Und wie im Folgenden erläutert, bedarf ein Kind für die Entwicklung der Selbstwahrnehmungsfähigkeit in den ersten Lebensjahren unbedingt der emotionalen Präsenz der Eltern als Spiegel seines So-Seins.
Ein Kind ist bis zu einem bestimmten Alter noch nicht zur Selbstreflexion fähig. Selbstreflexion meine ich dabei als Selbstwahrnehmung, deren Bewertung und das Ableiten von Konsequenzen. Ein Kind kann nicht wie ein Erwachsener eine Metaebene einnehmen, sich beobachten, sein Handeln bewerten und planvoll korrigieren. Es lebt ganz im Moment und handelt mehr oder weniger impulshaft. Es bedarf der liebevollen Spiegelung durch seine Bezugspersonen, um sein Wesen zu erkennen und dabei die Grenzen seiner Freiheit im Kontext anderer zu verstehen. Das meint etwa die verständnisvolle, beschreibende Rückmeldung zum Erleben des Kindes. Die Erwachsenen imitieren zum Beispiel Verhalten und Gesichtsausdrücke eines Babys, etwa sein Gähnen, und unterstreichen das Verhalten mit den Worten „So müde bist du“. Weint ein Kind, trösten die Eltern: „Dein Teddy ist weg, und jetzt bist du traurig. Komm mal her in meinen Arm.“
Dabei geht es nicht um den Anspruch, als Eltern perfekt sein zu müssen. Kinder erkennen, respektieren und überstehen „imperfekte“ Eltern und brauchen sie sogar, um sich selber das „Imperfektsein“ gestatten zu können. Es geht hier vielmehr um eine grundsätzliche Haltung der liebevollen Annahme des Kindes als autonomes Wesen mit eigenen Impulsen und eigenem Willen. Liebevolle Spiegelung ermöglicht dem Kind, sein Denken, Handeln und Fühlen nach dem Erleben in seine Erfahrungen einzuordnen und Worte dafür zu finden, mit denen es sich später artikulieren kann. Indem es die Reaktionen seiner Bezugspersonen, ihre Sichtweisen, Aussagen und Haltungen zu sich verinnerlicht, entwickelt es seine Selbstrepräsentanz, sein inneres Bild von sich. Sein Selbstbild setzt sich also zusammen aus dem Abgleich des eigenen Erlebens im Moment mit den Rückmeldungen der anderen: aus ihren Reaktionen, ihren Blicken, ihren Gefühlen zu ihm, ihren Worten an es und ihren Umgang mit ihm.
Für ein Kind ist es überlebenswichtig, sich dem Umfeld anzupassen. Seine Versorgung und sein Schutz hängen davon ab. Die Bindung zu Bezugspersonen abzubrechen ist daher nicht vorgesehen. Vielmehr hat ein Kind die Fähigkeit, Autonomieimpulse zugunsten einer sicheren Bindung zurückzustellen. Erfährt ein Kind keine liebevolle Spiegelung und keinen Respekt für sein individuelles Wesen, kann es sein Selbst nicht erkennen und entwickelt sich zu jemandem, der in der Gunst der Bezugspersonen stehen will. Dazu muss es jede Selbstempathie, die Verbindung nach innen, unterbinden. Es opfert unbewusst und unreflektiert seine Individuation zugunsten seines Überlebens. Es bewältigt damit eine überfordernde Aufgabe und bildet eine Maske aus, eine passende Ersatzpersönlichkeit anstelle der lebendigen, angelegten Persönlichkeit, und beginnt zu leisten, statt zu fühlen. Die Grundannahme hierbei ist, dass Emotionen, die die organismischen Reaktionen regulieren sollen, im Kontext des Bezugsumfeldes nicht zum Ausdruck gebracht werden können. Als Kompensation muss deshalb eine „Maske“ ausgebildet werden, mit der die eigenen Gefühle unterdrückt und stattdessen die angepassten Reaktionen gezeigt werden können.
Wie kann ein Kind es aber aushalten, wenn seine Eltern seine Fähigkeiten, Eigenschaften, Besonderheiten, seinen Eigen-Sinn und seine Eigenarten – kurz: seine Individualität – nicht anerkennen, wenn auch nicht aus böser Absicht? Es übernimmt das Bild der Bezugspersonen von sich, dann kann es wieder mit ihnen übereinstimmen. Jedes Verhalten, Denken und Fühlen der Bezugspersonen erscheint ihm „richtig“ und normal, die darin enthaltenen verbalen und nonverbalen Botschaften als wahr. So lernt es, den Schmerz über das Erleben solcher Ablehnung zu unterdrücken: indem es sich selber ablehnt. Es fügt sich in sein Umfeld ein: Eben darin besteht die Fähigkeit zur Anpassung.
II. Fehlende Empathie und starker Selbstbezug
Als Jüngling weist Narziss andere hochmütig zurück. Er ist so stolz, dass ihn deren Zuneigung ebenso wenig berührt wie ihr Schmerz über seine Ablehnung. Heute würden wir ihn wohl als eingebildet und arrogant bezeichnen und feststellen, dass Narziss zu Empathie nicht fähig ist.
In der Rückmeldung der Eltern an das Kind ist eine weitere Lernerfahrung enthalten: der Vorgang der Reflexion, der zu einer Selbsteinschätzung im Kontext des Umfelds führt. Entscheidend ist, welcher Maßstab bei der Reflexion angesetzt wird: Werden als umgrenztes Umfeld die Bezugspersonen zum Maßstab, muss sich ein Kind zu ihrem Gefallen verhalten („Wenn du nicht XY tust, dann ist die Mama traurig“). Wird das gesamte Umfeld, die Gesellschaft zum Maßstab, muss sich ein Kind zum Gefallen diffuser Unbekannter verhalten („Man macht das nicht“). Im besten Falle wird ein Kind sein eigener Maßstab („Bist du zufrieden mit dir?“) im Kontext der anderen („Und wie geht es den anderen damit?“): Die Entdeckung und das Ausprobieren des Selbst in der Gemeinschaft reduziert, wenn es gelingt, die kindlich-natürliche Grandiosität auf eine gesunde, realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten in Abgrenzung zu anderen. Das Erleben von Großartigkeit und Allmacht wird frustriert und enttäuscht, wenn das Kind Grenzen und Misserfolge erlebt. Diese Zeit der Frustration ist eine wichtige Erfahrung, um Enttäuschung und Niederlage verkraften zu lernen, um Frustrationstoleranz zu entwickeln und freiwillig zurücktreten zu können, statt sich immer durchsetzen zu müssen. Um in dieser Phase aber nicht von der Grandiosität in die Minderwertigkeit zu fallen, bedarf es weiterhin der liebevollen Unterstützung der Eltern und des Verständnisses für den Frust, Ärger, die Enttäuschung und Ohnmachtsgefühle des Kindes. Kinder brauchen viele Jahre der Spiegelung von außen, bis sie ein Wertesystem und damit die Fähigkeit zur Bewertung und schließlich die Fähigkeit zur Selbstreflexion entwickelt haben (vgl. hierzu z. B....