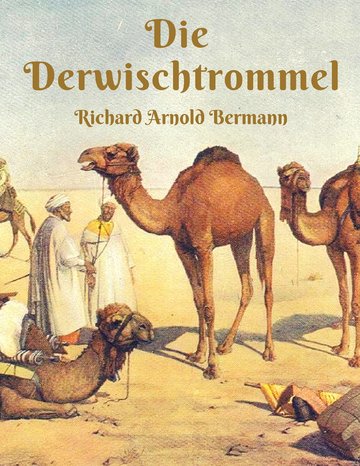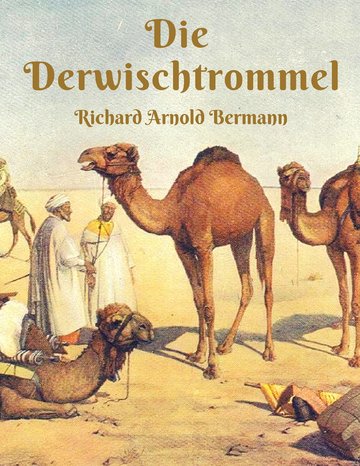Aus den Notizen des Reisenden
Khartum, den 10. Januar 1929.
Die Veranda des Grand Hotels ist jetzt, so bald nach dem Lunch, noch menschenleer. Zu heiß noch im Freien. Hierher entwische ich dem Touristengeschwätz in der Halle. Der Wüstenexpreß Wadi Halfa-Khartum ist vor einigen Stunden angekommen, der zweimal wöchentlich während der »Season« aus den großen Hotels von Luksor und Assuan Touristen-Menschheit her nach Khartum bringt; wieder in ein Hotel zu Whiskysoda und Jazz am Abend.
Die Veranda längs der Hotelfront ist um eine Stufe über den Garten erhöht und nach vorne offen. Unten, auf einem bekiesten Streifen, hocken schon jetzt die Händler, die später, zur Teezeit, auf dem Rand des Verandabodens ihre Waren auslegen dürfen.
Da ich mir einen Liegesessel zurechtschiebe und, den Fliegenwedel in der einen Hand, in einem Buch zu lesen beginne – einem Buch aus der Geschichte des Sudans –, nähern sich mir einige dieser Händler, gemischte Orientalen, lassen aber, auf einen ungeduldigen Wink, gleich wieder von mir ab. Entweder ist es noch zu heiß zum Zudringlichwerden, oder, und das ist eher der Fall, gehöre ich nach ungeschriebenem Recht dem einen Händler, der schon vorher gegenüber der Stelle gehockt hat, an der ich Platz nahm. Dieser eine läßt sich nicht winken, sondern packt unbeirrbar seine Waren aus einem Wachstuch und breitet sie vor mir aus, allerlei Andenken und Kuriositäten, die ich erwerben soll. Da ich den Kerl, einen grünlich dunkelbraunen, noch jüngeren Menschen, nicht loswerden kann – ich schätze, er ist ein Hindu oder ein Parse – und er mich nicht lesen läßt, beschließe ich, ihn zu ärgern, und verstehe keine der vielen Sprachen, in denen er gleich auf mich einspricht. Erstaunlich, wie viele europäische Sprachen er irgendwie kennt!
Er will mir, auf englisch, Zigarettendosen aus Messing verkaufen, billigen Schund aus den Basaren von Agra und Delhi; Musselinschals, wie sie aus England nach Benares gebracht und dort den Touristen angedreht werden. Da ich, scheint es, nicht Englisch verstehe, versucht es mein Kerl mit Spanisch, er muß auf Trinidad oder in Panama gewesen sein, wo so viele Inder leben. Ich verstehe auch nicht Spanisch, für ihn nicht, und kaufe die ceylonesischen Elefanten nicht, aus tiefschwarzem Holz. Ich verstehe keinen Ton von dem Portugiesisch von Goa und zeige kein Interesse für Elfenbeinschnitzereien (obwohl ein Püppchen, einen Krieger der Schilluk darstellend, mit einem Speer in der Hand, mir gefällt, im Grunde). – Auf kapholländisch weiß ich nicht zu begreifen, daß ich Lederarbeiten kaufen soll, prachtvolle grellrote Kissen aus kunstvoll gefärbter Gazellenhaut, mit vielen Farben benäht, wie sie drüben in Omdurman gearbeitet werden.
Endlich, da ich keine einzige Sprache verstehe, winkt mir der Parse geheimnisvoll, holt ein Bündel. Das spricht für sich selbst! In dem Bündel sind Waffen, Speere, barbarische Keulen und Schilde, Dolche, die statt in Scheiden in toten kleinen Krokodilen stecken, so daß der Griff aus dem Rachen herausragt. Und vor allem Schwerter von unverkennbarer Form. Die ledernen Scheiden enden in seltsamen Rhomboiden, der Kreuzgriff ist mit Silber beschlagen – die Klingen, wenn man sie sieht, gerade und breit, nicht sarazenische Säbel, sondern Kreuzfahrerschwerter.
Auch diese Waffen mögen gefälscht sein. Das heißt : sie sind es. Schon in dem geheimnisvoll-schönen Basar von Assuan bietet man sie den Touristen an, als Derwischwaffen, Trophäen von den alten Schlachtfeldern im Sudan – –.
Der indische Händler steht vor mir auf dem Rasen des Gartens, mit einem großen, entblößten Schwert in seiner Hand; die Goldstickerei seines Käppchens blitzt in der Sonne, und er ruft mir Worte zu, die ich, in welcher seltsamen Sahibsprache immer ich denken möge, die ich, hier im Sudan, verstehen muß.
»Derwisch, Sahib! El Mahdi, Sahib!«
»The sword, la espada, Sahib, Mijnheer, of the Mahdi!«
Khartum, den 11. Januar 1929.
Ich mache einen Ausflug auf die Hochebene von Kerreri, den Schauplatz der Schlacht vom 2. September 1898, in der Kitchener die Mahdisten vernichtet hat.
Auf dem Schlachtfeld steht der Marmorobelisk zu Ehren der Gefallenen vom 21. Lancer-Regiment, das hier seine herrische und vielleicht etwas unweise Attacke geritten hat. (Ein sehr tapferer junger Leutnant, der mitritt, hieß Winston Churchill.) – Oberhalb des Denkmals gewinne ich die Höhe eines kleinen Wüstenberges, des Dschebel Surgham. Von hier hat am Tag vor der Schlacht der Sirdar, Herbert Kitchener, das Gelände geschaut und das Heer des Khalifa heranmarschieren sehen, mit tausend Bannern. Dahinter sah er den Umriß einer fernen, leuchtenden Kuppel. Das war das Grab des Mahdi in Omdurman.
Ich sitze auf einem Felsblock, habe Bücher und Karten vor mir und suche die letzte große romantische Schlacht des neunzehnten Jahrhunderts recht zu verstehen, vielleicht den letzten epischen Ansturm des Islams gegen die westliche Zivilisation.
Vor mir der ruhig strömende Nil. Der Höhenzug, auf dessen Kamm ich jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitchener lagerte. Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem »Seriba«-Wall aus dornigem Mimosenreisig und sonst von Schützengräben umgeben. Im Lager sind zweiundzwanzigtausend Mann, Ägypter und Engländer. Das ist nicht eine von den phantastisch improvisierten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergeblich die Derwische niederzuwerfen versucht hat, seit siebzehn Jahren. 1885 ist Khartum dem Mahdi erlegen und General Gordon hat sterben müssen, weil die Ersatzarmee auf pittoreske Weise hoch zu Kamel durch die Wüste kommen wollte. Diesmal hat Kitchener sich die Bahn gebaut, eine erstaunliche Eisenbahn quer durch den nackten, glühenden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neueste Artillerie. Maschinengewehre in Mengen. Die englischen Truppen aus den bewährtesten Regimentern, vortrefflich verpflegt und gerüstet, mit neuen Lee-Enfield-Gewehren. Wichtiger: die ägyptischen Truppen, die auch diesmal die Masse des Heeres bilden, sind nicht mehr das, was sie waren; jetzt werden sie nicht wieder kompanieweise rennen, wenn der Speer eines Derwisches sichtbar wird. Sie zeigen sich, nicht nur die Negersoldaten, sondern auch die gelben Fellachen, vollkommen diszipliniert wie europäische Truppen.
Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitcheners, das Fin de siècle: Europa mit seinen tödlichen Waffen, Europa schon vorbereitet auf seinen gräßlichen Bruderkrieg, die Technik des neuen Zeitalters fast schon fertig, das vollendete neunzehnte Jahrhundert, großartig, prunkvoll und mordbereit. –
Dann ertönen arabische Trommeln, und Mohammeds siebentes Jahrhundert marschiert heran, fast unverändert – – –
Das letzte wirkliche Heer des Islams, denn später hat höchstens der moderne Nationalismus mohammedanischer Völker Armeen ins Feld geschickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle der großen Flut, die der Prophet von Mekka dreizehn Jahrhunderte vorher aufgewühlt hatte.
Vierzigtausend dunkelhäutige, heiße Menschen, die meisten von arabischem Blut – noch genau so gläubig, fanatisch, allahtrunken wie zur Zeit des Propheten, ganz unberührt vom Wandel der Zeiten. Menschen mit Schild und Lanze, mit Zweihänderschwertern, manchmal in dem altsarazenischen Kettenpanzer. Sie haben moderne Gewehre erbeutet und gebrauchen sie kaum, das ist etwas Fremdes, dem man kein rechtes Vertrauen schenkt. Drüben in Omdurman ist das Arsenal des Khalifa voll von guten Beutegeschützen, von Krupp-Kanonen, von Mitrailleusen. Aber abgesehen von einigen wenigen, elend gezielten Schüssen greift die Derwisch-Artillerie nicht in den Kampf ein. Diese Leute wollen mit Kreuzfahrerschwertern das Fin de siècle in Stücke hacken!
Was für ein Anblick (träume ich, auf meinem Felsblock vor der leeren Landschaft, auf der die Sonne brütet) – welch ein epischer Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! Das arabische Heer kommt über die Höhen, langsam. Im Zentrum die Baggara, Stammesgenossen des Khalifa Abdullahi, der diese wilden Haufen selber führt. Sein riesiges schwarzes Banner, das einzige schwarze, ist hoch in der Luft, die frommen Texte, mit denen es ganz benäht ist, verkünden den Sieg, unfehlbaren, sicheren Sieg für die Gläubigen – –.
Und Fahnen, Fahnen, zu Hunderten. Jeder Emir führt seine Fahne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie eine Blumenwiese erscheint das Feld, wie eine Blumenwiese, in der ein fruchtbarer Wind wühlt – –.
Sie kommen näher. In diesen Herzen ist gar kein Zweifel. Daß hier bei Kerreri die große Entscheidung gegen die Engländer fallen soll, weiß der ganze Sudan schon seit dreizehn Jahren: der Mahdi hat es vor seinem Tode prophezeit, und seither hat man auf eben diesem Gelände alljährlich die große Heerschau gehalten und den Sieg, den gewissen, schon vorher gefeiert – –
Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-Enfield-Gewehre, Kanonenboote, Schnellfeuerbatterien. –
– Niemals nachher, nicht während all der blutigen Greuel des Weltkrieges, hat man Ähnliches mehr gesehen. Durch ein Feuer, das Festungsmauern erschüttert hätte, kommen sie näher und näher – –
Gemetzel sondergleichen, Heldentum ohne Zweck. Bei alledem kommt dieser ???episclie Heersturm dem Gegner nicht nah genug, um die blanke Waffe zu brauchen; die...