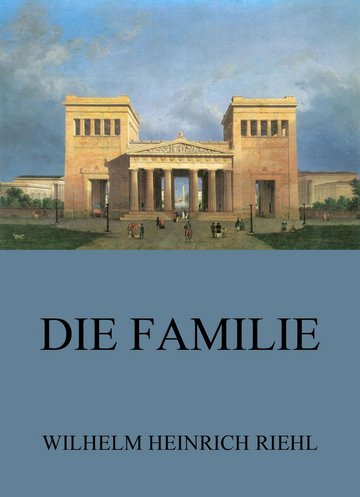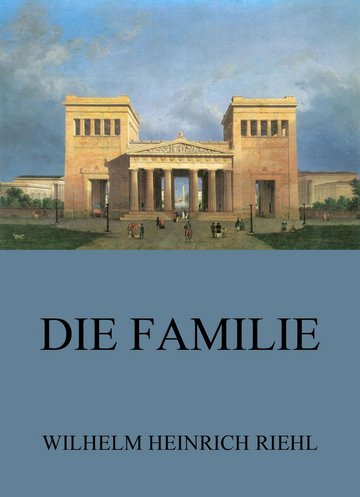»Je länger Junggesell, je tiefer in der Höll',« – sagt das Volk. Wenn es aber schon nicht gut ist, daß der Mann allein sey, dann taugt das noch viel weniger für die Frau. Erst in der Familie finden wir den ganzen Menschen. Damit ist beileibe nicht gesagt, daß jeder sich verheirathen solle; aber einer Familie angehören, in einem Hause, zum mindesten in einer familienartigen Genossenschaft leben, sollte ein Jeder.
Es gehört zu den höchsten und schwierigsten politischen Aufgaben der Gegenwart, diesen Zustand, von dem wir sehr weit entfernt sind, möglichst wieder herzustellen.
Wenn mich der praktische Staatsmann fragte, was denn alle die in den vorhergehenden Kapiteln angestellten Untersuchungen über den Gegensatz und die Entwickelung männlicher und weiblicher Natur zum Aufbau einer »deutschen Social-Politik« nützen sollen? dann würde ich ihm erwidern: Sie sollen vor allen Dingen zu der Erkenntniß führen, daß wir in unserer Gesetzgebung und Verwaltung noch kaum einen Anfang gemacht haben, auf diesen Urgegensatz alles menschlichen Lebens und seine ungeheuern Folgen Rücksicht zu nehmen. Wie wollen wir da von einem organischen Staatswesen reden? Nur wer die Ursachen und Folgen der verschiedenen Abstufungen des Geschlechtsgegensatzes erfaßt hat, wird die politische Bedeutung der Familie ermessen.
Schon hier wird der Staatsmann eingestehen müssen, daß in allen deutschen und europäischen Staaten noch wenig oder nichts geschieht, um die Stellung von Mann und Weib in ihrem fortlaufenden Entwicklungsproceß statistisch zu erforschen und den Männern der Gesetzgebung und Verwaltung als ein hochwichtiges Material geordnet vorzulegen.
Unsere Zahlenstatistiker rechnen pflichtlich aus, wie viele Männer und Frauen, wie viele Familien im Lande leben, wie viele Durchschnittsköpfe die Familie zählt, wie viele Ehen alljährlich geschlossen werden, wie viele vereinzelte Existenzen neben den Familien hergehen, wie viele Familien in einem Hause wohnen, und wie die Menschen fruchtbar sind und sich mehren. Das ist eine recht nützliche Wissenschaft; aber soll dies unser ganzes statistisches Wissen von den Geschlechtern und der Familie bleiben? Dem Staatsmann soll ja doch nicht bloß ein Blick in das Kirchenbuch, es soll ihm auch ein Blick in's Haus eröffnet werden. Er soll auch wissen, wie das Verhältniß von Mann und Weib sich stellt in den verschiedenen Volksschichten, wie es sich entwickelt, stehen bleibt, zurück geht. Hat denn die Familie des Kleinbauern, wo Mann und Weib noch in gleicher Bildung gefesselt sind und hinter demselben Pfluge gehen, den gleichen politischen Sinn, wie die höhere bürgerliche Familie mit ihren voll und übervoll entfalteten Geschlechtsgegensätzen? Sollen beide in der Gesetzgebung über Einen Kamm geschoren werden? Die Erkenntnis; von diesen Dingen, nicht bloß in allgemeinen Umrissen, wie ich sie hier gezeichnet, sondern die genaue statistische Erkenntniß, die eindringt in das Detail nach den einzelnen Provinzen, Städten, Dörfern, eine Statistik, die das fortlaufende Werden der Gestalten dieser Zustände aufzeichnet und vergleichend zusammenstellt, ist mindestens ebenso wichtig für die Staatsverwaltung als die Zahlenstatistik der Bevölkerung. Es handelt sich hier nicht um zufällige Aperçus, nicht um persönliche Ansichten und Erörterungen, sondern um ein Erkennen und Festhalten ganz bestimmter Thatsachen, die sich in der Sitte und Lebenspraxis des Volkes fest und klar aussprechen.
Gar häufig findet man aber, daß selbst Localbeamte, die doch nur an und mit dem Volk fortwährend ihre Amtsthätigkeit zu üben haben, von den socialen und Familienzuständen ihres Bezirks wenig oder nichts wissen. Es haben mir bei meinen Entdeckungsfahrten in's Innere von Deutschland Beamte mitunter ganz naiv dieses Geständniß selber abgelegt, ohne etwas Arges dabei zu ahnen. Sie leben unter dem Volk und sehen und hören täglich, was es treibt; weil sie aber weder die Bedeutung der täglich wahrgenommenen Einzelzüge seines Lebens ahnen, noch dieselben durch Vergleichung mit den Zuständen anderer Landstriche in ihrer Eigenthümlichkeit zu erfassen wissen, so vegetiren sie eben so bewußtlos in diesem Volksleben fort, wie der ächteste Bauersmann. Forscht man bei solchen Leuten etwa auch nur, wie der gemeine Mann ihres Bezirkes seinen Tisch bestellt, so ist die regelmäßige Antwort, dast das Volk hier dasselbe esse, was man wohl auch anderwärts essen werde. Höchstens hört man, daß die Kost »gut« oder »schlecht« sey. Nun muß der Wißbegierige an ein förmliches, wohlberechnetes Inquiriren gehen, und von dem Frühstücke bis zum Abendbrod, von der täglichen Kost bis zu allen festlichen Speisen im Jahreskalender durchkatechisiren, und so wird er zuletzt ganze Seiten von Notizen über eigenthümliche Verhältnisse aufzeichnen können, wo man ihm anfangs gar nichts besonderes zu sagen wußte. Der Beamte hatte also wohl die Kenntniß von diesen einfachsten Thatsachen des Volkslebens, aber er wußte nicht, daß darin etwas Unterscheidendes lieget er hatte kein Bewuhßtseyn seiner Kenntniß – d. h. eben kein »Wissen,« obgleich er alles »wußte« und schließlich auch mittheilte. Wenn aber nun ein solcher Beamter sich nicht einmal der unterscheidenden Küche seines Bezirkes bewußt geworden ist, wie viel weniger wird er die so viel subtileren, aber auch so viel gewichtigeren, Unterschiede im Wesen und Leben der Familie erfaßt haben?
Kein wissenschaftliches Material über die Stellung von Mann und Weib ist in wahrhaft ungemessener Fülle aufgehäuft. In der Rechtsgeschichte und im Privatrecht wurde wohl kaum ein Kapitel gründlicher und vielseitiger durchgearbeitet als jenes, welches von den besonderen Rechtsverhältnissen des Mannes und Weibes handelt. Die allgemeine Culturgeschichte strotzt von Aufzeichnungen über Frauensitte und Frauenbildung. Die vergleichenden ethnographischen Studien über die Beziehungen der beiden Geschlechter bei den verschiedenen Völkern sind vollends bereits so sehr Gemeingut der Bildung geworden, daß es schwer ist, hier noch wichtige Thatsachen zusammenzustellen ohne trivial zu werden. Aber für die Ausnutzung aller dieser Weisheit zur Erkenntniß des socialen und politischen Geistes im Volk und vollends zu einer der Staatsverwaltung zu gut kommenden Erforschung des Lebens der Geschlechter und der Familien in einem Lande ist überall noch gar wenig geschehen.
Ich will nur auf eine einzige – freilich die gewichtigste – Thatsache in der Stellung von Mann und Weib hinweisen, um deren unabsehbare politische Consequenzen anzudeuten, die keineswegs bereits ihre ganze Berücksichtigung im Staate gefunden haben.
Als Resultat unserer Betrachtung erschien uns nämlich die Geltung der Frauen im öffentlichen Leben als eine bloß indirekte, in der Familie vermittelte. Wir wollen einmal diese Thatsache nach ihrer ganzen Ausdehnung und ihrem praktischen Werth zergliedern.
Alle Nationen, selbst die rohesten, haben wenigstens eine Ahnung davon, daß die häusliche Tugend zugleich die öffentliche Tugend des Weibes sey. Geschlechtliche Unsittlichkeit entwürdigt darum das Weib noch unendlich tiefer als den Mann; sie ist Hochverrath an der Familie. Folgerecht bestrafen selbst Nomaden und Wilde den Ehebruch der Frau schärfer als den vom Manne verübten; er ist eines der wenigen Staatsverbrechen, welche die Frau begehen kann. Selbst in unsern modernen Ehescheidungsgesetzen klingt diese Anschauung noch mitunter durch. Die alten Skandinavier gestatteten dem Manne Kebsweiber zu halten: die Frau aber verpflichteten sie bei Todesstrafe zur unverbrüchlichen ausschließlichen Treue gegen ihren Eheherrn.
Wir sind jetzt hoffentlich auf dem Punkte der Gesittung angelangt, wo derartige Unterscheidungen vom Gesetzgeber nicht mehr gemacht werden dürfen. Dagegen besteht eine andere Thatsache, die ans dem gleichen Urgrund quillt. Die Frauen sind gegenwärtig im Allngemeinen ohne Zweifel sittlicher als die Männer. Sie haben den Libertinismus des achtzehnten Jahrhunderts weit gründlicher überwunden. Die meisten Männer schämen sich jetzt wohl, öffentlich solcher Unsittlichkeiten geziehen zu werden, mit denen ein galanter Herr vor hundert Jahren noch laut prahlte; die meisten Frauen sind dagegen wieder zu dem sittlichen Instinkt zurückgekehrt, sich solcher Unsittlichkeiten überhaupt, auch bloß vor sich selber, zu schämen. Das hat ihr ganz der Familie hingegebenes Leben gewirkt. Im Hause haben sie einen naiven religiösen Glauben, eine naive Sittlichkeit wiedergewonnen, daß wir Männer sie hier auf Umwegen erst noch einholen müssen. Positiv ist hiermit also dasselbe bewiesen, was durch jene schärfere Bestrafung des Ehebruchs der Frau negativ bewiesen war.
Die Wahrheit, daß die Frauen durch das Haus besser sind wie wir, aber auch durch das Haus in ihrer Wirksamkeit beschränkt, hat das germanische Alterthum schon so tief erfaßt in der Anschauung, nach welcher ihm die Frauen vorzugsweise religiös geweiht erscheinen, vorahnend, Wunder wirkend mit göttlichen Zauberkräften, während den Frauen selbst der ältesten deutschen Götter- und Heldensage kaum irgend eine männliche Heldenarbeit zugetheilt wird. Eine so reine und tiefsinnige Erfassung des Weibes finden wir wohl in der Urzeit keines andern Volkes wieder.
Die Orientalin geht verschleiert außerhalb des Hauses: sie existirt überhaupt nur im Hause. Ihre freie Persönlichkeit geht unter in der Familie; ihr Haus ist nicht ihre Burg,...