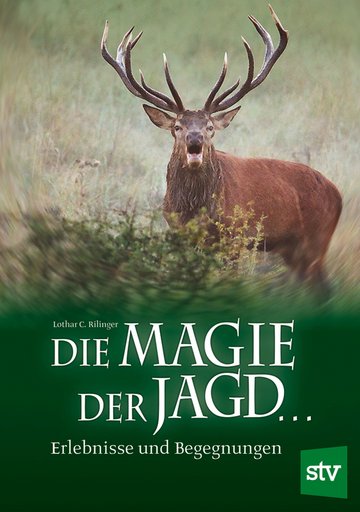Der „Adlerhorst“ auf der Lachkendlalm
Kennengelernt haben wir uns, der Jäger Sepp und ich, vor langer Zeit. Der Jagdherr, Baron H., hatte zum Tee eingeladen. Wir saßen auf der Terrasse seines Jagdhauses im Hüttwinkltal, die Sonne war schon längst hinter dem Ritterkopf verschwunden, und ein seidig-blauer Himmel überwölbte das Tal. Es war August, die Blattzeit war gerade vorüber, und noch schrien die Hirsche nicht. In der Abenddämmerung sprachen wir über die Jagd in dem uns umgebenden großen Revier, sprachen über die lange Tradition dieses Jagdvereins, der in der Zwischenkriegszeit gegründet worden ist, über längst verstorbene Mitglieder, die wir aus den in den Familien tradierten Histörchen kannten, und erörterten auch die vielen Möglichkeiten, die der Jäger in diesem Dorado vorfindet.
Gebannt hörte ich den Schilderungen dieses erfahrenen und bekannten Waidmannes zu, hatte er mich doch gerade eingeladen, auch in diesem Revier, in diesem Paradies des Wildes zu pirschen. III-er Hirsche wären immer frei, Kahlwild ohnedies und vom Gamswild ganz zu schweigen. Und wie wir Pläne für die kommende Saison schmiedeten, fuhr der Jäger Sepp mit dem Auto vor, um den Jagherrn zur Pirsch abzuholen. Gleich wurde mir der Jäger vorgestellt: „Sie werden noch so manchen Pirschgang mit ihm zusammen machen!“
Doch bis es so weit war, dauerte es noch einige Jahre. Das Revier war zwischen den Jagdherren in einzelne Bereiche aufgeteilt und die jeweiligen Jäger auch. Zuerst pirschten wir im mittleren Revier, hierfür war Sepp nicht zuständig, in diesem Teil führte der gute und treue Lenz. Doch nach seinem viel zu frühen Tod war seine Stelle verwaist, und deshalb zog ich dann mit Sepp los. Und mit diesem Jäger ging es in Revierteile, die ich noch nicht kannte, und wir suchten Ecken auf, die ich noch nicht einmal auf den herbstlichen Wanderungen gesehen hatte.
Sepps Elternhaus sehen wir immer, wenn wir hin zum Schareck schauen. Hinter einem Buckel versteckt liegt es, behäbig, ursprünglich, das alte Hüttwinkltal darstellend. Inzwischen gehört der Betrieb Sepps Bruder, der auch die Landwirtschaft weiter betreibt. Der alte Stall liegt auf einem Sporn und ist weithin sichtbar. Oft, wenn wir frühmorgens zur Pirsch fahren, ist dort schon Licht, ganz früh fängt der Hinterbichlbauer mit dem Tagwerk an, in der dunklen Jahreszeit sogar schon lange vor Sonnenaufgang, aber dafür kehrt dann auch früh am Abend Ruhe auf dem Hof ein.
An den Festtagen gehen die Frauen dieses Hofes in ihren üppigen, oftmals seit Generationen vererbten Festtagstrachten den langen Weg an unserem Heim hoch zur Kirche; und da auch die Frauen von den anderen weit auseinanderliegenden Höfen mit ihren Trachten und Bändern geschmückt zur Kirche gehen, sieht dieser Zug wie ein Pilgerzug aus und wie die Demonstration einer Frömmigkeit, die in den Städten schon längst vergessen worden ist.
Und was für ein Bild ist es immer wieder, wenn diese Frauen, eingezwängt in ihre starren Mieder, kerzengerade in den Kirchbänken sitzen, ein Seidentuch um die Schultern gewunden und im Haar einen flachen, schwarzen Hut mit der geraden Krempe, ja, was für ein Bild ist es immer wieder, diese Frauen anzuschauen, die das seit Generationen tradierte freie Bauerntum repräsentieren, selbstbewusst, auch ein wenig stolz, aber nicht hochfahrend, in ihrer Gläubigkeit eher zurückhaltend und demütig. Sie, die Frauen, die Tracht tragen, diese tradierte Tracht der Rauris, sie sitzen in den ersten Reihen unserer kleinen Barockkirche, immer geschieden von den Männern, denen die rechte Seite der Kirchenbänke vorbehalten ist. Und hinter diesen Frauen dann andere Frauen, auch sie in Tracht, aber nicht mehr in der tradierten Festtagstracht, die ja nicht jede Frau tragen darf, die nur den Frauen der Hofbesitzer vorbehalten ist. Jene Frauen schmücken sich mit Dirndln und Jankern im tradierten Pinzgauerstil oder auch in dem aus anderen Gegenden, und erst hinter diesen Frauen nehmen dann diejenigen weiblichen Wesen Platz, die mehr der Moderne und mehr dem städtischen Leben verpflichtet sind. Auf der anderen Seite sitzen die Männer – Bauern, Handwerker, alles gestandene, kräftige Mannsbilder, auch sie sind im Janker erschienen, alle mit Hut, den sie abnahmen, nachdem sie die Kirche betreten hatten. So mancher kam etwas später, aber gerade noch rechtzeitig zur Wandlung, damit die Messe zähle, wie wir vor vielen Jahren sagten, als wir als Ministranten die zu spät eintreffenden Gläubigen musterten. Zuvor hatten sie auf dem Kirchplatz noch ein wenig geplaudert, schließlich ist dies oft die einzige Freizeit, die sie sich nehmen können. Kurz nach der Messe hört man im Tal schon wieder das Tuckern der Schlepper und der landwirtschaftlichen Maschinen, und dann ist es vorbei mit der sonntäglichen Ruhe.
Aus diesem Haus also stammt Sepp, vom Hinterbichlhof, und die Herkunft als freier Bauer – auch wenn er als weichender Erbe den Hof verlassen musste – ist ihm anzumerken. Die eigene Scholle macht die Menschen freier, der Besitz von Land macht sie selbstsicherer. Stolz erzählte er mir auch gleich, dass er von diesem Hofe stamme und dass sein Bruder Mitbesitzer einer Alm wäre, auf der auch wir jagen würden und die von Anfang an vom Jagdverein gepachtet worden sei.
Auf der dieser Alm benachbarten Alm, der Lachkendlalm, wollten wir unser Waidmannsheil suchen. Früh in stockdunkler Nacht holte mich Sepp ab. Ein frischer Wind wehte, und das recht heftig, doch das sollte uns nicht abhalten, ganz oben, jenseits der Baumgrenze, zu pirschen. Hinter dem Haus seines Bruders passierten wir die Schranke, die errichtet werden musste, um zu verhindern, dass auf den Forstaufschließungswegen allzu viel Verkehr herrscht. Die Talbewohner, aber auch so manche Touristen, sind nur zu gerne mit dem Auto fast bis zu den Bergspitzen gefahren, um nicht den mühevollen und viele Schweißtropfen kostenden Aufstieg machen zu müssen.
In engen Serpentinen schwang sich der Weg durch die Wälder, ab und an flüchtete ein Waldhase aus dem Lichtkegel unseres Fahrzeuges, sogar Rotwild konnten wir nahe im Bestand ausmachen. „Anblick haben wir gehabt“, war unser gemeinsame Kommentar, und da konnte ja nichts mehr schief gehen. Kurz vor der Waldgrenze löschte Sepp das Fahrlicht, nur das schwache Standlicht zeigte ein wenig, und eher schemenhaft, den Weg und vor allem die geschlagenen Bäume, die oft auf den Weg ragten. Eine Eule glitt vor dem Auto durch die Luft, riesiggroß, und verschwand aus dem Licht, und als wir die letzten schützenden Bäume hinter uns gelassen hatten, schalteten wir auch das Standlicht aus. Langsam, sehr vorsichtig fuhren wir den Almweg weiter. Auf einer Kante, nicht weit entfernt, verhoffte Rotwild, nur der Glanz der Sterne ließ es uns als Schattenriss erkennen. Wild war also hier oben, doch wie jetzt an die Stücke herankommen?
Einige hundert Meter vor der Almhütte ließen wir das Fahrzeug stehen, und als wir die Türen öffneten, da pfiff ein scharfer, unangenehm kalter Wind durch das Auto. Da er aber talwärts ging, sollte er uns nicht stören, erfrieren würden wir schon nicht.
Nachdem ich die Büchse durchgeladen hatte – ein fürchterlich verräterischer Lärm, der trotz des Sturmes beinahe meilenweit zu vernehmen war – , schulterten wir die Rucksäcke, ergriffen die Bergstöcke, und dann ging es auf dem Almweg weiter hinauf zu den Hütten der Lachkendlalm. Wir waren mitten im Einstandsgebiet, überall könnte jetzt Wild vorkommen, doch wir hatten noch einen langen Weg hin zum „Adlerhorst“, wo wir den Morgen erwarten wollten. Nach einem viertelstündigen Marsch hatten wir die Almhäuser erreicht. Ganz flach, wie in die Erde geduckt, sind sie gebaut. Auf die mit Steinen beschwerten Schindeldächer konnten wir bequem schauen, die aus dicken Baumstämmen roh gezimmerten Wände schauten kaum aus der Erde heraus. Es roch nach Kuh und nach Schnee. Wir zwängten uns durch das schmale Tor, welches das Vieh abhalten und welches die kleine Terrasse, die vor der Hütte in den Berg gegraben worden ist, vor den allzu üppigen Hinterlassenschaften der Kühe schützen sollte.
Sepp bat um eine kleine Pause und verschwand dann hinter dem Haus. Auf den Bergstock gestützt, wartete ich und dabei hatte ich die Muße, über das weite und lange Tal zu schauen. Gleich neben der Hütte fiel der Hang doch recht steil ab, und so hatte ich die Illusion, wie auf einer Burg zu sein, die hoch über der Landschaft thront. Tief unter uns auf dem Talgrund waren vereinzelte Lichter zu sehen und in weiter Ferne die Kette der Dreitausender, die den Talschluss bilden. Ein seltsames Gefühl der Verlassenheit beschlich mich und auch eines der Verlorenheit. Dort oben auf den Almen leben im Herbst keine Sennen mehr, die Zivilisation hat mit Beginn der Hirschbrunft diese Höhe verlassen, dann herrscht dort nur noch Ruhe und Menschenleere. Dazu kommt noch die Weite des Blickes, in der Ferne die wenigen Lichter und um uns das Fauchen und Heulen des Windes, der die eisige Luft von den Spitzen der Berge und aus den...