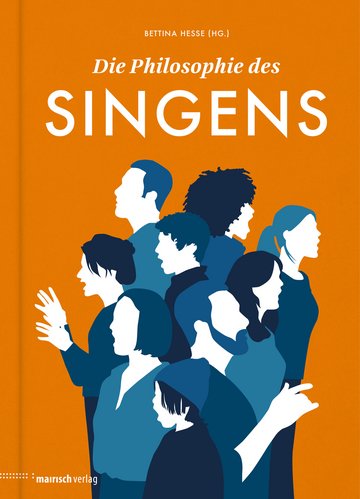ATMEN MUSS ICH SOWIESO
Von Lisa Pottstock
Singen ist verwegen, an einem harmlosen Ort zeigt es sich gewaltig. Ich weiß davon, seitdem ich zum ersten Mal gesungen habe und mich dabei ein Schauder traf, der mir uneinholbar vorkam. Den Mund zu öffnen und einen Ton hinauszugeben, der dann unter keinen Umständen zurück in meine Kehle zu holen war, für immer herausgegeben, vielleicht von einem zum Hören bereiten Ohr empfangen und verarbeitet – das schien mir auf eine stille Weise ein radikaler Vorgang. Für radikal hielt ich die Entscheidungen des Lebens, die eigenen Entscheidungen, die mir noch weit entfernt und zukünftig waren. Das Radikale am Singen passierte seltsam still, ganz beiläufig war es zugegen in diesem Kinderchor, der doch vor allem das Vergnügen verhießen hatte. Vom Spaß hatten wir gehört, den das Singen machte, jungen und alten Menschen zugleich, und dass gemeinsames Singen etwas richtig Schönes sei. Radikal hörte sich das nicht an, eher nach allgemeiner Freundlichkeit.
Der Spaß hat sich auch sofort gezeigt. Freimütig hat er sich eingestellt und tut es seitdem, sobald ich auf Räume des Singens stoße. Darunter aber stürmte es. Hier ging es nicht mehr um ein harmloses Singvergnügen, das mir auch später noch oft wie ein Missverständnis vorkam. Während wir eifrig kleine Töne lernten, ging es darunter um nichts Geringeres als die eigene Existenz. Es ging um den eigenen Körper, der sich da nach außen gab und zur Verfügung stellte willen einer Erfahrung, die die mir vorhandenen Dimensionen überstieg. Sie hatte mit etwas zu tun, das nur in der Gegenwart geschehen konnte, mit einem Loslassen, das einen zugleich anfüllte. Sie war die Erfahrung einer sehr entschiedenen Kraft.
Mit Worten bin ich dem Singen nie wirklich nahegekommen. Ich beließ es bei dem Eindruck, über ein verwirrendes Quasi-Geheimwissen zu verfügen, das sich durch die Momente des Singens stetig erweiterte. In den Chören fand ich die still Mitwissenden. Ich entdeckte sämtliche YouTube-Videos von Nina Simone und die Musik von Johann Sebastian Bach. Ich fand Lieder vor, kastilische Volksweisen, sizilianische Passionsgesänge, den endlosen Kanon, das Lied am Berg. Mich erreichten sozusagen Indizien. Ich lernte die Philosophie kennen, dachte über Ästhetik nach, über das Politische, den Körper und den Geist, über Demokratie. Ich verbrachte viel Zeit mit gemeinsamem Singen, feierte Feste, die hauptsächlich aus Gesang bestanden, musizierte mit der Singkompanie Mayröcker im Theater und in der Kneipe, vor allem aber jede Woche in der gemeinsamen Probe. Ich versuchte auch, die Philosophie und das Singen miteinander zu verbinden, bisher kam ich darin nicht weiter, als ein Lied in den philosophischen Text hineinzusingen.
Die Philosophie des Singens, die ich machen will, geht also über diesen Text hinaus, hat zum Teil schon stattgefunden, wird sich zukünftig eventuell für eine Oper halten, in jedem Fall fühlt sie sich wohl im Chor. Hier nun soll sie sein: ein Text, geschriebenes Wort, ein Buch. Die Voraussetzung für diesen Text ist mein Verhältnis zum Singen. Dieses Verhältnis ist nicht wenig drastisch und so wird dies auch die Philosophie des Singens, die ich schreiben kann, nicht sein. Sie ist vielmehr die Suche nach einem Grund für diese Drastik und der Versuch, ihn in Worte gefasst zu verstehen.
Die Erfahrung des Singens ist eine körperliche Erfahrung, daher ist dieser Text ein Nachdenken über den singenden Körper. Der singende Körper ist mein Ausgangspunkt. Von dort aus will ich verstehen, was mir am Singen radikal vorkommt und was Singen heute bedeutet. Geleitet bin ich dabei vom Begriff des Performativen. Das Performative verstehe ich als philosophische, soziologische und kulturelle Entdeckung einer politischen Dimension des Körpers und seinen Möglichkeiten, zu erscheinen. Der Begriff des Performativen ist die Annahme, dass das Erscheinen oder Nicht-Erscheinen von Körpern im Raum einen Aspekt des Handelns beinhaltet, also auch politisch sein kann. Singen ist eine Weise des Körpers, in Erscheinung zu treten, und deswegen werde ich hier den Begriff des Performativen verwenden, wenn ich über den singenden Körper nachdenke; ich werde versuchen, die performative Kraft des Singens zu bestimmen.
Der Ausdruck performativ hat das Nachdenken über Sprache, über kulturelle Phänomene, über Geschlechteridentitäten sowie die darstellenden Künste in den letzten Jahrzehnten bewegt und ein neues Verständnis ermöglicht. Der Philosoph John Langshaw Austin begründete 1955 in einer Vorlesungsreihe den Ausdruck performativ, um zu beschreiben, dass eine sprachliche Äußerung der Vollzug einer Handlung sein kann, dass also ein Satz, sobald er ausgesprochen ist, Wirklichkeit konstituieren und verändern kann. In ihrer Forschung zu Geschlecht, Geschlechtsidentität und politischer Gewalt überträgt Judith Butler den Begriff der Performativität seit den 1990er-Jahren vom sprachlichen auf den körperlichen Ausdruck. Auch der Körper »sagt« etwas auf eine Weise, die den körperlichen Ausdruck und das bloße körperliche Erscheinen zu einer Handlung machen. Der Körper wird dabei als Fläche verstanden, die Inszenierung und Einschreibung erfährt, und dann als ein so und so lesbarer Körper erscheint, als ein so und so bestimmter Körper gelesen wird.1
Sowohl Austins Sprachphilosophie als auch Butlers Theorie zur leiblichen Performativität gehen von einem gesellschaftlichen Raum aus, der durch Normen strukturiert ist, durch die das Performative überhaupt gelingen kann. Erst durch explizite oder implizite, soziale und historische Erwartungen an ein bestimmtes Geschehen, an ein Verhalten, an eine Äußerung wird das Performative wirklich und erfahrbar. Performativität als philosophische Kategorie zu verwenden, ist immer auch die Entscheidung, historische und soziale Gegebenheiten in das Verstehen eines Gegenstandes miteinzubeziehen. Die performative Kraft des Singens zu bestimmen bedeutet also, Singen im historischen Kontext des Körpers zu denken, Singen sozusagen vor dem Hintergrund einer Geistesgeschichte des Körpers zu verstehen.
Die Erscheinung eines singenden Körpers ist sein Klang. Die singende Person tut etwas, das Klang erzeugt, sie tut es mit ihrem eigenen Körper, den sie zur Klangproduktion und als Klangraum verwendet. Sie gebraucht dazu ihren Stimmapparat, den Kehlkopf, die Stimmlippen, fünf Knorpel und fünf Muskeln, sie gebraucht Dinge wie Gaumensegel und Zungenbein.2 Vor allem aber gebraucht sie ihren Atem. Ein Atemzug kann, den komplizierten Stimmapparat passierend, geräuschvoll werden, kann Schallwellen herstellen, Klang spenden und schließlich Ton sein, der sich, in diversen körperlichen Räumen resonierend, als Stimme nach außen gibt. Der Ton, der gesungen wird, ist nicht der Ton, der informieren oder mitteilen will, ist keiner, der Aussagen trifft, er möchte nichts sagen. Er möchte gesungen werden und schön sein. Der singende Körper gebraucht den Atem, damit es schön klingt. Um das Performative am Gesang zu beschreiben, möchte ich Singen ganz nah an diesem Vorgang verstehen, also als Klang, der von meinem atmenden Körper hergestellt wird. Erst später frage ich danach, was Singen zum Ausdruck bringt und was die besondere Emotionalität des Singens ist. Aufschieben werde ich die Frage, was es für einen Text bedeutet, wenn er vertont wird, wenn er auf eine musikalische Melodie verteilt wird.
Ich mache also eine schlichte Beobachtung: Beim Singen tritt ein Körper in Erscheinung, der seinen Atem zum Klingen bringt. Der Atem ist etwas, das unmittelbar verbunden ist mit dem Leben. Ein- und Ausatmen ist die grundlegende Lebensfunktion, die unsere Körper mit Sauerstoff versorgt, die also den Austausch von Außen und Innen organisiert, ohne den unsere Körper nicht so funktionieren würden, wie sie es tun. In der Philosophie werden die Lebensfunktionen eines Organismus klassischerweise unter dem Aspekt der Notwendigkeit gedacht, das heißt sie werden als etwas verstanden, das unweigerlich einer Gesetzmäßigkeit folgt. Auf diese Weise wird auch der Bereich des Natürlichen charakterisiert.3 Unsere Erfahrung entspricht diesem Verständnis. Der Atem ist wie der Herzschlag ein reflexartiger Vorgang, der durch die Notwendigkeit des natürlichen Lebens bestimmt wird und nicht Gegenstand unserer Entscheidung ist. Der Atem begleitet uns permanent und bedeutet uns auch permanent eine Grenze des Lebendigen. Wenn ich diesem philosophischen Verständnis folge, dann denke ich mir das Ein- und Ausatmen unserer Körper als ein zentrales Wirken einer naturgegebenen Notwendigkeit, die bewusst oder unbewusst ständig erfüllt wird. Atmen also muss ich sowieso. Singen dagegen muss niemand. Auf diese Weise den Atem zu gebrauchen, so, dass er schön klingt, ist jedem*r freigestellt. Geschieht das aber dennoch, wird also gesungen, dann wird dieser permanente, reflexhafte und lebensnotwendige Vorgang des Atmens verziert. Dies zu tun finde ich verwegen, und darin scheint mir die performative Kraft des Singens zu liegen. Denn das zentrale Wirken einer naturgegebenen Notwendigkeit, das Atmen, wird beim Singen nicht zu diesem natürlichen Zweck benutzt, sondern um einen ästhetischen Gegenstand hervorzubringen. Klingend tritt der Atem in Erscheinung und wird ästhetisch. Es wird etwas wahrnehmbar, das zuvor gar nicht im Spiel war, nämlich ein Vorgang der Gestaltung. Der Atem wird beim Singen als Gestaltungsfläche erfahrbar und sein Klang als Ergebnis einer ästhetischen Entscheidung. Es ist also etwas geschehen, der singende Körper hat einen bestimmten Erfahrungsraum etabliert.
Ästhetische Entscheidungen sind immer Entscheidungen für...