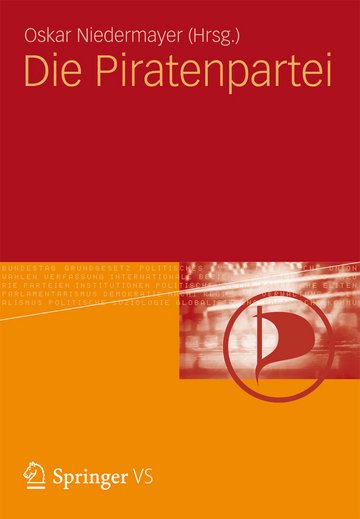| Inhalt | 5 |
| Einleitung: Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteiensystem | 7 |
| 1 Zur Messung des „Erfolgs“ neuer Parteien im Parteiensystem | 7 |
| 2 Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteienwettbewerb | 9 |
| 3 Zu diesem Band | 13 |
| Literatur | 14 |
| Die Vorgeschichte: die Urheberrechtsdebatte und die schwedische Piratpartiet | 15 |
| 1 Der technische Fortschritt und die Auswirkungen auf die Urheberrechtsdebatte | 15 |
| 2 Das Antipiratenbüro und die Verschärfung der schwedischen Urheberrechtsgesetze | 17 |
| 3 Die Gründung der schwedischen Piratpartiet | 19 |
| 4 Aufstieg und Fall der Piratpartiet | 21 |
| 5 Das Dilemma der Piratpartiet und die Unterschiede zu den deutschen Piraten | 24 |
| Literatur | 28 |
| Die Piraten im parteipolitischen Wettbewerb: von der Gründung Ende 2006 bis zu den Wahlerfolgen in Berlin 2011 und im Saarland 2 | 29 |
| 1 Rechtliche Hürden für den Erfolg neuer politischer Vereinigungen | 29 |
| 2 Von der Gründung der Piratenpartei 2006 bis zu den ersten Wahlteilnahmen auf der Landesebene 2008 | 32 |
| 3 Die bundesweiten (Achtungs-)Erfolge bei der Europawahl und der Bundestagswahl 2009 | 35 |
| 4 Die Durststrecke nach der Bundestagswahl und der Erfolg bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2011 | 42 |
| 5 Der erfolgreiche Auftakt des Wahljahres 2012: die Piratenpartei zieht in den saarländischen Landtag ein | 49 |
| 6 Die bundespolitische Entwicklung | 53 |
| 7 Ausblick | 58 |
| Literatur | 60 |
| Die Wähler der Piratenpartei: wo kommen sie her, wer sind sie und was bewegt sie zur Piratenwahl ? | 62 |
| 1 Wie groß ist das Wählerpotenzial der Piratenpartei und was halten die Bürger von ihr ? | 62 |
| 2 Wo kommen die Wähler der Piratenpartei her ? | 63 |
| 3 Wer sind die Wähler der Piratenpartei ? | 66 |
| 4 Was bewegt die Wähler zur Wahl der Piratenpartei ? | 70 |
| 5 Fazit | 72 |
| Literatur | 72 |
| Backbord oder Steuerbord: Wo stehen die Piraten politisch ? | 73 |
| 1 Weder links noch rechts, sondern Pirat | 73 |
| 2 Wahlberechtigte und Wähler: Die politischen Nachfrager | 74 |
| 3 Parteienwettbewerb: Das politische Angebot | 76 |
| Literatur | 78 |
| Organisationsstruktur, Finanzen und Personal der Piratenpartei | 79 |
| 1 Einleitung | 79 |
| 2 Die Entwicklung der Organisationsstruktur | 79 |
| 3 Die finanziellen Ressourcen | 83 |
| 4 Mitglieder und Führungspersonal | 88 |
| 5 Fazit | 96 |
| Literatur | 97 |
| Das Kommunikationsmanagement der Piraten | 98 |
| 1 Einleitung | 98 |
| 2 Grundkonstellationen: Transparenz und Offenheit | 100 |
| 3 Kollaboration als Eckpfeiler der Parteiarbeit | 103 |
| 4 Twitter, Facebook, „Dicker Engel“ Die Echtzeitkommunikation der Piraten | 106 |
| 5 Hyperlinks, Etherpads, LiquidFeedback Technisierung und Automatisierung der Kommunikation | 110 |
| 6 Nerds, Ponys und der #Roflcopter: Populärkulturelle Bezüge in der Parteikommunikation | 114 |
| 7 Politische Produktionsgemeinschaften: Parteien in der digitalen Mediendemokratie | 117 |
| Literatur | 119 |
| Ein Blick nach Innen: Das Selbstverständnis der Piraten | 122 |
| 1 Vom Selbstverständnis in der Piratenpartei | 122 |
| 1.1 Zum Engagement in der Piratenpartei | 123 |
| 1.2 Wie sieht die Piratenpartei ihre eigene politische und programmatische Entwicklung ? | 125 |
| 1.3 Innerparteiliche Demokratie, Kommunikation und Partizipation | 130 |
| 1.4 Was denken die Piraten über Demokratie an sich ? | 135 |
| 1.5 Die Sozialstruktur der Mitgflieder | 138 |
| 1.6 Berlin, Saarland – und dann ? | 139 |
| Literatur | 145 |
| Die Piratenpartei und die Genderproblematik | 146 |
| 1 Einleitung | 146 |
| 2 Repräsentation der Frauen unter den Piraten | 147 |
| 2.1 Parteimitglieder und Wähler | 147 |
| 2.2 Politische Ämter | 149 |
| 3 Genderdebatte bei den Piraten | 151 |
| 3.1 Diskussion über die Satzung: Pirat vs. Piratin | 151 |
| 3.2 Frauenquote bei den schwedischen und deutschen Piraten | 153 |
| 3.3 Der Begriff „post-gender“ | 155 |
| 3.4 Piratinnen – Klarmachen zum Gendern | 158 |
| 3.5 Brandbrief der Jungen Piraten | 161 |
| 4 Umfrage des Kegelklubs | 162 |
| 4.1 Ergebnisse der Umfrage des Kegelklubs | 163 |
| 4.2 Post-gender Gruppen | 165 |
| 5 Fazit | 169 |
| Literatur | 171 |
| Plattformneutralität. Zur Programmatik der Piratenpartei | 172 |
| 1 Partei ohne Inhalte ? | 172 |
| 2 Das Grundsatzprogramm | 173 |
| 2.1 Netzpolitik | 176 |
| 2.2 Demokratiepolitik | 178 |
| 2.3 Gesellschaftsund Sozialpolitik | 179 |
| 2.4 Wirtschaftspolitik | 181 |
| 3 Fazit | 182 |
| Literatur | 185 |
| Die Piratenpartei in der ideologisch-programmatischen Parteienkonstellation Deutschlands: Das Füllen einer Lücke ? | 186 |
| 1 Einleitung | 186 |
| 2 Grundlagen und Muster des Parteienwettbewerbs in Deutschland | 188 |
| 3 Die Angebotsseite: Die programmatische Ausrichtung der Piratenpartei | 191 |
| 3.1 Computergestützte Inhaltsanalysen programmatischer Dokumente | 191 |
| 3.2 Inhaltliche Positionen der Parteien gemäß des Wahlomaten | 196 |
| 4 Die Nachfrageseite: Wahrnehmung der Piratenpartei aus Wählersicht | 201 |
| 5 Schlussfolgerungen | 205 |
| Literatur | 207 |
| Die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus | 210 |
| 1 Einleitung | 210 |
| 2 Piraten und Parlamentsfunktionen | 211 |
| 2.1 Repräsentation | 212 |
| 2.2 Regierungsbezogene Parlamentsfunktionen | 219 |
| 2.3 Selbstorganisation | 225 |
| 3 Weitere Aktivitäten und öffentlich Wahrgenommenes | 226 |
| 4 Die Besonderheiten der Piratenfraktion | 228 |
| 5 Fazit | 231 |
| Literatur | 232 |
| Die netzpolitischen Reaktionen der anderen Parteien auf das Erscheinen der Piratenpartei | 233 |
| 1 Einleitung | 233 |
| 2 Die Beeinflussung des Parteienwettbewerbs durch die Piratenpartei | 234 |
| 3 Die Erarbeitung der netzpolitischen Positionen in den anderen Parteien | 236 |
| 4 Die Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ des Bundestags | 249 |
| 5 Wesentliche netzpolitische Entscheidungen nach der Bundestagswahl 2009 | 251 |
| 6 Fazit | 253 |
| Literatur | 253 |