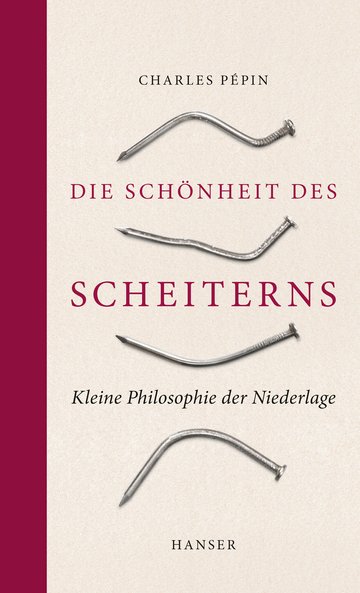1
WER SCHEITERT, LERNT SCHNELLER
Wir befinden uns in Tarbes, Südwestfrankreich, mitten im Winter des Jahres 1999. Der junge Spanier ist 13 Jahre alt. Er hat soeben das Halbfinale des Tennisturniers »Les Petits As« verloren, die inoffizielle Weltmeisterschaft der 12- bis 14-Jährigen. Der Franzose, der ihn besiegt hat und das Turnier gewinnen wird, ist im gleichen Jahr geboren und genauso groß wie er. Es war ein Leichtes für ihn gewesen, ihn zu bezwingen. Der Wunderknabe heißt Richard Gasquet: Er ist »der kleine Mozart des französischen Tennis«. Die Fachleute behaupten, kein Spieler seines Alters habe jemals eine derartige Meisterschaft erreicht. Mit neun Jahren prangte er bereits auf dem Titelblatt von Tennis Magazine, das titelte: »Le champion que la France attend?« – Frankreichs zukünftiger Weltmeister? Seine vollendeten Bewegungen, die Schönheit seiner einhändigen Rückhand, die Angriffslust seines Spiels bedeuteten ebenso viele narzisstische Verletzungen für seinen Gegner. Nachdem der Junge aus Mallorca Richard Gasquet die Hand gereicht hat, lässt er sich völlig erledigt auf seinen Stuhl fallen. Sein Name ist Rafael Nadal.
Rafael Nadal hat es an jenem Tag nicht geschafft, Weltmeister seiner Altersklasse zu werden. Wenn man sich dieses Spiel heute auf YouTube anschaut, fällt besonders die aggressive Spielweise von Richard Gasquet auf: Er nimmt den Ball sehr früh und überrumpelt den Gegner. Und genau diese Art, möglichst aggressiv in den Ball zu gehen, erinnert auf seltsame Weise an das, was später Rafael Nadals Erfolg ausmachen wird, jenem Tennisspieler, der jahrelang die Weltrangliste anführen und 60 Turniere gewinnen wird, davon zwölfmal den Grand-Slam-Titel. Richard Gasquet ist ein bedeutender Spieler geworden: Er hat es bis auf Platz sieben der Weltrangliste geschafft. Doch bis heute hat er kein einziges der Grand-Slam-Turniere gewonnen. Überhaupt hat er insgesamt nur neun Titel geholt. Egal, was für Glanzleistungen er noch in Zukunft vollbringt, er wird es nie mehr so weit schaffen wie Rafael Nadal. Daher stellt sich die Frage: Was war entscheidend für diesen Unterschied?
Ein Blick auf den Werdegang von Rafael Nadal kann eine Teilantwort geben. In jungen Jahren hat er viele Fehlschläge erlebt, Spiele verloren und, weil ihm die klassische Vorhand partout nicht gelingen wollte, eine eigene Vorhand entwickeln müssen, die zu seinem Markenzeichen geworden ist: Nach dem Ballschlag schnellt sein Schläger mit einer unwahrscheinlichen Geste wie ein Lasso in die Höhe. Nach seiner Niederlage spielte Rafael Nadal noch 14-mal gegen Richard Gasquet –, und er gewann alle 14 Spiele. Was geschah nach der Niederlage? Zweifellos begann Rafael Nadal, sich mehr für Gasquets Spiel zu interessieren, und hat es mit seinem Onkel und Trainer Tony Nadal in allen Einzelheiten analysiert. Zweifellos hat er an jenem Tag in Tarbes mehr aus seiner Niederlage gelernt, als wenn er gesiegt hätte. Vielleicht hat er sogar mehr aus dieser einen Niederlage gelernt, als es bei zehn Siegen der Fall gewesen wäre. Möglich auch, dass ihm das eigene Maß an Aggressivität, zu dem er fähig ist, eben in jenem Moment klar wurde, in dem er der von Richard Gasquet unterlag. Ich bin überzeugt, dass Rafael Nadal diese Niederlage half, sein wahres Talent schneller zu entdecken. Übrigens hat er im Jahr darauf das Turnier »Les Petits As« gewonnen.
Vielleicht liegt genau hier das Problem von Richard Gasquet: Von seinen ersten Gehversuchen auf dem Tennisplatz bis zum Alter von 16 Jahren sind ihm die Siege scheinbar mühelos in den Schoß gefallen. Kann es sein, dass er während der wichtigen Lehrjahre nicht genug scheiterte? Oder dass es beim ersten Scheitern schon zu spät war? Oder dass er, weil er fast nie scheiterte, nie die Erfahrung der widerständigen Wirklichkeit gemacht hat? Jene Erfahrung, die uns zwingt, die Wirklichkeit zu hinterfragen und zu analysieren und uns über den seltsamen Stoff zu wundern, aus dem sie gemacht ist. Erfolge sind angenehm, aber sie sind oft weniger lehrreich als Misserfolge.
Bestimmte Siege sind nur zu erringen, wenn Schlachten verloren werden. Eine paradoxe Aussage, der aber, wie ich meine, etwas vom Geheimnis der menschlichen Existenz innewohnt. Beeilen wir uns also zu scheitern, denn so begegnen wir der Wirklichkeit intensiver als bei unseren Erfolgen. Weil die Wirklichkeit uns Widerstand bietet, hinterfragen wir sie und betrachten sie aus allen Blickwinkeln. Weil sie uns Widerstand bietet, finden wir in ihr den Rückhalt, den wir brauchen, um Schwung zu nehmen.
In Studien über die Aktivitäten von Start-ups im Silicon Valley würdigen amerikanische Theoretiker das Fail-Fast – scheitere schnell – und sogar das »Fail-Fast, Learn-Fast« – scheitere schnell, lerne schnell – und heben den Lerneffekt früher Fehlschläge hervor. In den Jahren der Ausbildung ist der Geist wissbegierig und vermag sofort Lehren aus den sich bietenden Widerständen zu ziehen. Wie die Fachleute aufzeigen, sind Unternehmer, die früh scheiterten und schnell Lehren aus ihren Fehlschlägen gezogen haben, erfolgreicher – und vor allem schneller erfolgreich – als solche, deren Laufbahn ohne größere Hindernisse verläuft. Erfahrungen, auch missglückte, besitzen eine große Kraft und bringen einen schneller vorwärts als die besten Theorien.
Wenn stimmt, was die Fachleute sagen, dann wird auch verständlich, was all jenen guten, seriösen, anständigen Schulabgängern fehlt, die auf den Arbeitsmarkt kommen, ohne jemals gestrauchelt zu sein. Was sie wohl gelernt haben, wenn sie nichts weiter als die Regeln befolgt und die Vorgaben erfolgreich umgesetzt haben? Fehlt ihnen da nicht ein Sinn für den Neubeginn, für das in unserer Welt des schnellen Wandels entscheidende schnelle Reaktionsvermögen?
In meinem Beruf als Philosophielehrer habe ich bei vielen Gelegenheiten den Nutzen frühzeitiger Fehlschläge beobachten können und die daraus resultierende Fähigkeit, schneller erfolgreich zu sein.
Das Fach Philosophie steht im letzten Gymnasialjahr auf dem Lehrplan, ist also neu. Wie in keinem anderen Fach werden die Schüler zu eigenständigem Nachdenken gefordert, dürfen sich nie dagewesene Freiheiten im Umgang mit ihrem Wissen herausnehmen und sich an die großen Fragen der Existenz heranwagen. Aus heutiger Sicht kann ich nach 20 Jahren Philosophieunterricht behaupten, dass es besser ist, den ersten Aufsatz zu vermasseln, statt eine Durchschnittsnote zu kassieren und sich keine weiteren Fragen zu stellen. Eine schlechte Note zum Auftakt ermöglicht dem Schüler, das geforderte radikale Umdenken zu begreifen. Es ist besser, frühzeitig zu scheitern und sich die wahren Fragen zu stellen, statt durchzukommen, aber nicht zu begreifen, warum: Danach stellen sich schneller Fortschritte ein. Wird dieses Scheitern unmittelbar danach im Unterricht thematisiert, eröffnet sich ein leichterer Zugang zur Philosophie über das Scheitern als über den Erfolg.
Jahrelang habe ich Philosophie oder »culture générale«, wie sie offiziell genannt wird, auf Sommervorbereitungskursen für die Eingangsprüfung zur Aufnahme am Sciences Po Paris gelehrt. An den Intensivkursen im Lycée Lakanal in Sceaux, inmitten eines blühenden großen Parks, nahmen junge Abiturienten teil. Da die Prüfungen Ende August/Anfang September stattfinden, begannen die Kurse Mitte Juli und dauerten fünf Wochen. Hier konnte ich das gleiche Phänomen beobachten wie in der Schule, nur geraffter. Teilnehmer, die den Kurs mit ordentlichen Noten begonnen hatten, schafften die Prüfung zur Aufnahme am Sciences Po Paris am Ende des Sommers häufig nicht. Unter den Teilnehmern hingegen, die zu Beginn des Kurses einige richtig schlechte Noten kassiert hatten, schafften fünf Wochen später die meisten mit Bravour ihre Aufnahme an die Grande École in der Rue Saint-Guillaume. Dieses Scheitern, ihre erste »Krise« zu Kursbeginn, bot sich ihnen als Chance, sich der neuen Wirklichkeit zu stellen, die sie erwartete, während die mit den Durchschnittsnoten an dieser Stelle nichts mitnahmen. Die einen weckte das Scheitern auf, während die anderen über ihre kleinen Erfolge einschliefen. Ein relativ kurzer Zeitraum – fünf Wochen – reichte also aus, um zu zeigen, dass ein akzeptierter Fehlschlag mehr bringt als gar keiner. Mit anderen Worten, ein frühzeitiger Fehlschlag, der schnell wieder eingerenkt wird, ist mehr wert als gar kein Fehlschlag.
Diese Sicht der Dinge ist einleuchtend, in Ländern wie Deutschland und Frankreich aber kaum verbreitet. Für die amerikanischen Theoretiker stellt das Fail-Fast – das frühzeitige Scheitern als Tugend – den Gegenbegriff zum Fast-Track dar, die Vorstellung, wonach es entscheidend ist, sich so früh wie möglich auf die Fährte (»track«) des Erfolgs zu bringen, schnell erfolgreich zu sein. Letzteres entspricht in vielerlei Hinsicht der Auffassung von Erfolg, wie sie heute in Frankreich vorherrscht. Tatsächlich leiden wir an dieser Fast-Track-Ideologie.
In den USA, aber auch in Großbritannien, Finnland oder Norwegen sprechen Unternehmer, Politiker oder Sportler gerne über die Fehlschläge, die sie am Anfang ihrer Karriere erleiden mussten, und führen sie so stolz vor wie ein Krieger seine Narben. Wir hingegen definieren uns selbst unser Leben lang über die Diplome, die wir gemacht haben, als wir noch bei unseren Eltern wohnten.
Bei meinen Coachings in Unternehmen habe ich oft mit Personen in leitenden Funktionen zu tun, die sich mit HEC 76, ENA 89 oder X 80 vorstellen, sprich als Absolventen der Elitehochschulen École des hautes études commerciales im Jahr 1976, der École nationale d’administration 1989 und der École polytechnique 1980. Das überrascht mich jedes Mal wieder. Die...