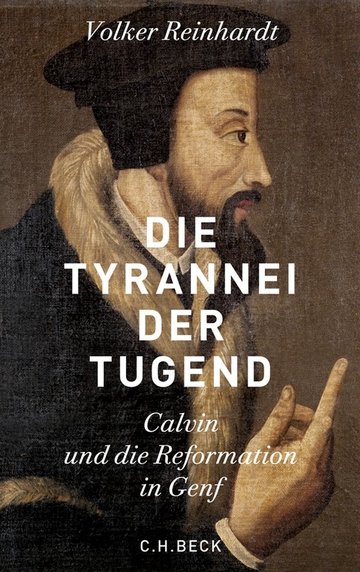EINLEITUNG:
DIE WIDERSPENSTIGE STADT
Der Einsicht des Florentiner Patriziers Francesco Guicciardini hätten seine Genfer Zeitgenossen leidenschaftlich widersprochen. Ob Anhänger der alten Kirche oder Parteigänger der neuen kirchlichen Ordnung, die sich allmählich herausbildete: sie alle sahen in den verwickelten, von unvorhergesehenen Hindernissen gehemmten und dann wieder von dramatischen Episoden beschleunigten Ereignissen in Genf den von Gott vorherbestimmten Verlauf und damit den tiefsten Sinn der Geschichte. Noch die geringfügigste Begebenheit wurde aus diesem Blickwinkel bedeutungshaltig und fügte sich ein in eine Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen, in der nichts dem Zufall überlassen blieb, sondern alles höhere Notwendigkeit war. Die Sieger glaubten in ihrem Triumph – und hing er auch nur von wenigen Wahlstimmen ab – einen von Anbeginn der Zeiten an gefassten Ratschluss des Herrn zu erkennen. Für die Unterlegenen war die Niederlage, falls sie nicht die Hand des Teufels am Werke wähnten, eine verdiente Strafe des Himmels, die sie zu Buße, Einkehr, Neubeginn und dauerhaftem Erfolg anspornen sollte.
Allzu viel hat sich an einer solchen Sichtweise bis heute nicht geändert. Gewiss, den Zeigefinger Gottes wird die Geschichtswissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts nicht mehr ins Spiel bringen. Dafür belohnt sie die Sieger auf andere, kaum weniger exklusive Weise: Sie betrachtet ihren Erfolg als zwangsläufig, bestimmt durch die Ausstrahlungskraft der Ideen, durch die Überzeugungsmacht der Argumente, durch die schlüssigen Antworten, die auf die großen Fragen der Zeit gegeben werden. So weben auch viele neuere Historiker einen roten Schicksalsfaden und lassen die Ereignisse auf ein Ziel zulaufen, das vorgegeben, ja geradezu prädestiniert erscheint. Dass sich am Ende, trotz aller Widrigkeiten und zeitweise übermächtig erscheinender Gegner, die Reformation Calvins in der kleinen Republik an der Rhone durchsetzen konnte und von dort aus ihre welthistorischen Wirkungen im atlantischen Europa und in Übersee entfaltete, stellt sich, so betrachtet, als ein Durchbruch zur Moderne dar. Was sich im spannungsreichen Alltag Genfs zwischen Ratssaal, Geschäftskontor, Gottesdienst und Ehebett zutrug, wird auf diese Weise zu einer vorherbestimmten Etappe der Zivilisierung und Disziplinierung des Menschen auf dem Weg in eine Gegenwart überhöht, die in diesem Werdegang ihre eigene Entwicklung und damit sich selbst zu erkennen vermeint.
Bezeichnenderweise kann diese Wahrnehmung heute im protestantischen Europa die Züge einer Distanzierung, wenn nicht Selbstanklage annehmen. Dort, wo sich der Calvinismus als geschichtliche Erscheinung durchsetzte, ist er nicht selten als (Un-)Geist der Selbst- und Fremdausbeutung verpönt. Demgegenüber ist die Lehre des Genfer Reformators da, wo sie keine dauerhaften historischen Wirkungen zu entfalten vermochte, zum Beispiel in Italien, unter Intellektuellen durchaus positiv besetzt: als etwas, das zur erfolgreichen Bewältigung der Moderne in ihrem Land fehlte – und weiter fehlt. Alle diese Mythenbildungen stehen in einer langen Tradition. Von Anfang an scheiden sich am Genf Calvins die Geister. Für die einen ist es das Neue Jerusalem, gegen dessen Mauern das Böse vergebens anrennt, für die anderen der Ort der finsteren Tyrannis, an dem ein machtgieriger Fremder hinter der Maske der strengsten Frömmigkeit seine diktatorischen Gelüste auslebt. Der Kontrast setzt sich bis heute fort: Genf, das Menschheitslaboratorium, aus dem zusammen mit der wohltätigen Selbstdisziplinierung der Geist der Demokratie und der Meinungsfreiheit entsprang – oder Genf, der Archipel Gulag an der Rhone, wo jeder jeden bespitzelte und der Scheiterhaufen für freie Denker loderte. Ob Mythos oder Gegenmythos, in beiden Fällen steht die Stadt an der Rhone zwischen 1541 und 1564 für eine Prägezeit des Menschen am Beginn der Neuzeit; als solche gehört sie für viele zum Ziel und Zweck der Geschichte.
Wie sollte es auch anders sein? Hat doch die Geschichte der Reformation in Genf so viel mit uns heute zu tun. Wer wird als ethisch fühlendes und handelndes Individuum heute nicht für Castellio, den Vorkämpfer religiöser Toleranz, oder für Servet, den theologischen Querdenker, der wegen seiner unorthodoxen Ideen auf dem Scheiterhaufen endete, Partei nehmen? So verständlich diese Sympathien und Abneigungen auch sind, einem historischen Verständnis stehen sie im Wege. Wer Partei nimmt, färbt die Vergangenheit mit eigenen Ideen ein, nicht selten bis zur Unkenntlichkeit. Es ist daher hilfreich, sich bei der Untersuchung der Ereignisabläufe von einem Vor-Wissen oder besser: Nach-Wissen frei zu machen, das die Begebenheiten im Mikrokosmos einer Stadt von 10.000 Einwohnern welthistorisch überfrachtet und damit weltanschaulich regelrecht erdrückt. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die sich in den Wendejahren der Reformation aufgerufen fühlten, Partei zu ergreifen, agierten und agitierten nicht für die Entstehung eines neuen, dem Geist des Kapitalismus zugeneigten Menschentypus, auch nicht für die Menschenrechte oder gar die Demokratie im Hier und Jetzt – alle diese Zuschreibungen werden von Religionssoziologen und Historikern des 20. Jahrhunderts vorgenommen. Die Genferinnen und Genfer stimmten und kämpften dafür, dass ihre Stadt sich dem Herrschaftsbereich des Herzogs von Savoyen beziehungsweise ihres Stadtherrn, des Bischofs, entzog oder auch nicht, sich der Eidgenossenschaft annäherte oder dieser fernblieb. Und sie entschieden, unauflöslich mit diesen politischen Alternativen verknüpft, ob das reine Gotteswort und damit das Heil in der alten oder in der neuen Kirche zu finden sei, die sich in Genf, verglichen mit süddeutschen oder schweizerischen Städten, spät und auch dann nur langsam entfaltete.
Daraus den «Primat des Politischen» abzuleiten, ist nur dann berechtigt, wenn man diesen Begriff im Sinne der Zeitgenossen auslegt. In ihrem Verständnis waren irdisches Leben, Heilserwerb und Jenseits eine Einheit; eine gute weltliche Ordnung hatte die Kommunikation mit Gott, ja den steten Zustrom himmlischen Wohlwollens und Beistands zu gewährleisten. Wer seine Vorstellungen von der gottgewollten Kirche und Lebensordnung durchsetzen wollte, musste daher in einer Republik wie Genf, wo einige hundert Personen an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt waren, Parteigänger finden und so Einfluss auf die vielfältig aufgefächerte Beschlussfassung ausüben. Die andauernde Mehrheitsbeschaffung war in einer von heftigen Emotionen durchpulsten, von tiefen Ängsten verunsicherten und von irrationalen Erwartungen umgetriebenen Stadt mühsam und risikoreich, stand doch für die Beteiligten alles – Seelenheil, Rang, Ansehen, Vermögen, Nachleben – auf dem Spiel. Niemand konnte des erwünschten Verlaufs der Geschichte sicher sein, nicht einmal der in den letzten neun Jahren seines Genfer Wirkens von seinen Anhängern als Sprachrohr Gottes, ja als Prophet verehrte Calvin. Eine neue, bedrohliche Figur auf dem politischen Schachbrett Europas, ein Skandal, der die eigene Gefolgschaft bloßstellte, oder auch der Abfall eines Hauptverbündeten – das alles konnte eine fatale Wahl und einen Stimmungsumschwung zur Folge haben, der am Ende alles zunichtemachte. Das Trauma der politischen Unbeständigkeit spiegelt sich denn auch in der Theologie Calvins: Gott kann die zum Heil notwendige Gnade auch ohne die Kraft der Beharrung verleihen, also wieder entziehen; nur wer wahrhaft zur Kindschaft Gottes erwählt ist, darf sich gegen diesen tiefsten aller Stürze gefeit fühlen. Ungeachtet aller in Genf errungenen Erfolge und der machtvollen Ausstrahlung in den Teil der Welt, der sich vom Papsttum abwandte, rechnete Calvin bis zum Schluss stets mit dem Schlimmsten.
Die Angst, dass am Ende alles vergeblich gewesen sein könnte, trieb unablässig dazu an, dem befürchteten Umsturz vorzubeugen. Wer in einem so instabilen System wie dem Freistaat Genf dauerhaft die Ordnung der politischen und kirchlichen Gemeinde bestimmen wollte, musste sich vielfältig absichern. Konkret hieß das: Netzwerke auf der Grundlage gemeinsamer Interessenausrichtungen zu knüpfen. Kein politischer Prophet, Religions- oder Kirchengründer kann ohne eine sehr irdische Anhängerschaft auskommen. Dass sich diese gewissermaßen von selbst, kraft des Charismas und der erlösenden Botschaft allein, zusammenfügt, ist eine allzu naive Vorstellung, die gleichwohl nicht wenigen Untersuchungen zur Reformation in Genf zugrunde liegt. Solche Darstellungen kommen, so verherrlichend sie auch gemeint sind, einer eklatanten Unterschätzung gleich. Ausgeblendet wird die herausragende Fähigkeit Calvins zum strategischen Handeln in der Gesellschaft, und zwar mit allen Mitteln und Methoden, die dafür zu Gebote stehen: der Gewinn von Einfluss durch Patronage, die Prägung von Überzeugungen und Glaubenswelten durch ausgefeilte Techniken der Kommunikation, Gefolgschaftsbildung durch Interessen verklammernde Programme.
Ein solches Vorgehen steht keineswegs im Widerspruch zur Theologie, im Gegenteil: Es ist durch das Menschenbild des Genfer Reformators voll und ganz gerechtfertigt. In seinen Augen nämlich ist der Mensch vom permanenten Selbstbetrug beherrscht. Niemand kann in den Spiegel blicken, ohne darin einen Abgrund der Verworfenheit zu erkennen; da er aber den...