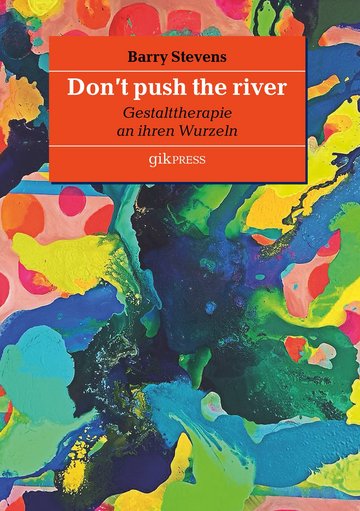See
Lake Cowichan, British Columbia. September 1969. Am Himmel ein paar blaue Flecken und lichterfüllte Wölkchen. Ansonsten vor allem schwere, graue und regenschwangere Wolken über einem rauhen, gekräuselten See. Auf den Wiesen trockene, raschelnde Ahornbäume. Wehende Riedgräser. Reglos die Bäume am anderen Ufer.
In mir geht etwas Seltsames vor. Ich weiß nicht, was ich will. ... Kaum habe ich das aufgeschrieben, weiß ich es.
Im Oktober 1967 schickte mein Sohn mir ein Anmeldeformular und einen Brief, in dem stand: »Melde dich an! Du wirst es nicht bereuen.« Ich meldete mich an. Eine Woche am Gestalt-Institut San Franzisko, morgens von neun bis zwölf, bei einem Mann namens Fritz Perls. Ich hatte keine Idee worauf ich mich da einließ.
Am Montagmorgen trafen sich fünfzehn Leute mit Fritz Perls in einem großen, kahlen Tanzsaal. Das Gestalt-Institut befand sich im Dachgeschoß von Janie Rhynes Haus. Der Gruppenraum wurde von einer anderen Gruppe benutzt. Durch eine der hinteren Ecken des Tanzsaals kam ein wenig Tageslicht herein – dahinter lag ein Raum mit Fenstern. Es gab einen großen, einigermaßen bequemen Stuhl für Fritz. Wir anderen saßen auf Klappstühlen. Fritz sagte: »Ich finde es schwierig, mich in diesem Raum behaglich zu fühlen.« Wir waren eine kleine Gruppe von Leuten inmitten eines recht großen, nackten Raumes. Ich hatte kalte Füße und wünschte, ich hätte mir Wollsocken und feste Schuhe angezogen, anstatt in Sandalen zu gehen.
Fritz bat jeden von uns zu sagen, wie wir uns in dem Raum fühlten. Allen war irgendwie kalt. Eine Frau meinte, daß wir in ihre Wohnung umziehen könnten. Fritz fragte uns, wie wir das fänden, aber wir wollten nicht.
Das ist alles, was ich heute dazu schreiben will. Zwei Jahre später kommt mir das alles schon so weit weg vor, und jetzt sitze ich im Gestalt-Institut von Kanada, Lake Cowichan, British Columbia.
Bei der Arbeit mit Fritz in San Franzisko kam ich mehr und mehr durcheinander. Er wußte natürlich, was er da tat und erzielte gute Ergebnisse. Aber wie zum Teufel machte er das?
Jetzt weiß ich es, und ich vermisse die Verwirrung. Manchmal, wenn ich tue, was er tat, kommt sie zurück, obwohl sie auch anders ist, denn jetzt bin ich es ja. In diesen Momenten geht es mir sehr, sehr gut.
Einmal erklärte ich Fritz, warum ich etwas, wozu er jeden von uns der Reihe nach aufgefordert hatte, nicht tun wollte. Doch dann dachte ich, daß es vielleicht einen Wert haben könnte, der mir nicht klar war, und ich fragte ihn: »Willst du, daß ich es trotzdem mache?« Er sagte nichts. Aber nach Art der Indianer sagte er damit gleichzeitig alles. Er machte nicht einmal die Andeutung einer Aussage. Es war meine Entscheidung.
Ein anderes Mal, als ich mich auf den heißen Stuhl setzen wollte, fiel mir auf, daß auf dem Stuhl eine Mappe mit Manuskripten lag. Ich sagte: »Soll ich mich da draufsetzen, oder soll ich die Mappe wegnehmen?« Er sagte: »Du fragst mich.«
Beide Male mußte ich selbst entscheiden. Jetzt frage ich nicht mehr soviel. Das gibt mir einen Teil meiner Kraft zurück.
Ein Freund von mir, der in der Mittelstufe unterrichtet, brachte seinen Schülern bei, nicht mehr zu sagen: »Kann ich mir meinen Aufsatz bei Ihnen abholen?«, sondern: »Ich komme nach vorne und nehme mir meinen Aufsatz.« Die ganze Klasse lebte auf.
Als ich klein war, hatte ich ein Bild von der Welt, in dem die Leute vom Globus abstanden wie Haare von einem Kopf, und jeder verbeugte sich vor einem anderen. Jeder. Keiner tat das, was er wollte. In einer solchen Welt war jeder außen vor. Das war keine Welt für mich. In meiner Vorstellung war es ein tiefes Schwarz, durchzogen von brennenden Funken und Feuer. In dieser Welt wollte ich nicht leben, aber ich mußte.
Wenn ich sage »Bitte, darf ich?«, dann denke ich vielleicht, daß ich mich damenhaft und souverän verhalte. Aber gleichzeitig fühle ich mich unterlegen, schwach, bittend und auf die Gnade des anderen angewiesen. Der andere hat mein Leben in der Hand. Indem ich mich vor dir verbeuge, verliere ich mein Gefühl für mich selbst. Wenn ich es hingegen einfach tue (ohne deshalb unhöflich zu sein), fühle ich mich stark. Meine Kraft ist in mir. Wo sonst sollte meine Kraft sein?
Natürlich kann es sein, daß ich rausgeschmissen werde.
Fritz machte eine Vorführung in einem High School Auditorium. Jemand stand auf und gab die üblichen Hinweise über Brandschutzvorschriften, daß man nicht rauchen sollte, usw. Nach der Vorführung wurde Fritz, der wie immer die ganze Zeit über geraucht hatte, von einer jungen Frau gefragt: »Welches Recht hast du, einfach weiterzurauchen, während wir hier schmachten müssen?«
Fritz meinte: »Ich habe kein Recht es zu tun, und ich habe kein Recht, es nicht zu tun. Ich tue es einfach.«
Die junge Frau: »Aber stell dir vor, du wirst rausgeschmissen.«
Fritz: »Dann werde ich rausgeschmissen.«
Eine Horrorvision! All diese Leute sehen, wie ich rausgeschmissen werde. Ich habe nie ganz verstanden, was Introjektion oder Projektion bedeuten, also irre ich mich vielleicht, aber es kommt mir vor, als hätte ich die Vorstellung introjiziert, daß es schlecht ist, rausgeschmissen zu werden, und dann projiziere ich diese Vorstellung auf andere. Denn natürlich weiß ich nicht, wie viele der anwesenden Leute mich wirklich so betrachtet hätten, und wie viele mich dafür beneidet hätten, daß ich einfach getan hätte, was ich tun wollte – ganz abgesehen von den vielen Möglichkeiten, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe. Wenn ich in mir selbst ruhe, spielen die anderen keine Rolle.
Als ich jung war, wußte ich das. Meine Tante Alice hatte ein Haus am Strand. Für mich war dieser Strand ein magischer Ort. Der Wind wehte, die Sonne schien, oder die Wolken jagten über den Himmel, und die Brandung dröhnte in einem alles durchdringenden Rhythmus. Leuchtend weiße Muscheln. Golden schimmernde Muscheln. Ein kilometerlanger weißer Strand. Ständig wandernde Sanddünen. Riedgras. Rotgetupfte Stare. Winzige Puffottern. Hier und da ein Blaureiher auf einem Holunderbusch. Alles sang. Auch ich, selbst wenn ich keinen Laut von mir gab. Agito ergo sum.
Einmal im Sommer, ich war vierzehn, ließ Tante Alice mich mit einem jungen Mann allein. Er war sechsundzwanzig. Er war mir unsympathisch. Er war ein Schmarotzer, eine Schlange. Er meinte, »Mrs. B.« hätte ihm gesagt, daß ich für ihn kochen würde, und das hörte sich für mich irgendwie glaubwürdig an. Aber ich wollte nicht für ihn kochen, also sagte ich ihm das. Wenn ich für ihn kochen würde, wäre all meine Heiterkeit dahin, und er konnte sich ja auch selbst was kochen. Aber er hörte nicht auf, mich damit zu nerven. Ich wollte nicht. Vielleicht würde Tante Alice mich deswegen rausschmeißen und nach Hause schicken, aber wenn ich für Ruddy kochte obwohl ich ihn haßte, obwohl ich es haßte zu kochen, dann wäre ich haßerfüllt und könnte jetzt den Strand nicht genießen. Aber ich freute mich jetzt am Anblick des Strandes, und diese Freude konnte mir niemand nehmen.
Jetzt geht es mir ähnlich. Ich liebe Lake Cowichan, und wenn ich nicht bei mir bleibe, kann ich ihn nicht lieben, und dann es ist in Ordnung, wenn ich rausgeschmissen werde.
Ich habe wieder dieses seltsame Gefühl. Ich weiß nicht, was es heißt, »bei mir zu bleiben«.
Letzte Woche in Kalifornien habe ich etwas geschrieben, das vielleicht ganz gut hierher paßt:
Bevor ich mich heute morgen an die Schreibmaschine setzte, ging mir so viel durch den Kopf. Jetzt sitze ich vor der Schreibmaschine und nichts passiert.
Ich sitze auf einer Veranda und schaue durch das Fenster ins Haus. Der Garten hinter mir spiegelt sich im Fenster. Da, wo der Schatten meines Körpers das reflektierte Bild unterbricht, sehe ich einen Tisch – einen halben Tisch. Er endet genau da, wo auch mein eigenes Spiegelbild endet, und geht in eine Wiese mit Pflanzen und Bäumen über. Dazwischen hier und da ein Tischbein, ein Büfett oder eine Wand. Ich mag dieses Durcheinander. Nichts Festes. Keine klare Trennung zwischen »drinnen« und »draußen«.
»Ich bin so frustriert von dem Versuch, deutlich zu machen, daß Gestalttherapie nicht aus Regeln besteht«, meinte Fritz eines morgens in einer Gruppe am Lake Cowichan.
»Er ist neu in dem Job, aber er macht es ganz gut.« Ich lese diesen Satz und achte darauf, wie er sich anhört. Ich ersetze das aber durch ein und. »Er ist neu in dem Job, und er macht es ganz gut.« Ich lese diesen Satz, erfasse ihn – es ist nichts. Wenn ich es immer wieder einmal tue, dann wird es zu einem Teil von mir. Tue ich es hingegen immer, so daß ich gleichsam eine Regel befolge, dann wird es wieder zu nichts.
Nimm das, was gerade zur Hand ist.
Ein junger Mann setzte sich auf den...