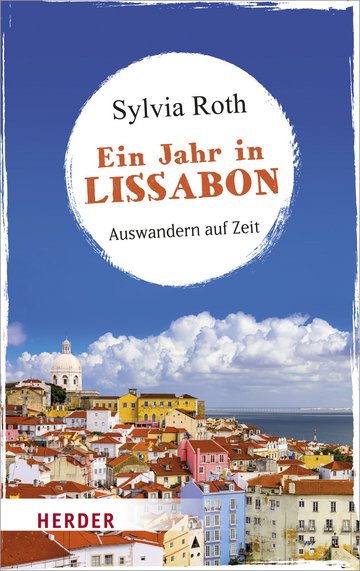Setembro
ICH HATTE VIEL SORGFALT DARAUF VERWENDET, meine Koffer zu packen. Nicht nur mein grünes Sommerkleid und meine Sandalen waren ins Gepäck gekrochen, sondern auch ein paar warme Strickpullover und die Stiefel für den Winter. Ein Regenschirm gesellte sich zur Reiseversicherung, und mein Fotoalbum schlüpfte hinterher – unverhofft aufkeimendem Heimweh wollte ich mit durchblätterten Erinnerungen begegnen. Neben Fernando Pessoas „Buch der Unruhe“ begleitete mich ein Band über die großen portugiesischen Seefahrer, weil sich alles so aufregend anfühlte, als würde ich die nächsten zwölf Monate in ihrem abenteuerlichen Bugwasser schippern. Selbstverständlich reiste auch mein blau-weiß gestreifter Bikini mit, denn ich wusste: Das Meer ist nah. Und ganz zuletzt, ehe die Kofferschnallen zuschnappten, fügte ich den Straßenplan meiner neuen Stadt wie einen verheißungsvollen Kompass hinzu. Ja, in der Tat, ich hatte so vorausschauend gepackt, wie man es eben tun sollte, wenn man ein Jahr lang in die Fremde geht. Nur eines hatte ich vergessen: Ich hatte vergessen, Portugiesisch zu lernen.
Vielleicht hatte ich es auch einfach beharrlich verdrängt, Ausreden gab es schließlich genug. Mal stand mir ein Mangel an Zeit im Weg, mal ein Mangel an Disziplin. Immer, wenn mich meine Kollegen vor der Abreise fragten, ob ich denn schon Portugiesisch sprechen könne, verneinte ich mit leichtfertiger Geste. Das würde ich mir dann vor Ort draufschaffen, entgegnete ich und schickte dem erschrockenen „Mutig!“ meines Gegenübers noch ein neckisches Aperçu hinterher: Es gebe doch nichts Schöneres, als aufzubrechen, ohne sich vorher auszukennen. Vasco da Gama habe vor seiner Abreise ja auch nicht gewusst, was „Entdeckung“ in Sanskrit heißt.
Und nun, einen Tag nach meiner Ankunft in Lissabon, sitze ich mit ein paar italienischen Erasmus-Studenten in einem kleinen Zimmer einer Sprachschule nahe des Praça do Rossio und versuche, zu verstehen. „Percebes?“, fragt mich der Lehrer, und das Wort kommt in der Aussprache ganz und gar dreist daher, ohne Vokale, so, als hätte es polnische Vorfahren. „Prsbsch?“, wiederholt er, weil ich nicht reagiere. „Verstehst du?“ Nein, ich verstehe nicht. Denn das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was da in meinem Buch steht. Da steht: p-e-r-c-e-b-e-r, Infinitiv für verstehen, wahrnehmen, erkennen. Und nicht prsbr. Ich schüttle den Kopf. „Estou confusa“, antworte ich, ich bin verwirrt. „Schtou“ korrigiert mich der Lehrer mit demonstrativ ausladender Bewegung der Kinnlade, „schtooouuuu“, „schtou cönfüsä“.
So ist das also. Die Portugiesen betrachten die Sprache als Mahlzeit – und deshalb reden sie mit vollem Mund. Sie kauen beim Sprechen. Sie essen die Vokale und spucken sie als Konsonanten wieder aus. Sie mauscheln stattliche, stolze lange Worte zu einem verworrenen Knäuel zusammen, der phonetisch auf einen einzigen Laut hinausläuft: „schsch“. Und wenn sie sich doch entschließen, einen Vokal zu verwenden, dann nur mit zugehaltener Nase. Meu Deus, Verzeihung, meu Deusch, das kann ja heiter werden.
Das Erste, was ich nach diesen vier Stunden Portugiesischunterricht mache, ist, zu flüchten. Ich stürze mich ins Gewirr schmaler und schmalster Gassen, streife ziellos nach rechts und nach links – und hadere: mit der Angst vor meiner eigenen Courage und den Fragen, die unerbittlich zu bohren beginnen. Was hatte ich mir nur dabei gedacht, meine Stelle zu kündigen, meine Wohnung aufzulösen und meine Freunde zu verlassen, nur, um einem Bedürfnis nach „Auszeit“ nachzugeben, das mir jetzt mehr als zweifelhaft erscheint? Was war so verlockend daran gewesen, ein einjähriges Kulturstipendium in Lissabon gegen mein Leben in Deutschland einzutauschen? Und woher, um Gottes Willen, hatte ich die Chuzpe genommen, zu meinen, ich könne all dies ohne Portugiesischkenntnisse tun? Was – außer Chaos – erhoffte ich mir von diesem unbedachten Seitensprung? Ich laufe und hadere, hadere und laufe, vorbei an Menschen und Hunden, Schaufenstern und Parkbänken, Straßenbahnschienen und Bushaltestellen. Bis ich endlich stehen bleibe, weil mir ein Duft in die Nase steigt. Ein Duft, der mich daran erinnert, dass es ein geheimes Gesetz gibt, das überall auf der Welt funktioniert: Wenn man verloren ist, kann man sich wiederfinden. Dort, wo es warm ist und wo es nach Essen riecht. Nach frischem Gebäck etwa. In Lissabon – so viel hatte ich bereits von dieser Stadt begriffen – tut es das alle zehn Meter, denn gefühlt alle zehn Meter gibt es eine Pastelaria. Eine Pastelaria in Portugal ist weder eine Bäckerei noch eine Konditorei. Sie ist ein Lebensort. Ein Ort, an dem man sich trifft und sich unterhält. Ein Ort, an dem man morgens kurz die Theke streift, um einen Kaffee zu inhalieren, ehe man zur Arbeit geht. An dem man mittags ein rustikales Essen zu sich nehmen kann, einen „prato do dia“. Und ein Ort, an dem man abends noch schnell ein paar „salgados“, ein paar salzige Kleinigkeiten, futtert, ehe man sich auf den Weg ins Kino macht.
Die meisten Pastelarias in Lissabon sind unprätentiös, sie haben keinen Stil und trotzdem unendlich viel Charme. Die Wände sind gekachelt oder auch nicht, die Theken verchromt und verglast, die Stühle und Tische aus Plastik oder Metall oder eben … eben irgendwie so, dass es sich gut sauber machen lässt. Wie bei einem Gebrauchsgegenstand ist Funktionalität von größter Bedeutung. Die eigentliche Einrichtung der Pastelarias ist das Gebäck, das sich in den Vitrinen befindet – und die Kellner, die dieses Gebäck verwalten. Sie sind wach und unglaublich schnell. Jede Bewegung ist gefüllt mit Effizienz, jedes Geschirrklappern ergibt Sinn. Mit sicherer Hand werden Unterteller geschichtet und Heerscharen von Tassen in die richtige Position gerückt. Die Zubereitung eines Kaffees ist von unübertroffen lakonischer Routine: Kaffee zapfen, Unterteller auf Theke, Tasse auf Unterteller, Löffel und Zucker dazu, servieren. Die Kellner arbeiten nicht, sie regieren, sie sind Herrscher eines unaufhörlich rotierenden kinetischen Kunstwerks.
Nun also, nachdem ich Gasse um Gasse hinter mir gelassen habe und endlich stehen geblieben bin, folge ich dem Duft in meiner Nase: Ich betrete eines dieser unaufhörlich rotierenden Kunstwerke, eines, das „Fabrico próprio“ auf seinem Namensschild verzeichnet hat, was auf eigene Herstellung verweist und deshalb besonders gelungenes Backwerk verspricht. Tatsächlich birgt die Vitrine ein Schlaraffenland, über das ich zärtlich meinen Blick schweifen lasse. Minutenlang. Dann hole ich Luft und beginne zu bestellen – mit dem Zeigefinger der rechten Hand. Ich bestelle einen Bolo de Arroz, eine Tarte de Amêndoa, ein Pastel de Nata, eine Tarte de Maçã und ein Mil Folhas. Zunächst schmeckt es nach süßem Reis, aber irgendwie auch nach Biskuit, dann nach Mandeln, nach Vanillepudding, nach Apfel und schließlich nach Blätterteig.
Das erste Stück beruhigt mich, das zweite macht mich glücklich. Beim dritten fühle ich mich ausgelassen, und ab dem vierten ist mir schlecht. Ich esse trotzdem weiter, denn mir scheint, ich habe eine ausgesprochen schmackhafte Form der Einbürgerung entdeckt. Ich gönne mir einen Bratapfel, weil es mich überrascht, so etwas Winterliches mitten im Spätsommer in einer portugiesischen Bäckerei zu finden. Und danach probiere ich noch zwei Sorten Kekse: die eine mit roter Marmelade in der Mitte und die andere mit Schokoladenkuvertüre. Zum Schluss soll es etwas Schlichtes, Unaufregendes, den Magen Beruhigendes sein, ein Pão de Leite, ein Milchbrötchen, das hier in Lissabon nicht rund, sondern in die Länge gezogen und wie eine Barke geformt ist. Und da passiert etwas, was mich zutiefst bewegt. Weil es so groß ist, schneidet der Kellner dieses Gebäckstück einmal in der Mitte durch, ehe er den Teller über die Theke schiebt. Es ist nur eine kleine Geste, doch hier in der Fremde erscheint sie mir wie ein unendlich großer Akt mütterlicher Fürsorge: Ein unbekannter Mensch teilt den Kuchen für mich, damit ich ihn leichter genießen kann. In diesem unscheinbaren Vorgang, der sich irgendwo in einer ebenso unscheinbaren Pastelaria nahe des Hospital dos Capuchos vollzieht, finde ich mein erstes Stück portugiesische Heimat. „Obrigada“, lächle ich dem Kellner zu, bevor ich mir das Pão de Leite in den Mund schiebe, danke schön. Ich glaube, ich bin soeben ein klitzekleines bisschen angekommen. Und deshalb, so glaube ich, kann es jetzt losgehen.
✽✽✽
Es war vor drei Jahren gewesen, als ich mich rettungslos verliebt hatte. Ich war zu einer viertägigen Kurzreise nach Lissabon geflogen – und wollte nicht mehr weg. Weil mich alles, was ich in dieser Stadt sah und erlebte, unmittelbar begeisterte: die Papiertischdecken, die bereitgelegt wurden, als ich mein Mittagessen aß, das Surren der Kaffeemaschinen, das aus den Läden in die Straßen drang, die Schiffshupen, die ich vom Tejo hörte. Ich verliebte mich Hals über Kopf in die beiden alten Herren, die auf einer Parkbank ihr Nickerchen hielten, in die Frau, die ein Holzkistchen mit einem Kanarienvogel spazieren trug, in den Schuhputzer, der sein Werkzeug ordnete, in den Metzger, der ein komplettes Spanferkel über die Straße wuchtete, in die Katze, die von ihrem Frauchen an der Schnur im Jutesack aus dem Fenster auf die Straße hinabgelassen wurde, und in den Kellner, der mit weißem Hemd und schwarzer Hose in der Tür stand, um eine Zigarette zu rauchen. Ich war von einer Sekunde auf die andere verschossen in die Poesie dieser Stadt und fühlte mich, während ich durch all diese Momentaufnahmen hindurchging, wie in einem Film, der gemeinsam von Fellini, Bergman und Kaurismäki gedreht wurde. Nur unter einer Bedingung...