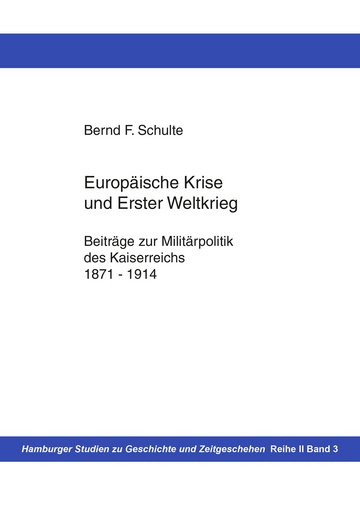EINLEITUNG
Der Diplomat Harry Graf Kessler notierte in der Rückschau unter dem 21. November 1918 in seinem Tagebuch:
„Der Krieg war schließlich eine ungeheure Spekulation, deren Mißlingen alles andere mitriß; der größte Krach aller Zeiten.“1
Auch der enge Vertraute Bethmann Hollwegs, Kurt Riezler, reflektierte bereits im Mai 1915 den spielhaften Charakter des deutschen diplomatisch-politischen Kalküls bei Ausbruch des Krieges. Unter dem unmittelbaren Eindruck des Mißerfolgs der deutschen Armee an der Marne unterstreicht er, wie umfassend alles auf eine Karte gesetzt wurde; was militärisch bedeutete, daß sich der Krieg mit dem deutschen Sieg über Frankreich entschiede. Riezler notierte in seinem Tagebuch unter dem 25.5.1915:
„Die ganze ursprüngliche Rechnung ist durch die Schlacht an der Marne ins Wanken geraten. Schließlich kann sich für die Entstehung dieses Krieges Bethmann auf die Not der Konstellation berufen, die er übernahm, und auf die Antwort, die Moltke Anfang Juli gab. Er sagte eben ja, wir würden es schaffen.“2
Wie es im einzelnen zum Kriege kam, soll hier nicht der Gegenstand der Analyse sein. Diese Problematik allein erfordert eine eigene detaillierte Analyse. Doch kann nicht übersehen werden, daß diese Frage eine bis auf den heutigen Tag andauernde Kontroverse innerhalb vor allem der deutschen, aber auch der internationalen Geschichtswissenschaft entfacht hat.
1. Zur Fischer Kontroverse der sechziger Jahre
Die neueren Tendenzen der Diskussion um die sogenannte „Kriegsschuld“ – insbesondere des Deutschen Reiches am Ersten Weltkrieg – sollen hier berührt werden. Die „Kriegsschulddebatte“, die in der Fischer Kontroverse ihre Fortsetzung erlebte und die in letzter Zeit über außen- und innenpolitische wie sozial- und strukturgeschichtliche Aspekte hinaus auch die militärgeschichtliche Seite des Problems einbezieht, entwickelt sich zunehmend unter dem Einfluß des weithin proklamierten komparatistischen Ansatzes zu einer übergreifenden Behandlung dieses tiefen Einschnittes in der neueren europäischen Geschichte.
Es erscheint von Bedeutung, daß erst jüngst die Rolle auch der deutschen Armee vor und im Ersten Weltkrieg erneut und unter verschiedenen Gesichtspunkten in das Blickfeld der Forschung geriet und damit ein Strang der Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Ursachen wieder aufgenommen wurde, der durch Gerhard Ritters Werk „Staatskunst und Kriegshandwerk“ bereits abgeschlossen schien3. Obwohl Ritter 1959 betont hatte, daß eine weiterführende Arbeit an dem Heeresproblem des Kaiserreiches kaum mehr aussichtsreich erscheine, da die Aktenbestände der preußisch-deutschen Armee (1867-1918/45) mit dem Reichs- oder Heeresarchiv in Potsdam (im April 1945) durch englische Brandbomben vernichtet worden seien, stellte sich dennoch Anfang der siebziger Jahre heraus, daß durchaus neue Einsichten in die Vorstellungen der obersten Militärbehörden, vor allem an Hand der Aktenbestände der Bundesstaaten des Deutschen Reiches (außer Preußen), nämlich Bayerns, Württembergs, Sachsens und Badens, erzielbar sind4. Darüber hinaus war es überfällig, die Ergebnisse der Diskussion um die Politik des Kaiserreichs vor und im Ersten Weltkrieg, die bereits die militärgeschichtliche Behandlung der Reichswehrthematik und vor allem der Wehrmacht befruchtet hatte, nun auch für eine Durchleuchtung der Militärpolitik des wilhelminischen Reiches zu nutzen.
Da die Arbeiten Fritz Fischers5 – im Gegensatz zu Gerhard Ritters großem Alterswerk – die Totalität der gesellschaftlichen Kräfte und Gruppierungen einbezogen, erschien ein nicht mehr nur ausschließlich kriegs- oder organisationsgeschichtlicher, sondern vor allem der Sozialgeschichte verpflichteter Ansatz überfällig. Es ist zu bedauern, daß vor allem auf dem Gebiet der Militärgeschichte heute zunehmend derartige Arbeiten außerhalb der offiziösen Geschichtswissenschaft erscheinen. Dies trifft interessanterweise vor allem für die Epoche zwischen 1871 und 1918 zu6. Diese Entwicklung hat ihre Ursache zum einen in der Tendenzwende innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft weg von einer progressiven Interpretation (Theorie-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte) zurück zu der traditionellen, neubelebten Diplomatiegeschichte alter Prägung in einer „neuen politischen Geschichte“7, unter Verwendung modisch gewordener Versatzstücke aus der Politikwissenschaft („Polykratielehre“), Mitte der siebziger Jahre, und andererseits in der Tendenz der offiziösen westdeutschen Militärgeschichtsschreibung (vor allem zum Ersten Weltkrieg und seiner Vorgeschichte), traditionelle Vorstellungen zu konservieren oder doch zumindest nur sehr zögernd abweichende Forschungsergebnisse zu registrieren.
Die mit Fischers „Griff nach der Weltmacht“ 1961 eingeleitete und mit weiteren Büchern 1965 und 1969 weitergeführte Diskussion, die inzwischen in einer Fülle von Publikationen aufgenommen und vertieft wurde, hat zu einer komplexeren Kenntnis vor allem der struktur- und sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen des Kaiserreichs geführt und gleichzeitig belebend auf die englisch- und französischsprachige Geschichtswissenschaft ausgestrahlt8.
2. Vom Primat der Innenpolitik zur Strukturkrise des Reiches
So ist festzuhalten, daß einen wichtigen Einfluß auf die Rolle des Deutschen Reiches im internationalen System, der seine besondere Explosivität und Energie verursachende späte Wandel des Kaiserreichs vom Agrar- zum Industriestaat ausmachte9, wenngleich auch die westdeutsche Forschung sich überraschenderweise auf die Defekte des deutschen Regierungssystems konzentrierte und dessen vermeintliche grundsätzliche strukturelle Schwächen betonte10. Wenn es sich auch zeigt, daß eine angeblich fossile Reichsverfassung als Bremse jeglicher Evolutionstendenzen wirkte, so erscheint es doch überzeichnet, mit Buchheim von der „anachronistisch gewordenen Verfassung“ des wilhelminischen Reiches als Ursache seines Untergangs zu sprechen11. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, daß die kritische Geschichtswissenschaft den Akzent auf das innenpolitische Kräftespiel und dessen Einfluß in den „pressure groups“ auf die informellen Entscheidungsprozesse der Reichsleitung legt. Dieser Ansatz findet bereits mit Berghahns für den Sektor der Flottenpolitik unter militärgeschichtlichem, rüstungspolitischem und organisationsgeschichtlichem Blickwinkel wegweisender Arbeit zum „Tirpitz-Plan“ (1971) einen profilierten Vertreter, der das nachbismarckische Reich unter dem Primat der Innenpolitik mit der These von der latenten Krise des Reiches untersucht12. Beeinflußt von der älteren verfassungsgeschichtlichen Linie der deutschen Geschichtswissenschaft wendet Wolfgang J. Mommsen den Ansatz eines Primats der Innenpolitik auf die übergreifende Problematik des Kriegsausbruches 1914 an. Er dringt unter Abgrenzung gegen die These vom Angriffs- oder Hegemonialkrieg des kaiserlichen Deutschland und des präventiven Ausweges der wilhelminischen Krisengesellschaft in einer Flucht nach vorn und in Anlehnung an ältere, in der Tradition diplomatiegeschichtlicher Ansätze stehender Deutungsversuche, zu einer funktional-strukturgeschichtlichen Analyse des gesellschaftlichen und verfassungspolitischen Bezugsrahmens vor13. Dieser suptile und zugleich komplexe Interpretationsansatz greift mit der These vom „polykratischen Chaos“ im Kaiserreich in die Diskussion um die Auslösung des Ersten Weltkrieges ein.
Berghahn behauptet, die „Krise des Deutschen Reiches“ sei aus den strukturellen Schwächen des Verfassungs- und Herrschaftssystems ableitbar. Er verbindet das innenpolitische Dilemma der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts angesichts von Revolutionsdrohung (bzw. Staatsstreichdrohung) und zunehmender Demokratisierung (infolge der 2. Industrialisierungswelle 1870-74/1894-1913) ursächlich mit der zwischen 1891 und 1898 durch Wilhelm II., Bülow und Tirpitz konzipierten und eingeleiteten Flottenpolitik14. Mommsen dagegen, stärker auf struktur- bzw. verfassungsgeschichtlichen Kriterien basierend, gelangt zu einem Bild von geringerer Dynamik. Er sieht das von seinem Aufbau her „relativ hohe Immobilität“ aufweisende bismarckische System weiterleben. Indem Mommsen die in ihrer Zuordnung angelegte Konkurrenz der Ressorts und Institutionen herausarbeitet, gelangt er zu dem Schluß, am Anfang der neunziger Jahre sei das Reich ein „nahezu unregierbares Gebilde“ gewesen15.
Angewandt auf das internationale System zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gelangt diese These bei Klaus Hildebrand, der die Vorstellung Henry Kissengers vom europäischen Staatensystem – analog der Pentarchie zur Zeit Metternichs – aufnimmt, zu der Frage: Welche Vorstellungen, Bewahren oder Verändern des internationalen status quo, in der Führungselite des Kaiserreichs vorherrschten16. Auch Hildebrand stellt das Kriterium der „permanenten Krise des Reiches“ in den Vordergrund seiner Überlegungen. Aufbauend auf seinen im Wesentlichen diplomatiegeschichtlichen (wenn auch um die politikwissenschaftliche Begrifflichkeit weiterentwickelten) Kriterien sieht er zurecht den Ursprung der Problematik des Wandels der europäischen Staatengruppe in der weltpolitischen Offensive des Deutschen Reiches Anfang der neunziger Jahre und setzt er entsprechend seinem erkenntnisleitenden Interesse den Akzent eher auf dem Sektor der außenpolitischen Entscheidungsfindung, der in seiner Sicht den Ausdruck des innenpolitischen Wirkungszusammenhanges darstelle17. Anders...