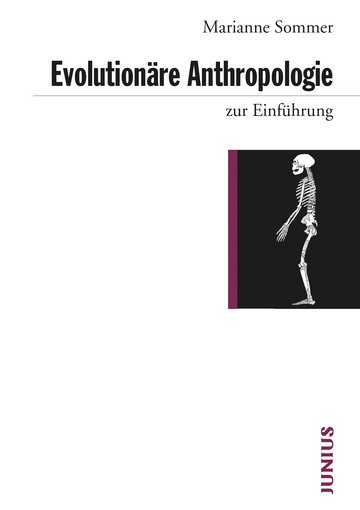Einleitung
Unter Evolutionärer Anthropologie oder dem häufiger anzutreffenden englischen Begriff evolutionary anthropology wird heute zumeist ein integratives Forschungsfeld verstanden, das die biologische und kulturelle Vielfalt und Geschichte der Menschheit aus evolutionstheoretischer Perspektive untersucht. Es handelt sich dabei um syn- und diachrone vergleichende Forschung zu den Unterschieden in Genen, kognitiven Fähigkeiten, Sozialsystemen und Kulturen der Primaten. Im Mittelpunkt steht die Evolutionsgeschichte, also die Untersuchung der fossilen und archäologischen Hinterlassenschaften (einschließlich fossiler DNA) der Hominiden (einschließlich der Anthropoiden) sowie der gegenwärtigen genetischen Diversität. Beteiligte Fächer sind die biologische Anthropologie, Paläoanthropologie, evolutionäre Genetik, Primatologie und Verhaltensökologie, die Linguistik, die Psychologie und die Kognitionswissenschaften sowie einige Ansätze der kulturellen Anthropologie. In meiner historischen Beschreibung der evolutionären Anthropologie betrachte ich die integrativen und evolutionsgeschichtlichen Aspekte als zentral. Der Fokus liegt auf den Versuchen einer mehr oder weniger gesamtheitlichen Betrachtung der Evolutionsgeschichte des Menschen und weniger auf Detailstudien, die zum Beispiel selektionistische Ansätze auf heutige Primaten anwenden, etwa in einer Untersuchung zur Spermienkonkurrenz in Abhängigkeit von der Polyandrie (›Vielmännerei‹).
Die Konstellation der Disziplinen, die sich an der evolutionären Betrachtung des Menschen beteiligen, hat sich im Laufe der Geschichte verändert, und das Gravitationszentrum hat sich verschoben, nicht ohne Auseinandersetzungen um die Definitionshoheit. Dies erstaunt kaum, geht es doch um nichts weniger als die Fragen, ›wer wir sind‹ und ›woher wir kommen‹, und darum, was mit diesem Wir bezeichnet werden soll. Damit ist auch klar, dass das Wissen der evolutionären Anthropologie im Austausch mit dem Alltags- und mit dem politisch angewandten Wissen einer Zeit steht. In diesem Einführungsband behandle ich solche Konstellationen für drei größere Zeiträume, in denen unterschiedliche Bereiche des Wissens über den Menschen in einer evolutionären Anthropologie integriert wurden beziehungsweise werden: die evolutionären Zugänge zur Geschichte und Vielfalt – aber auch Gegenwart und Zukunft – der Menschheit nach Charles Darwins On the Origin of Species (1859); die Prozesse, die mit dem Aufkommen der Genetik im frühen 20. Jahrhundert begannen und in der Integration unterschiedlicher biologischer Fachbereiche zu einer modernen Synthese gipfelten, deren Kern die Variations-Selektions-Theorie ausmachte; und die Synthesen, die sich aus genetischen Untersuchungen ergaben und die in den 1980er Jahren bei der Erforschung der Evolution des modernen Menschen einen ersten Höhepunkt erreichten. Es handelt sich also um eine wissenschafts- und wissenshistorische Herangehensweise.
Dabei muss die Wirkung der Evolutionstheorie auf das wissenschaftliche Verständnis der biologischen und kulturellen Geschichte der Menschheit und ihrer Vielfalt vor dem Hintergrund vorevolutionärer Konzepte betrachtet werden. Für die frühe evolutionäre Anthropologie sind insbesondere die gegensätzlichen Positionen des Monogenismus und Polygenismus sowie das Bild der Kette der Lebewesen relevant. Sie reichen in der Geschichte weit zurück. Die Genealogie der Menschen wurde im Mittelalter aus der Genesis, also von den Söhnen Noahs, abgeleitet. Im Zuge der frühneuzeitlichen Begegnungen mit dem nicht-christlichen Westafrika und den ›Heiden‹ der Neuen Welt wurden die Stämme Japhets, Shems und Hams mit den BewohnerInnen der Erdteile Europa, Asien und Afrika identifiziert. Die jüngste der Begegnungen, jene mit den Amerindern, führte zur Herausbildung polygenistischer Theorien, die der dominanten Annahme des Ursprungs aller Menschen in einer einzigen Schöpfung widersprachen. Isaac La Peyrère wagte entgegen der Annahme von deren nachsintflutlicher Schöpfung aber die These, dass es sich bei den Amerindern um die Abkömmlinge aus einem ersten Schöpfungsakt Gottes vor der Erschaffung Adams und Evas handle – um Präadamiten (Praeadamitae 1655).
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts fand das platonisch-aristotelische Prinzip der scala naturae Anwendung – eine Stufenleiter, in welche die menschlichen Varietäten in einer linearen Reihe von der vermeintlich niedrigsten bis zur höchsten eingeordnet wurden. Zusammen mit dem Bild der Kette der Lebewesen erlaubte es dieses Prinzip, die Einheit der Menschheit zu wahren und gleichzeitig deren Vielfalt gerecht zu werden. Denn inspiriert von der Schöpfungsgeschichte erklärten die Naturhistoriker des 18. Jahrhunderts den Wandel in der Flora und Fauna im Laufe der Erdgeschichte meist räumlich-geografisch. Es wurde angenommen, dass sich auch die Menschen von einem Zentrum aus über den Erdball verteilt hätten, wodurch sie in neue Lebensumstände gerieten, an welche sie sich im Laufe der Zeit durch morphologische Veränderungen und neue Verhaltensweisen anpassten. Damit erhielt die statische Stufenleiter in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts also eine gewisse Dynamik. Diese Entwicklungen wurden jedoch eher als Degeneration von einem Idealtypus denn als Fortschritt gedeutet und blieben im Rahmen der Artenkonstanz. Modelle der Stufenleiter mit echter Artentransformation wurden erst Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt.
Insbesondere Jean-Baptiste Lamarck und Étienne Geoffroy Saint-Hilaire am Muséum d’Histoire Naturelle in Paris verfochten transformistische Theorien und leiteten den Menschen von einer äffischen Vorstufe ab. Lamarck beschrieb in der Philosophie zoologique (1809) die evolutionäre Höherentwicklung von der Infusorie zum Menschen. Zur gleichen Zeit begannen archäologische Funde und vereinzelt menschliche Fossilien auf ein hohes Alter der Menschheit hinzudeuten. Lamarcks Gegenspieler am Muséum, der einflussreiche Paläontologe Georges Cuvier, war jedoch nicht überzeugt von der organischen Transformation und auch nicht von antediluvialen (vorsintflutlichen) Zeugnissen menschlicher Existenz. Beim wissenschaftlichen Establishment fanden die transformistischen Vorstellungen kaum Anklang. Dennoch lebte Lamarcks Evolutionstheorie in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts weiter. Besonders die bereits in der Naturphilosophie vorhandenen Aspekte der Vererbung erworbener Eigenschaften, eines inneren Triebs zur Vervollkommnung, der die Organismen die Stufen der natürlichen Leiter hinauftreibt, und die Analogie zwischen Individualentwicklung und Stammesgeschichte bildeten Grundpfeiler der neuen evolutionären Anthropologie (der Begriff Evolution tauchte zuerst in der Embryologie auf).
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war aber auch eine Blütezeit des Polygenismus. Die Erklärungen für ›rassische‹ Unterschiede hatten sich vom Umweltparadigma des 18. Jahrhunderts hin zu einer stärkeren Gewichtung des erblichen Einflusses entwickelt. Dabei war es nicht nur die romantische Vorstellung von der Essenz unterschiedlicher ›Rassen‹, die den Glauben an deren grundlegende Verschiedenartigkeit schürte. Die Hinwendung zur wissenschaftlichen Untersuchung menschlicher Diversität führte zur Etablierung einer Rassenhierarchie, die auf anthropometrischen, insbesondere kraniometrischen, Messdaten beruhte (Sommer 2010a).
Vor diesem Hintergrund wende ich mich im ersten Teil dieses Buchs jenen Bestrebungen zu, die nach dem Durchbruch der Evolutionstheorie in der Folge von Darwins On the Origin of Species (1859) Aspekte der Biologie und Anthropologie, aber auch der ›Soziologie‹ und Psychologie, im Rahmen eines evolutionstheoretischen Zugriffs zu integrieren suchten. Die evolutionistischen Betrachtungen der Menschheit im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren nicht im heutigen Sinne des Wortes darwinistisch. Wie aus Darwins eigenem Werk klar wird, war das Wissen über die Vererbungsprozesse so gering, dass die Frage, wie etwas Neues entstehen kann, weitgehend Gegenstand der Spekulation war. Obwohl Darwin in Origin die natürliche Selektion als zentralen Mechanismus der Evolution postulierte, ging er in seiner Vererbungstheorie davon aus, dass die Veränderungen, die ein Organismus während seines Lebens erfährt, an die Nachkommen weitergegeben würden. Der Glaube an die Vererbung erworbener Eigenschaften blieb auch deshalb ein zentraler Erklärungsversuch, weil die verbreitete Analogisierung von Onto- und Phylogenese eine direkte Verbindung zwischen individueller und stammesgeschichtlicher Entfaltung nahelegte. Eine andere Vorstellung war jene des élan vital, eines inneren Triebs zur Entfaltung, die auch durch die aus dem Fossilienbestand erkennbaren Entwicklungstrends bestätigt schien. Paläontologen beriefen sich zur Erklärung dieser Entwicklungslinien auf die sogenannte Orthogenese: die Vorstellung, dass im ›Keimplasma‹ Evolutionstrends angelegt seien. In dieser Interpretation bedurfte es der Selektion nicht oder nur gerade im negativen Sinn, indem nicht-adaptive Linien aussterben würden. Auch aus den europäischen Funden prähistorischer Kulturen und Knochen wurden Abstammungslinien...