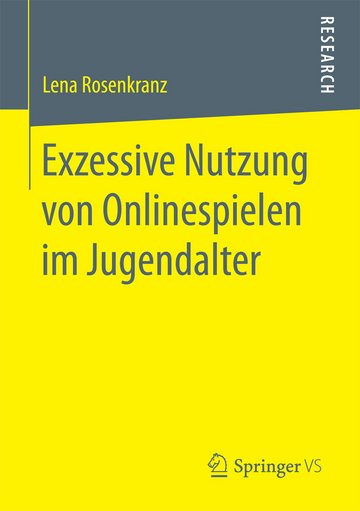| Geleitwort | 5 |
| Inhalt | 7 |
| Tabellenverzeichnis | 12 |
| Abbildungsverzeichnis | 13 |
| Einführende Gedanken | 14 |
| 1. Problemaufriss und Zielsetzung der Arbeit | 16 |
| 1.1. Das Projekt EXIF – Exzessive Internetnutzung in Familien | 18 |
| 1.2. Forschungsfrage und Forschungsdesign | 20 |
| Der Forschungsgegenstand | 23 |
| 2. Problematische Onlinespiele-Nutzung? | 24 |
| 2.1. Die Attraktivität von Onlinespielen im Jugendalter | 25 |
| 2.2. Forschungsarbeiten zur pathologischen Internetnutzung | 29 |
| 2.3. Die subjektive Perspektive auf eine exzessive, problematische oder pathologischeComputernutzung | 32 |
| 2.4. Erklärungsansätze für die Entstehung einer Internetabhängigkeit | 33 |
| 2.4.1. Personenbezogene Eigenschaften | 34 |
| 2.4.2. Medienbezogene Einflussfaktoren | 35 |
| 2.4.3. Das soziale Umfeld – der Einfluss der Familie | 35 |
| 2.5. Zusammenfassung und Ausblick: Problematische Onlinespiele-Nutzung | 37 |
| Theoretische und empirische Bezüge zu Jugend und Individuation | 39 |
| 3. Jugend aus psychologischer, pädagogischer und soziologischer Perspektive | 41 |
| 3.1. Innere Spannungen und die Entdeckung des Neuen | 43 |
| 3.2. Unaufhaltsame und gestaltbare Entwicklungen in der Adoleszenz | 44 |
| 3.2.1. Das Jugendalter als Krise | 46 |
| 3.2.2. Ressourcen zur Bewältigung und alternative Bewältigungsformen | 48 |
| 3.3. Jugend als Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen | 51 |
| 3.4. Zusammenfassung: Jugend | 55 |
| 4Individuation – ein Zusammenspiel von Identitäts- und Beziehungsentwicklung | 57 |
| 4.1. Zum Begriff der Identität und ihrer Bedeutung im Jugendalter | 59 |
| 4.2. Familienbeziehungen und ihre Veränderungen in der Adoleszenz | 62 |
| 4.3. Individuation als interaktionaler Prozess | 66 |
| 4.4. Individuation im Zeichen von Autonomie und Verbundenheit | 69 |
| 4.4.1. Das Streben nach Autonomie und Aushandlungsprozesse | 70 |
| 4.4.2. Verbundenheit | 75 |
| 4.4.3. Autonomie und Verbundenheit | 77 |
| 4.5. Problematische Verläufe des Individuationsprozesses | 80 |
| 4.5.1. Unausgewogenheit von Autonomie und Verbundenheit | 81 |
| 4.5.2. Empirische Hinweise | 84 |
| 4.6. Außerfamiliale Einflussfaktoren auf den Individuationsprozess | 86 |
| 4.7. Zusammenfassung und Ausblick: Individuation und problematische Onlinespiele-Nutzung | 89 |
| Methodik | 91 |
| 5. Qualitative Forschungsprinzipien der Grounded Theory | 92 |
| 5.1. Offenheit, Kommunikation und Prozesshaftigkeit für den Zugang zu einem wenigerforschten Feld | 92 |
| 5.2. Der methodische Fokus und metatheoretische Annahmen der Grounded Theory | 93 |
| 5.3. Methodologische Prinzipien und Verfahrensweisen | 95 |
| 5.3.1. Theoretische Sensibilität und Theoriebezüge | 95 |
| 5.3.2. Kodierprozess und Kategorienbildung | 98 |
| 5.3.3. Theoretisches Sampling | 101 |
| 5.3.4. Methodische Werkzeuge | 102 |
| 6. Vorgehensweise in dieser Forschungsarbeit | 104 |
| 6.1. Entwicklung erster Hypothesen und des Forschungsdesigns | 104 |
| 6.2. Theoriebezüge und theoretische Sensibilität | 106 |
| 6.3. Das Interviewverfahren und die Entwicklung der Leitfäden | 107 |
| 6.4. Interviewerhebungen und Transkription | 111 |
| 6.5. Auswertung | 112 |
| 6.5.1. Kodierprozess und Kategorienbildung | 113 |
| 6.5.2. Offenes Kodieren | 113 |
| 6.5.3. Axiales Kodieren | 114 |
| 6.5.4. Selektives Kodieren | 115 |
| 6.5.5. Theoretisches Sampling und Methode des permanenten Vergleichs | 116 |
| 7. Limitationen der Studie und Methoden zur Gütesicherung | 122 |
| 8. Zusammenfassung: Methodisches Vorgehen | 125 |
| Darstellung der Ergebnisse | 126 |
| 9. Erste Ergebnisebene: Falldarstellungen | 127 |
| 9.1. Falldarstellung – Familie Weber | 129 |
| 9.1.1. Kontaktaufnahme, erste Eindrücke und Interviewsituation | 130 |
| 9.1.2. Beschreibung des Jugendlichen und der Problemwahrnehmung | 131 |
| 9.1.3. Autonomie und Verantwortung | 134 |
| 9.1.4. Verbundenheit und Verantwortung | 142 |
| 9.1.5. Autonomie, Verbundenheit und Verantwortung | 149 |
| 9.1.6. Zusammenfassung | 154 |
| 9.1.7. Das Nachgespräch | 156 |
| 9.2. Falldarstellung – Familie Böhm | 158 |
| 9.2.1. Kontaktaufnahme, erste Eindrücke und Interviewsituation | 159 |
| 9.2.2. Beschreibung des Jugendlichen und der Problemwahrnehmung | 160 |
| 9.2.3. Autonomie und Verantwortung | 162 |
| 9.2.4. Verbundenheit und Verantwortung | 167 |
| 9.2.5. Autonomie, Verbundenheit und Verantwortung | 171 |
| 9.2.6. Zusammenfassung | 174 |
| 9.2.7. Das Nachgespräch | 176 |
| 9.3. Falldarstellung – Familie Franke | 178 |
| 9.3.1. Kontaktaufnahme, erste Eindrücke und Interviewsituation | 179 |
| 9.3.2. Beschreibung des Jugendlichen und der Problemwahrnehmung | 181 |
| 9.3.3. Autonomie und Verantwortung | 182 |
| 9.3.4. Verbundenheit und Verantwortung | 190 |
| 9.3.5. Autonomie, Verbundenheit und Verantwortung | 193 |
| 9.3.6. Zusammenfassung | 194 |
| 9.4. Falldarstellung – Familie Janson | 197 |
| 9.4.1. Kontaktaufnahme, erste Eindrücke und Interviewsituation | 198 |
| 9.4.2. Beschreibung des Jugendlichen und der Problemwahrnehmung | 199 |
| 9.4.3. Autonomie und Verantwortung | 200 |
| 9.4.4. Verbundenheit und Verantwortung | 206 |
| 9.4.5. Autonomie, Verbundenheit und Verantwortung | 208 |
| 9.4.6. Zusammenfassung | 211 |
| 9.4.7. Das Nachgespräch | 213 |
| 9.5. Falldarstellung – Familie Hartmann | 214 |
| 9.5.1. Kontaktaufnahme, erste Eindrücke und Interviewsituation | 215 |
| 9.5.2. Beschreibung des Jugendlichen und der Problemwahrnehmung | 216 |
| 9.5.3. Autonomie und Verantwortung | 218 |
| 9.5.4. Verbundenheit und Verantwortung | 223 |
| 9.5.5. Autonomie, Verbundenheit und Verantwortung | 227 |
| 9.5.6. Zusammenfassung | 230 |
| 10. Zweite Ergebnisebene: Integrative Analyse | 232 |
| 10.1. „Individuation aushandeln“ als Kernkategorie | 232 |
| 10.1.1. Das Individuationsdreieck | 233 |
| 10.1.2. Der interaktionale Charakter und Ausprägungen der Kernkategorie im Kontexteiner problematischen Computernutzung | 235 |
| 10.1.3. Der prozessuale Charakter der Kernkategorie | 238 |
| 10.2. Zum Phänomen exzessive bis pathologische Onlinespiele-Nutzung | 240 |
| 10.3. Soziodemografie und Familienstruktur | 241 |
| 10.4. Einsetzende Individuation als eine ursächliche Bedingung | 243 |
| 10.5. Familiale Interaktionen im Kontext der exzessiven Onlinespiele-Nutzug unterBerücksichtigung der Verbundenheit | 246 |
| 10.5.1. Autonomie | 246 |
| 10.5.2. Verantwortung | 251 |
| 10.6. Langfristige Konsequenzen | 258 |
| 10.7. Fazit | 262 |
| Abschließende Betrachtung | 263 |
| 11. Einbettung der Ergebnisse in bestehende Diskurse | 264 |
| 11.1. Beitrag zur Theorie der Individuation | 264 |
| 11.2. Bezug zum Diskurs Internetabhängigkeit | 266 |
| 11.3. Bezug zu aktuellen erziehungswissenschaftlichen Beobachtungen | 272 |
| 11.4. Anwendbarkeit der Ergebnisse und Forschungsausblick | 273 |
| Danksagung | 276 |
| Literatur | 277 |
| Internetquellen | 300 |