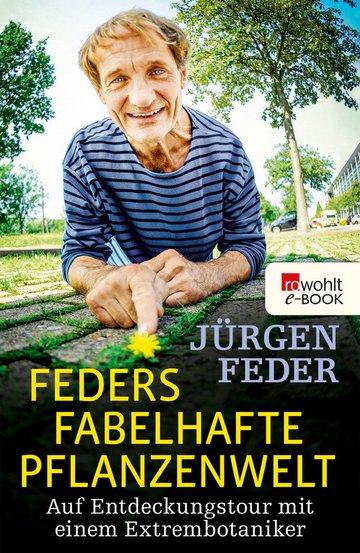2 Direkt vom Hausflur in die Feldflur
Ein Acker fasziniert mich, weil so viele schöne Arten darauf wachsen. Früher dachte ich, Ackerpflanzen schützt man, wenn man sie in Ruhe lässt. Warum nur pflügt der Bauer diese Pflanzen um? Das darf er doch nicht! In den achtziger Jahren beobachtete ich einen Landwirt, der beim Wiesemähen zahlreiche Orchideen umnietete. Das erzürnte mich derart, dass ich sogar beim Landesamt in Hannover vorstellig wurde. «Ich möchte mal was melden», sagte ich aufgebracht. «Ein Bauer hat da Orchideen einfach mit seiner Maschine umgepflügt.» Milde lächelnd gab mir mein Gegenüber, mein späterer Mentor Herr Garve, zu verstehen: «Das ist auch gut so. Würde der Mann nicht mähen, würden viele Arten verschwinden, dann verfilzen Äcker und Wiesen, und alles wächst hoch, nur die stärkeren Konkurrenten würden überleben. Äcker sollten nicht zu tief umgepflügt werden, und sicher sollte man Wiesen nicht fünfmal im Jahr mähen, aber ab und zu ist nicht verkehrt, und Orchideen haben schön geschützte Knollen in der Erde.» Da hatte ich was erfahren: Da bekommen Pflanzen was auf die Mütze, und dennoch entsteht gerade dadurch Artenvielfalt!
Und nicht weniger faszinieren mich Ackergräben. Wie sehen die im März aus? Matschig, kahl, trostlos wie eine Mondlandschaft oder ein Schlachtfeld. Wie soll da was blühen? Doch kommt man drei Monate später wieder – sagenhaft, was sich da alles getan hat. Nicht wiederzuerkennen, rund und gesund schauen die Gräben jetzt aus.
Und dann die Kornfelder mit dem knallroten Klatsch-Mohn und den leuchtend blauen Kornblumen! Ein phänomenaler Farbenkontrast, erst der blassblaue Weizen, der dann blaugrün wird, dann goldgelb, und dazwischen das Königsblau und Picasso-Rot. Deshalb sind Standorte auch so interessant. Wie sehr freue ich mich im Juni, wenn die Kornblume versucht, ein kleines bisschen über das Getreide zu wachsen. Die will ja nur mit dem Kopf über die Halme gucken: «Hallo, hier bin ich!» Andere Ackerpflanzen wiederum ducken sich, obwohl sie Sonnenanbeter sind. Damit sie genug Sonne erhalten, stehen sie nicht mitten im Kornfeld, sondern eher am Rand.
Also, rein in die Schuhe und raus auf die Äcker – und diesmal zu Fuß, dann sieht man die Winzlinge viel genauer. Meine Begegnungen mit Bauern halten sich in Grenzen – mähen sie, dann sind sie in Eile, und ich bin sowieso in Eile. Selten fragt mich einer, was ich auf den Feldern treibe, und ich bin immer froh, wenn man mich in Ruhe lässt, denn so ein Landwirt kann ganz schön argwöhnisch sein. Wenn der jemanden auf seinen Feldern sieht, geht er nur vom Schlechtesten aus: Da will jemand seinen Müll abladen. Als man mir das einmal unterstellte (ich war auf dem Fahrrad unterwegs), antwortete ich: «Guter Mann, wenn ich was tun wollte, was Ihnen nicht gefällt, dann würde ich es nachts machen und nicht jetzt, wo Sie gerade am Pflügen sind. Ich kippe doch nichts vor Ihrer Nase hin. Und wollte ich was von Ihrem Feld mitnehmen, dann würde ich mir auch eine andere Tageszeit aussuchen und nicht mittags um zwölf.» Danach war der Bauer beruhigt.
Ein anderer hatte mal Angst um seine Kühe, genauer gesagt um seinen Bullen. Ich könnte ihn reizen. Klar, wenn mich so ein Bulle sieht, wie ich über seine Weide stapfe, macht er sich bemerkbar: Er schnauft, grunzt und startet Trockenübungen mit seinen Vorderhufen. Er gibt mir zu verstehen: «Hör mal, hier bin ich der König, nicht du, verschwinde!» Aber er fängt niemals an zu rennen, dafür ist ein echter Bulle viel zu faul und schwerfällig.
Eigentlich komme ich mit jedem Bauern zurecht, aber da gab es schon den einen oder anderen, der ziemlich renitent wurde. Einer hatte in der Wesermarsch seinen Hof direkt neben einem Naturschutzgebiet, einem kleinen Waldgebiet, das als solches deklariert wurde, weil dort Reiher nisteten. Eine riesige Brutkolonie. Alles war dort von den Reihern totgekackt – die Kiefern waren hin, die Birken waren hin, alles nur noch tote Äste. Und der ewige Lärm. Der Mann war stocksauer. Zu Recht. Naturschutzgebiete mit Reihern sind heute überflüssig, denn die Reiher haben sich erholt, es gibt wieder genug von ihnen. Andere Vögel gehören wohl auf die Rote Liste, etwa Feldlerche und Kiebitz. Warten wir noch zehn Jahre, wird es kaum noch Feldlerchen geben. Und wann sah ich 2013 eigentlich Kiebitze?
Dieser Bauer war nun über den Naturschutz erbost, und als er mich auf seinem Hof sah, war er noch erboster, hielt er mich doch für einen Naturschützer, was ja nicht falsch war. Nur interessierten mich nicht die Reiher. Barsch fragte er mich, was ich denn hier wolle. Und als er meinen Ausweis sah, der bewies, dass ich für das Land Niedersachsen im Naturschutz arbeitete, zerriss er ihn kurzerhand und trat noch gegen mein Fahrrad und meine Mappe. Nun war ich auf 180 und hätte am liebsten die Polizei gerufen, hätte ich dabei nicht Stunden verloren, bis sie eingetroffen und die Angelegenheit geklärt wäre. Und es machte auch keinen Sinn, mich weiter mit dem Bauern anzulegen. Ich erfasste den ohnehin nicht schutzwürdigen Wald «aus der Ferne» (Entfernungsbotanik nennen wir das), denn anhand des Vogelkots konnte ich schöne Pflanzenarten am Boden ausschließen. Dann verduftete ich schnell, nicht ohne dem Bauern noch ein paar gepfefferte Koseworte an den Kopf zu werfen.
Nun aber endlich zu den Ackerpflanzen. Direkt hinter dem Nordseedeich, in artenarmen Weizenfeldern, erscheint die bis ein Meter hohe Roggen-Trespe (Bromus secalinus). Zunächst aufrecht wachsend, beugt sie sich während der Reifezeit in einem eleganten Bogen, ist aber trotzdem noch über dem Getreide gut erkennbar. Das Gras hat dicke, fast grannenlose Ährchen, die ab Ende Juli rasch zerbröseln. Namen wie Kolbige Trespe, Fette Trespe, Angeber-Trespe oder sauschwere Trespe passen daher ebenso. Die Samen, dem Brot beigemischt, sollen betäubende Wirkung haben und dienten einst zum Blau- und Grünfärben. Übrigens wächst die Roggen-Trespe kaum im Roggen. Wer hatte sich denn das nur wieder ausgedacht? Der Roggen ist doch viel zu hoch für sie! Im niedrigeren Hafer, Weizen oder in Zuckerrübenfeldern – sie reifen auch roggentrespengerecht später im Jahr – trifft man diese gebietsweise gefährdete Ackerbegleitart viel häufiger an!
Jedes Jahr rennt das Frühlings-Hungerblümchen (Erophila verna) bei mir offene Türen ein, denn hübsch sind die kleinen weißen Blüten und später die eiförmigen braunen Schötchen an braunen Stielen, die wie frisch lackiert aussehen. Unter den vielen Pflanzenarten mit der deutschen Bezeichnung «Frühling» hat es das Frühlings-Hungerblümchen am eiligsten, das kommt meinem Naturell sehr entgegen. Wenn ich sie entdecke, ordne ich meine Listen, besorge mir eine neue Jahreskladde, spitze die Stifte und putze meine Lupe. Viele nennen diese Zeit Frühjahrsputz, ich dagegen habe einfach nur Frühjahrshunger nach den allerersten Botanikfunden des Jahres.
Wenn an Äckern noch kaum etwas blüht, dann blüht im März doch königsblau der Dreiteilige Ehrenpreis (Veronica triphyllos). Nicht unerwartet – ich erwarte ihn! Diese Blütenfarbe ist sein verdammtes Glück, denn so kann er sich bei seiner geringen Wuchshöhe ins rechte Licht rücken. Geht es diesem kleinen Ackerportier gut, hat er zahlreiche Blüten. Unglücklicherweise halten die sich aber nie lange – wieder so eine hinfällige Art! Dafür erstaunen die vergleichsweise großen Fruchtkapseln, fast grotesk muten die an. Ich beobachtete diese Pflanze 2013 teils massenhaft an kurz abgemähten Grabenrändern längs der A2 zwischen Berlin und Magdeburg. Und nach einem Auftritt beim SAT.1-Frühstücksfernsehen in Berlin im April 2013 bemerkte ich unmittelbar nach dem Sendeabspann in einem großen Pflanzenkübel vor dem Studio Hunderte blau aufschockende Dreiteil-Ehrenpreise. Den hätte ich gern allen gezeigt!
Einer meiner Ackerfavoriten ist das Steife Vergissmeinnicht (Myosotis stricta). Ganz unspektakulär wachsen im April zunächst erste niedlich kleine Sprosse mit kletterleiterartig angeordneten Blütchen heran, himmelblau gefärbt. Im Monat Mai streckt sich diese zerbrechlich wirkende Pflanze aber noch, und es werden noch erstaunliche 25 Zentimeter erreicht. Viel mehr geht jedoch nicht.
Ich hatte sie schon erwähnt, und wer kennt diese Pflanze nicht? Ende Mai erscheinen die ersten königsblauen Kornblumen (Centaurea cyanus), und dann ist auch bald Sommer. Heinos großer Hit hätte eigentlich «Blau, blau, blau blüht die Kornblume» heißen müssen. Als Kind war mir die Kornblume kaum ein Begriff – dabei kennt sie eigentlich jedes Kind –, so selten war sie im Westfälischen um Bielefeld herum Ende der sechziger Jahre zu finden. Die einjährigen Kornblumen benötigen nämlich vor allem Sand, Sonne, wenig Wasser und den Pflug des Bauern. Bei uns gab es leider fast nur Lehm, aber mit diesen Kluten konnte man sich dafür immer so herrlich bewerfen. Die Samen der Ackerkräuter müssen alljährlich eingearbeitet werden, möglichst oberflächennah und mit nur geringen Düngergaben. Die Kornblume, die wie ein blauer Orden daherkommt, ist bei uns in Deutschland nicht ganz ursprünglich wie etwa Birke, Eiche, Wegerich- oder Löwenzahn-Arten. Sie ist aus Südosteuropa mit dem...