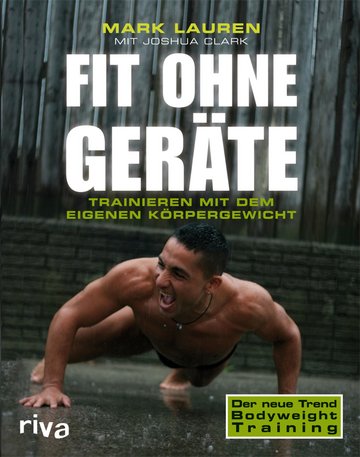2
Wie ich wurde, was ich bin
Meine Teamkameraden verteilten sich über die ganze Länge des Schwimmbeckens, stets bereit, mich hochzuziehen, wenn ich am Ende unter Wasser bewusstlos werden würde. Aber zuerst stand ich im Wasser, entspannt atmend, und bereitete mich darauf vor, den schon lange bestehenden Unterwasserrekord des Militärs zu brechen. Dazu musste ich unter Wasser mehr als 116 Meter schwimmen, in einem einzigen Atemzug. Das ist wesentlich weiter, als ein Footballfeld lang ist, die Außenzonen eingeschlossen. Vier Monate zuvor hatte ich kaum 25 Meter geschafft.
Jeder im Schwimmbad und am Beckenrand war still und wartete geduldig, während ich bis zur Brust im Wasser stand. Ich wusste, dass es hart werden würde, aber ich war fest entschlossen. Zum ersten Mal war ich ganz allein, nur ich, ohne mein Team. Es war surreal. Ich war ruhig, entspannt und aufmerksam. Ich war bereit. Meine Angst war verflogen. Ohne weiter nachzudenken, nahm ich meinen letzten tiefen Atemzug, tauchte unter und stieß mich von der Beckenwand ab.
Man musste eines der härtesten Auswahlverfahren des Militärs durchlaufen, um einen Rekord aufstellen zu können. Und bei einer Quote von 85 Prozent vorzeitig ausscheidenden Kandidaten, wöchentlichen Prüfungen und Ausbildern, die mit Vorliebe die Schwächen ihrer Rekruten ausnutzten, war der Abschluss alles andere als sicher. Tatsächlich war ich schon einmal durchgefallen. Beim ersten Mal habe ich neun grausame Wochen lang mit allen Mitteln gekämpft, um dabeizubleiben.
Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich nie in der Versuchung war aufzugeben. Die Versuchung war jeden Tag da, besonders morgens am Schwimmbad, wo sich der nächtliche Schlaf wie ein Fünfminuten-Nickerchen anfühlte. Jedes Wochenende verbrachte ich meine wertvolle Freizeit damit, mit Flossen Schwimmen zu lernen und diverse Unterwassertrainings zu absolvieren. Am Ende sahen meine Ergebnisse so aus: Ich lief 9,65 Kilometer in 42,5 Minuten, schaffte 14 Klimmzüge, 65 Liegestütze, zwölf Chin-ups, siebzig Sit-ups, 4000 Meter Schwimmen mit Flossen in achtzig Minuten und sieben qualvolle sogenannte »Unterwasser-Selbstvertrauensübungen«.
Das Schwimmen mit Flossen wird mit dicken Gummiflossen absolviert, mit denen ein schwerer Mann sich mit Uniform und Ausrüstung durchs Wasser bewegen kann. Die Arme durfte man nicht benutzen, da es taktisch unklug wäre, wenn Soldaten mit den Armen rudern und aufs Wasser platschen, während sie an Land schwimmen. Alle Übungen mussten perfekt ausgeführt werden. Die Bewegungen jedes Schülers wurden vom Ausbilder gezählt und unter die Lupe genommen, und ungenaue Schwimmzüge wurden nicht mitgezählt. Die Ausbilder riefen: »Zählt nicht, zählt nicht … Die haben nicht gezählt … Dein Rücken ist krumm … nicht ganz hochkommen … nicht so weit untertauchen!«
Staff Sergeant Pope zählte meine Sit-ups während der letzten Prüfung, und er war der Vorgesetzte, der wegen seines ungerechten Verhaltens gegenüber den Auszubildenden am meisten gefürchtet wurde. »Die zählen nicht, Lauren. Deine Hände sind zu weit oben am Kopf«, sagte er, um mich wenig später wegen zwei Sit-ups mit falscher Handposition durchfallen zu lassen. Das war der einzige Grund. Am letzten Tag des Trainings wurde ich zur Anfängergruppe zurückgeschickt, die gerade die erste Woche absolvierte. Aus meiner ursprünglichen Klasse schlossen vier von anfänglich 86 Teilnehmern ab. Als ich zurück zu meinem Schlafsaal ging, lief mein Team in Formation vorbei und sang ein Marschlied über ihren letzten Tag. Ich dachte ernsthaft ans Aufgeben.
Aber in den letzten neun Wochen hatte ich etwas gelernt, was mir für den Rest meines Lebens helfen würde: Ein erfolgreiches Team besteht aus Individuen, die sich selbst hintanstellen können. Wir wurden trainiert, um unser persönliches Wohlbefinden hinter das gemeinsame Ziel des Teams zu stellen. Der Erfolg wurde durch jeden Einzelnen bestimmt und nichts durfte einen vom Erreichen des Ziels abbringen.
Also fing ich noch mal von vorn an. Wir wurden täglich stundenlang von der Sommersonne in San Antonio gegrillt, während wir unsere Übungen zusätzlich zum regulären Training des Kurses machten, das aus einem einstündigen Lauf, zwei Stunden Fitnessübungen, Training im Wasser und einer Stunde Flossenschwimmen bestand. Das Training startete immer morgens, und das Aufstehen fiel mir am schwersten.
Das Team absolvierte durchschnittlich 500 Liegestütze pro Tag, aber das machte uns nichts aus. Wir lernten nach und nach, dass es uns gut ging, wenn wir aufgewärmt waren – egal, wie müde, steif und lethargisch wir uns vorher fühlten.
Jedes Mal, wenn wir das Lehrgebäude betraten oder verließen, mussten wir entweder fünfzehn Klimmzüge, dreizehn Chin-ups, zwanzig Dips oder zwanzig Chinesische Liegestütze machen. Einmal mussten wir im Team sogar tausend Liegestütze machen. Dabei durften wir nur ein einziges Mal für fünf Minuten pausieren, um auf die Toilette zu gehen. Dreieinhalb Stunden lang machten wir immer fünf Liegestütze hintereinander und ruhten uns zwischendurch aus, indem wir den Hintern in die Luft streckten oder die Taille durchhängen ließen. Tausend Liegestütze (und einen für Teamwork), weil wir zu viel Klebeband auf unseren Schnorcheln hatten.
Aber egal wie hart diese schweißtreibenden Workouts auch waren, am schlimmsten war das Schwimmen. Während der ersten Wochen des Trainings machten die Auszubildenden noch Witze auf dem Weg zum Schwimmbad. Nach sechs Wochen herrschte auf der Busfahrt dorthin nur noch stille Angst. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Es war das Schwimmtraining, das hauptsächlich für die hohe Abbruchquote des Kurses verantwortlich war. Man konnte jederzeit aufhören – wenn man entschied, dass die Ausbildung nicht das Richtige für einen war, sagte man einfach: »Ich höre auf.« Man konnte jederzeit während des Trainings aus dem Wasser steigen, in sein Zimmer gehen und eine Pizza essen.
Wir gingen von montags bis freitags ins Schwimmbad, und für Auszubildende gab es nur drei Wege, um aus dem Wasser zu kommen: das Training erfolgreich abschließen, aufgeben oder bewusstlos aus dem Wasser gezogen werden – dann durfte man gerade lange genug draußen bleiben, um wieder zu sich zu kommen, bevor man wieder ins Wasser musste, um die Aufgabe zu erfüllen, aufzugeben oder wieder bewusstlos zu werden. Wenn man bei einer Aufgabe versagte, musste sie wiederholt werden, und jeder Versuch wurde schwerer und schwerer, besonders Aufgaben wie das Bergen von Ausrüstung. Man musste zum Boden des Beckens tauchen, die Ausrüstung ablegen und sie in perfekter Reihenfolge auf dem Grund platzieren, um sie dann für die Inspektion wieder anzulegen. Oder das Knoten-Machen unter Wasser: Wir mussten drei verschiedene Knoten perfekt in vier Meter Tiefe machen und dabei zwischen den Tauchgängen Wasser treten. Wir lernten durchzuhalten, unten zu bleiben und es beim ersten Mal zu schaffen, egal, wie schmerzhaft es war. Es ging darum, alles zu geben. Nur so hatte man Erfolg.
Dieses Training wurde »Indoc« genannt – neun Wochen volles Programm, während neun Ausbilder so viele wie möglich von uns zum Aufgeben bringen wollten. Als ich das Training zum zweiten Mal durchlief, schaffte ein Team aus zwölf Auszubildenden es bis zur Abschlussprüfung und alle bis auf einen bestand sie. Ein Teamkamerad fiel beim 4000-Meter-Flossenschwimmen durch. Wir mussten ein letztes Mal zum Schwimmbad zurück, damit er seine Prüfung wiederholen konnte. Meine Zeit war gekommen.
Ich weiß noch, wie ich im Bus saß und bereute, dass ich davon gesprochen hatte, den Unterwasserrekord zu brechen. Ich wusste, dass meine Teamkameraden das nicht vergessen würden, und kurze Zeit später fragte einer von ihnen: »Willst du wirklich versuchen, diesen Rekord zu brechen? Wirst du das wirklich tun?« Ich wollte ihm die Nase brechen, aber stattdessen brachte ich ein »Ja« hervor. Ich hatte mich festgelegt, und er lachte über die Qualen, die mir bevorstanden. Aber er hatte recht, es wurde Zeit, meinen Worten Taten folgen zu lassen.
Als unser Teamkamerad seine Prüfung im Flossenschwimmen wiederholte, saß ich am Rand des Schwimmbeckens, entspannte mich und atmete. Ich hatte eine beängstigende Aufgabe vor mir. Das schreckliche Gefühl, nicht atmen zu können, ist überwältigend, und ich wusste, wenn ich einmal startete, würde ich nicht wieder an die Oberfläche kommen, bis meine Kameraden mich bewusstlos aus dem Wasser zogen. Ich hatte mir vorgenommen, einen Wahnsinnsrekord zu brechen. Airman First Class Switzer, ein über 1,90 Meter großer Hochschulschwimmer, hatte den Rekord von 116 Metern aufgestellt. Ich weiß noch, als ich sagte, nachdem ich den Kurs begann, dass von allen Rekorden der Unterwasserrekord der beeindruckendste sei. Für einen Rekruten, der sich schon bei 25 Metern Unterwasserschwimmen quält, scheinen 116 Meter übermenschlich. Und hier war ich, vier Monate später, am Ende meines zweiten Trainings, bereit, diesen Rekord zu brechen.
Mit den Füßen auf der Beckenkante rief ich: »Bereit, ins Wasser zu gehen, Sergeant!«
»Gehen Sie ins Wasser!«, rief der Ausbilder.
»Ich gehe ins Wasser, Sergeant!«
Ich stand am Beckenrand, atmete und entspannte mich für einige Minuten, während meine Teamkameraden warteten, bereit, mich aus dem Wasser zu ziehen, wenn nötig. Ich nahm meinen letzten tiefen Atemzug, tauchte unter und stieß mich von der Wand ab.
Nach zwei Monaten ununterbrochenem Teamwork konnte ich plötzlich nichts und niemanden mehr sehen oder hören außer mir selbst. Meine totale Konzentration lag auf meinen Schwimmzügen und auf der Entspannung. Schwimmen, gleiten, entspannen … Schwimmen,...