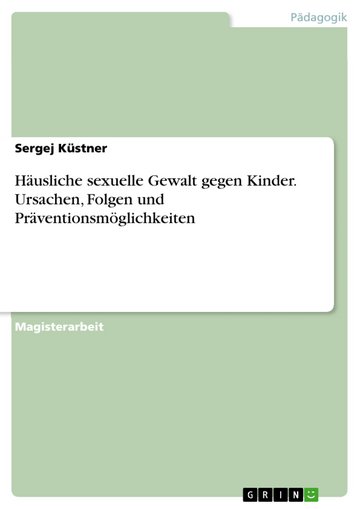Erst Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem die Kindheit als eigenständige Entwicklungsphase sozial anerkannt war, wurde man auf die Gewalt gegen Kinder aufmerksam. Zahlreiche Aufzeichnungen über elterliche Gewalt entstanden in Frankreich und Großbritannien[1]. 1871 wurde in New York die erste ,,Society for the Prevention of Cruelty to Children’’ und in Deutschland 1898 der ,,Verein zum Schutz der Kinder vor Ausnutzung und Misshandlung’’ (der bis 1933 bestand) gegründet. Am Anfang beschäftigte sich der Kinderschutz vor allem mit Problemen der Kinderarbeit, Vernachlässigung von Kindern sowie der physischen Kindermisshandlung. Bis Mitte der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts hat man sich mit Gewalt gegen Kinder, welche primär in den verarmten unteren sozialen Schichten der Bevölkerung anzutreffen war, lediglich in der Medizin auseinandergesetzt. Damals wurde sie noch nicht als ein überall verbreitetes, in allen Schichten präsentes und die Gesellschaft insgesamt betreffendes soziales Problem angesehen. Erst ab Mitte der sechziger Jahre entwickelte sich eine neue Sicht auf Gewalt gegen Kinder, die durch soziale Bewegungen ausgelöst wurde[2].
Gewalt in der Familie (und speziell gegen Kinder) ist eines der schärfsten und auffälligsten sozialen Probleme, die es auf der Welt gibt. Sie ist universell, weit verbreitet und weder schichtenabhängig noch auf eine Gesellschaftsform oder einen Zeitabschnitt begrenzt[3]. Körperliche Misshandlung, sexueller Missbrauch, fehlende emotionale Zuwendung sind nur einige der wichtigsten Erscheinungsformen der häuslichen Gewalt[4].
Die Familie bietet für die Angehörigen keinen Schutz mehr [bzw. noch keinen] vor der Gewalt. Niemand von den Angehörigen ist gegen einen Missbrauch geschützt. Opfer häuslicher Gewalt können neben Kindern auch Frauen und Männer werden, unabhängig vom Alter, vom sozialen Status und/oder vom Bildungsstand. Familiäre Gewalt mit ihren verschiedenen Formen und Unterformen hat mittlerweile solche Ausmaße erreicht, die die gesellschaftliche bzw. öffentliche und individuelle Sicherheit bedrohen.
Eine Dunkelfeldbefragung in Deutschland von 2003 zeigt folgende Lebenszeitprävalenzen für familiäre Gewalt: ,,Jede vierte Frau (25%) im Alter von 16 bis 85 Jahren hatte körperliche (23%) oder […] sexuelle (7%) Übergriffe durch einen Beziehungspartner ein- oder mehrmals erlebt.’’[5] Neuere empirische Untersuchungen zur Eltern-Kind-Gewalt zeigen, dass in Deutschland etwa 70% der Kinder im Laufe ihrer familiären Sozialisation Erfahrungen mit Gewalt durch ihre Eltern machen. Da die meisten Gewalttaten, die registriert werden, innerhalb der Familie erfolgen, spricht man in der Soziologie sogar von einem ,,strukturell angelegten Gewaltpotential in Familien.’’ Folgende Ursachen u.a. sind dafür verantwortlich: das angespannte Zusammenleben verschiedener Geschlechter und Generationen, Emotionen, normale familiäre Körperkontakte zwischen Familienangehörigen (z.B. liebevolle Umarmung) und die unmittelbare Gewaltanwendung bei eskalierenden Familienkonflikten[6].
Die Beobachtung elterlicher Gewalt in der Kindheit ist ein Risikofaktor sowohl für die spätere eigene Gewaltausübung als auch für die eigene Opferwerdung; noch intensiver sind solche Erlebnisse, wenn sie unmittelbar gegen die Kinder gerichtet sind[7]. Aber auch umgekehrt gilt, dass Erwachsene, die gewalttätig gegen ihre Kinder, Lebenspartner oder Eltern handeln, oft als Kinder oder Jugendliche gegen andere Familienmitglieder (beispielsweise die Mutter oder jüngere Geschwister) gewalttätig waren. Aufgrund dessen wird die Gewalt im Kindesalter als die Vorstufe der erwachsenen Gewalt betrachtet. Nach Ferdinand Sutterlüty können also Kinder gewisse Gewaltkarrieren starten, die meistens mit dem letzten Stadium dieser Laufbahn (d.h. gewalttätige Ausbrüche gegen eigene Kinder oder Lebenspartner) enden. Man spricht daher oft von einem ,,Kreislauf der Gewalt’’[8]. Wenn also Kinder permanent elterliche Gewalt erleben mussten, kann sich diese Gewalt dann, wenn die Kinder erwachsen geworden sind, gegen die eigenen Eltern richten[9].
Die Klärung der Gewaltprozesse in der Familie ist ohne den Bezug zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, in die die Familie eingebunden ist, nicht denkbar. Zwischen der familiären Gewalt und gesellschaftlichen Institutionen existiert ein gewisser Konnex. Verschiedene Risikofaktoren wie demographische Entwicklung, bestimmte Werte und Normen, Generationenkonflikte, die zunehmende Anzahl von Singles etc. haben zur Veränderung der Kommunikation zwischen den Menschen beigetragen. Wenn die angesprochene Kommunikation gestört wird, kann es leicht zu Entstehung von Gewalt kommen[10].
Gewalt gegen Kinder ist historisch gesehen kein neues Phänomen. Sie lässt sich bereits bis auf die Bibel zurückverfolgen. Schon im Alten Testament wird von mannigfachen familiären Gewalttaten berichtet. Der Gewaltbegriff hat sich jedoch im Laufe der verschiedenen Zeitalter, aber auch innerhalb von Gesellschaften, stetig verändert. Heutzutage wird familiäre Gewalt primär mit Frauen- und Kindermisshandlung assoziiert. Wann, von wem und warum werden die scheinbar Schwächsten in der Familie misshandelt? Was könnte man gegen solche Taten tun? Erschreckend ist, dass immer häufiger Kinder für familiäre Konflikte gerade stehen müssen, wenn Eltern sich nicht vertragen können oder in Probleme geraten. Die Anwendung körperlicher Gewalt gegen Kinder ist meistens der Endpunkt eines Prozesses, in dem die Spannungen in der Familie unerträglich geworden sind. Deshalb ist es laut Christian Büttner wichtig, dass man alle Formen der Gewalt in der Familie, die zu emotionalen und physischen sowie direkten und indirekten Verletzungen führen, erkennt. Dazu muss man die Familie von innen heraus betrachten, um die familiäre Struktur und Situation als Täter und Opfer besser verstehen zu können. Denn Misshandlungen und Kränkungen sind von außen nur sehr schwer nachzuvollziehen[11]. Trutz von Trotha teilt die Meinung von Büttner nicht ganz, er sieht die Gewalt ,,[…] nicht in irgendwelchen ,,Ursachen’’ jenseits der Gewalt […]. Der Schlüssel der Gewalt ist in den Formen der Gewalt selbst zu finden.’’[12]
Traurig ist die Tatsache, dass das Thema der häuslichen (insbesondere sexuellen) Gewalt in einigen Kreisen unserer Gesellschaft immer noch tabuisiert wird, da sie sowohl von Tätern als auch von manchen Opfern und gesellschaftlichen Institutionen geleugnet und die Folgen als geringfügig betrachtet werden[13].
Ich möchte mich in dieser Magisterarbeit mit der elterlichen Gewalt gegen Kinder beschäftigen. Zuallererst ist natürlich hierbei die Aufgabe, eine gültige Definition des Gewaltbegriffs zu finden. Selbstverständlich existieren bei unterschiedlichen Anwendungs- und Forschungsfragestellungen auch unterschiedliche Eingrenzungen dieses Phänomens. Eine gültige Beschreibung des Gewaltbegriffs, die für alle Anwendungsgebiete gilt, gibt es nicht. Es liegt daran, dass die jeweiligen Erkenntnisinteressen und Arbeitsziele der verschiedenen Wissenschaftsbereiche zu verschieden sind. Die Schwierigkeiten liegen also jeweils in der Festlegung der exakten Grenze[14].
Anschließend an die Gewaltdefinition sollen die Formen der Gewalt gegen Kinder sowie der sexuelle Kindermissbrauch thematisiert werden (d.h. wie verbreitet sind die verschiednen Formen der Gewalt und hat sich das Ausmaß der Gewalt in unserer Gesellschaft verändert). Neben der Häufigkeit bzw. Verbreitung der Gewalt werden Zusammenhänge der familiären Lebenssituation mit Gewalterfahrungen in der Kindheit analysiert. Wegen der zahlreichen Ursachen, die Gewalt gegen Kinder begünstigen, konnte ich bei der Bearbeitung nur einige (allerdings die wichtigeren) der Risikofaktoren auswählen, damit der Rahmen der Arbeit nicht gesprengt wird.
Im Vordergrund der Arbeit stehen der sexuelle Missbrauch und ihre Verbindung zur physischen Gewalt von Eltern gegen die Kinder. Interessant erscheinen mir die Fragen, ob Kindermisshandlungen wirklich ein Massenphänomen, oder ob sie doch nur die seltenen Fälle schwerverletzter Kinder sind, die in sehr armen und randständigen Familien vorkommen.
Ziel der Arbeit ist unter anderem: Begleiterscheinungen, Umstände, Hintergründe, Folgen, Auswirkungen und Reaktionen der Kinder als Zeugen familiärer Gewalt herauszufinden, wie die Heranwachsenden diese Erfahrungen und Erlebnisse bewältigen und welche Wege und Maßnahmen bei der Verarbeitung der Gewalt unternommen werden können.
Ferner möchte ich versuchen, herauszufinden, wieso familiäre Gewaltmaßnahmen von manchen Eltern immer noch als legitim betrachtet werden und wie, wann und wo sie ihren Ursprung haben. Tatsache ist, dass Gewalt nicht erst körperlich beginnt, sondern bereits dann, wenn man über andere Menschen bestimmt. Wenn wir über irgendwelche Menschen entscheiden, haben wir den Kontakt zu ihnen verloren; wir fragen nicht mehr nach ihnen, uns interessieren ihre Gefühle und Gedanken...