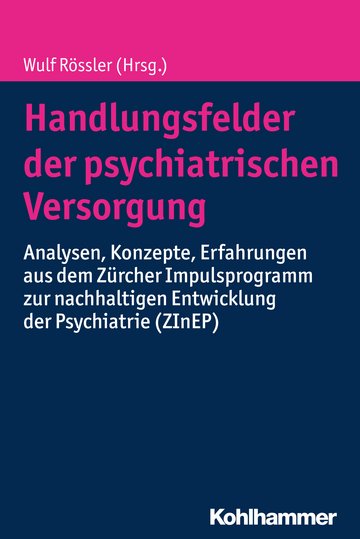1 Psychiatrische Epidemiologie: Grundfragen, Datengrundlagen und das Beispiel der Persönlichkeitsstörungen
Vladeta Ajdacic-Gross, Stephanie Rodgers, Aleksandra Aleksandrowicz, Mario Müller und Michael P. Hengartner
1.1 Einführung
1.1.1 Eine Ausgangslage voller Überraschungen
Die psychiatrische Epidemiologie ist, so wie andere epidemiologische Subdisziplinen auch, eine quantitative Wissenschaft. Es sind Zahlen, die Geschichten erzählen – Zahlen von vielen und über viele Menschen. Nicht selten enden diese Geschichten unerwartet – anders als plausible Theorien uns vorgaukeln und anders als der gesunde Menschenverstand sich die Wirklichkeit zurechtzimmert. Wer sich auf psychiatrische Epidemiologie einlässt, muss auf Überraschungen gefasst sein.
Überraschend, ja geradezu irritierend für viele Kliniker, Politiker wie auch die Bevölkerung waren die wichtigsten Beiträge der psychiatrischen Epidemiologie in den letzten Jahrzehnten. Die Prävalenzraten psychischer Krankheiten in der Bevölkerung erwiesen sich nämlich als unerwartet hoch – und, wie verschiedene Surveys zeigen konnten, in westlichen industrialisierten Ländern sogar höher als in Ländern der zweiten oder dritten Welt. In der Schweiz trug die sogenannte Zürich-Studie von Jules Angst seit den 1980er Jahren (Angst et al. 1984) Ergebnisse bei, dazu die Studie aus Basel von Hans-Rudolf Wacker (Wacker 1995) sowie PsyCoLaus von Martin Preisig in Lausanne (Preisig et al. 2009). In den USA wurden große Surveys mit mehreren Tausend Befragten durchgeführt – Epidemiologic Catchment Area Survey (Regier und Kaelber 1995) und National Comorbidity Survey (NCS) (Kessler et al. 1994). Große Surveys in Grossbritannien (Jenkins et al. 1998), in Deutschland (Wittchen et al. 1998; Jacobi et al. 2002) und in Holland (Bijl et al. 1998) sollten folgen. Der letzte große Wurf ist der World Mental Health Survey (Kessler et al. 2007). Je jünger die Studie, je ausgefeilter das Instrumentarium, desto höher stiegen die Raten. Inzwischen ist klar, dass über die Hälfte der Bevölkerung im Laufe des Lebens früher oder später an einer diagnostizierbaren psychischen Störung leidet, wobei über 50 % dieser Störungen komorbid sind (d. h., zusammen mit anderen auftreten). Wird der Fokus auf psychische Beschwerden gerichtet, die mit einer massiven Belastung, d. h. mit entsprechendem Leidensdruck einhergehen, so sind über 90 % der Menschen betroffen (Ajdacic-Gross et al. 2006).
Das zweite Überraschungsmoment betrifft die Nutzung von professionellen Hilfs- und Betreuungsangeboten. Erstaunlich viele Menschen mit einer schweren Störung, etwa einer schweren Depression, suchen keine professionelle Hilfe auf, sondern nutzen v. a. informelle Hilfe oder versuchen selbst, mit der Situation zurecht zu kommen, oder warten einfach auf spontane Besserung (Burns et al. 2003; Rüsch et al. 2014). In Zahlen ausgedrückt, betrifft dies mehr als 50 % aller Betroffenen (Wang et al. 2007). Zu berücksichtigen bleibt zudem, dass nur ein bestimmter Anteil unter ihnen korrekt diagnostiziert, in der Folge nur ein Anteil dieses Anteils angemessen psychopharmakologisch therapiert wird, und davon nochmals nur ein weiterer Anteil die Therapie auch nach Vorgabe befolgt. Unter dem Strich führt dies zu einem Anteil von nur 10–20 % adäquat versorgten Menschen mit einer schweren Depression (Althaus und Hegerl 2001; Althaus et al. 2007). Diese Zahlen spiegeln sich im Outcome, indem die Mehrheit aller behandelten Patienten innerhalb der nächsten zwei Jahre erneut erkrankt. Nur ein Drittel bleibt über eine Zeitspanne von zwei Jahren klinisch bedeutsam verbessert. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass ca. 15 % aller Personen mit Depressionen Suizid begehen (Hollon et al. 2002). Immerhin lässt sich aus der Abnahme der Suizidraten in den vergangenen vier Dekaden (Hepp et al. 2010) indirekt schließen, dass sich die Situation nach und nach bessert. Obwohl Psychotherapeuten und praktizierende Psychiater gut ausgebucht sind und die Verschreibungsraten von Psychopharmaka (Antidepressiva, ADHS-Medikamenten etc.) zum Entsetzen der Medien angestiegen sind, bleibt nach wie vor die Unterversorgung von betroffenen Menschen das wesentliche Thema in der Versorgungsepidemiologie.
1.1.2 Differenzierungen: Heterogenität und Kontinuum
Die konzeptuelle Grundlage des Aufschwungs der psychiatrischen Forschung, darunter auch der psychiatrischen Epidemiologie, ergab sich aus der Entwicklung von Diagnosemanuals – dem Diagnostic and Statistical Manual (DSM) der US-amerikanischen Psychiatriegesellschaft und der International Classification of Disorders (ICD) der WHO. Deren systematisierte operationale Definitionen der Störungen haben empirische Forschung und Weiterentwicklung einerseits vorausgesetzt und anderseits auch motiviert. Den Anfang machte DSM-III in den 1980er Jahren, gefolgt von DSM-III-R, -IV, mittlerweile auch DSM 5 sowie ICD-10 ab 1994, während ICD-11 in Arbeit ist. Fraglich bleibt trotz dieser mehrfachen Revisionen, was psychische Störungen abseits der diagnostischen Manuale wirklich sind (Kendler et al. 2011).
Die operationalen Definitionen von Störungen präzisieren nicht nur, sie formulieren auch konzeptuelle Grenzen. Wie weit berechtigt oder geeignet diese Grenzen sind, ist unmittelbar Quelle und Gegenstand neuer Dispute (Frances und Widiger 2012; Frances 2013; Rössler 2013). Einer davon betrifft die Frage, welche Zahl der Diagnosen angemessen ist. Abgesehen von der Kritik an Diagnosen (bzw. operationalen Definitionen), die als unglücklich wahrgenommen werden, geht es dabei um den Detailliertheitsgrad eines Diagnosesystems und somit um den Bedarf an weiteren Subkategorien. Wie viel Heterogenität ist im System psychischer Krankheiten und Beschwerden enthalten und wie gibt man diese am besten wieder?
Dabei ist die Entwicklungsrichtung eigentlich von vorneherein klar: Der wissenschaftliche Fortschritt wird unvermeidlich noch mehr Differenzierung hervorbringen, d. h. noch mehr Störungen, noch mehr Subkategorien, noch mehr Subtypen. Unter dieser Perspektive lohnt ein zweiter Blick auf die im DSM bereits realisierten Versuche, der Heterogenität des Gegenstandes Herr zu werden. Dabei lässt sich entdecken, dass das Vorgehen uneinheitlich ist, d. h., vermutlich historisch gewachsen und der jeweiligen Zusammensetzung der Expertengruppen geschuldet ist. Im Einzelnen finden sich:
• bei ADHS prädominante Subtypen: vorwiegend hyperaktiv-impulsives, vorwiegend unaufmerksames oder ein gemischtes Erscheinungsbild
• bei affektiven Störungen distinktive Subtypen: bipolare Störungen vs. unipolare Depression vs. unipolare Manie
• bei spezifischen Phobien Fuzzy-Subtypen (überlappende Subtypen): die fünf Subtypen der spezifischen Phobie können allein oder in beliebiger Kombination auftreten
Auf dem Level der Diagnosen ist die Fuzzy-Variante der Subkategorisierung die übliche Form, zumindest abgesehen von den unipolaren und bipolaren affektiven Störungen. Das Nebeneinander von verschiedenen operationalen Definitionsschemata ist ein subtiler Fingerzeig, wie viel Entwicklungsarbeit der Psychiatrie noch bevorsteht. Der Epidemiologie kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn sie steuert zu einem großen Teil die Empirie für die Differenzierungsoptionen bei:
• unterschiedlichen Symptomclustern (theoretische oder empirische Basis)
• dabei: unterschiedliche Profile von Risikofaktoren und soziodemographischen Markern
• oder: unterschiedliche Komorbiditätsprofile
• oder: einmaliges Auftreten vs. schubweise vs. kontinuierliche Verläufe
• oder: unterschiedliches Ansprechen auf Therapien
Die zweite wichtige Stoßrichtung in der Differenzierung der Diagnosesysteme erfolgte nicht »horizontal« sondern »vertikal«. Dabei geht es nicht mehr um Subtypen aufgrund von Symptomen und Symptomclustern, sondern um Subtypen entlang der Schweregrade von Störungen. Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung hat Jules Angst eingenommen, indem er die Bedeutung von Störungen unterhalb der Diagnoseschwelle hervorgehoben und Vorschläge für deren Operationalisierung beigetragen hat, z. B. die Recurrent Brief-Subtypen und die Minor-Subtypen (Angst et al. 2003a; Angst et al. 2003b; Angst et al. 2005; Angst et al. 2009). Nach wie vor handelt es sich dabei um kategoriale Konzepte, jedoch mit abgeschwächten Anforderungen an die Zahl der Kriterien oder an die Dauer der Beschwerden.
Noch einen Schritt weiter geht das Kontinuumskonzept, wobei die kategorialen Grenzen weiter verwischt werden. Im Vordergrund stehen hier in erster Linie Symptome, deren subjektive...