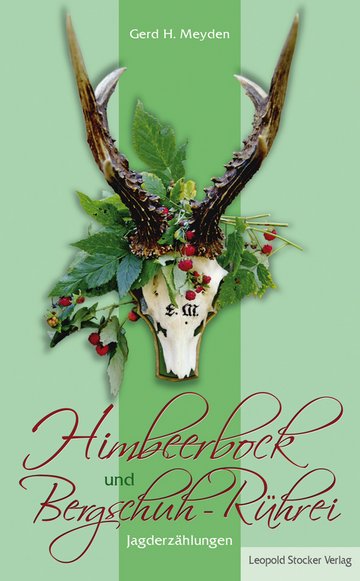Jäger, Reviere und Zeiten
Wutkreischendes Gebrüll. Urweltliches Kampfgetöse schreckt mich aus meinen Gedanken. Zwei Keiler sind aneinandergeraten. Ganz nah, nur knapp zwanzig Meter neben meiner Kanzel. Sehen kann ich sie nicht, höre nur Getümmel in der Dickung. Äste krachen, kleine Fichtenwipfel schwanken. Dumpfes Schalengetrommel, das sich entfernt. Der Sieger prescht dem Schwächeren hinterdrein. Stille. Kein anderer Laut. Nur das Harfen des Windes in den Baumkronen.
Neben meinem Ansitz huscht ein Baumläufer den Fichtenstamm empor. In jede Rindenspalte stochert sein suchender Schnabel. Mich beachtet er nicht. Wäre nicht der Kampf der beiden rauschigen Keiler gewesen, ich könnte denken, wir zwei seien in weitem Umkreis die einzigen Wesen.
Einsamkeit zu finden ist immer eines der Ziele meines Jagens gewesen. Fast könnt’ ich sagen, die Jagd war nur ein Vorwand, allein zu sein. Kobell hat es auf den Punkt gebracht: „Den Schwätzern aus dem Weg zu geh’n und keinen Narren mehr zu seh’n.“ Mit den Jahren bin ich nicht mehr so brausepulverig und mit dem Beutemachen ist’s nimmer so dringend. Obwohl mir das Jägerherz noch ganz gehörig einheizen kann.
Jetzt bin ich hier im Staatsforst in einer Gruppe von Jägern, die sich zweimal pro Woche zum gemeinsamen Ansitz zusammenfindet. Ein paar Kilometer nur bin ich von meinem Haus entfernt, in einer knappen Viertelstunde wäre ich wieder daheim. Wer hat’s so schön wie ich? Kommt was und passt’s, ist’s recht. Ich werde nur das erlegen, was ich allein für richtig halte. Kommt nichts, ist’s genauso recht. Kein Druck zur Abschusserfüllung, keine Sorge um Wildbretverkauf, kein Ärger mit Wildschaden, Verbissgutachten, wildfeindlich aufgehetzten Jagdgenossen. Ich kann die Stunden des Ansitzes voll genießen. Denn all diese erwähnte Jagdfreuden-Beikost, die hatte ich fast ein ganzes Jägerleben lang als Dreingabe. Nun schaue ich der hinter den Wipfeln versinkenden Sonne zu, lausche dem Raunen und Rauschen des Windes in den Zweigen und folge meinen Gedanken zurück zu den Stationen meines Jagens.
Gejagt habe ich bereits, als ich meine ersten frühkindlichen Erkundungen im elterlichen Garten machte. Alles, was ich erwischen konnte, ob Biene, Hummel, Schmetterling oder Käfer, all das war meine Beute. In den kostbaren Einmachgläsern, die ich dem Haushalt stibitzte, summte, brummte und krabbelte es. Mit den Jahren wandelten sich meine Fang- und Jagdmethoden und mit ihnen die Beutestücke. Steinschleuder, Luftgewehr. Der übliche Weg.
Sechzehnjährig war ich endlich legaler, geprüfter Jäger und schon eine bekannte Figur in der Hundeführerszene. Hatte ich doch soeben meinen Kurzhaarrüden mit einem 1a-Preis durch Solms- und Verbandsjugendprüfung gebracht. Das blieb nicht unbemerkt und kam mir als revierlosem Jungjäger zustatten. Dazu kam die Bläsergruppe des BJV-München. Wir waren seinerzeit unter den ersten, die nach dem Krieg diesen Brauch wieder ausübten. Onkel Dietrich – unser Lehrmeister, Graf Bülow-Dennewitz – hat mich mit seiner hohen Gesinnung von Ethik, der Achtung vor dem Mitgeschöpf, früh und tief geprägt. Noch heute gibt’s in Augsburg, der letzten Station seines Lebens, einen sehr lebendigen, ihn verehrenden Kreis seiner einstigen, dortigen Schüler und deren jagenden Nachkommen. Durch die Jagdhornbläserei kam ich viel herum, denn kaum eine Bezirksgruppe hatte noch ein eigenes Bläserkorps.
Ein „alter“ Herr namens Heinz Hobbhahn, er mochte aus meiner damaligen Sicht gewiss schon das „Greisenalter“ von 55 Jahren erreicht haben, wurde, wohlerzogen, wie man damals war, bei meinen Eltern vorstellig. Selbst kinderlos geblieben, war er Pächter des großen Reviers Puchheim, einer Nachbargemeinde unseres damaligen Wohnorts. Meinem Bruder und mir bot er kostenloses Begehungsrecht. Wir sollten die Jagdaufsicht machen und uns um den Rehwildbestand kümmern. Er selbst war nur an der Flintenjagd interessiert. Geboren und aufgewachsen in Ägypten, hatte er in den dortigen Flugwildeldorados seine Leidenschaft des schnellen Schrotschusses entdeckt. Deshalb machte er zur Bedingung, dass wir auf Hasen, Rebhühner und Enten nur in seiner Begleitung jagen dürften. Ausschlaggebend für dieses unglaublich großzügige Angebot war unser Hund, denn er selbst hatte nur einen bresthaften, dennoch heiß geliebten, alten Dackel. Rehe gab’s dort in den Nachkriegsjahren nicht allzu viele. Dafür hatten die amerikanischen Besatzer und sonstige stille Teilhaber gründlich gesorgt. Doch allein auf die Jagd gehen zu dürfen, Ringeltauben, Raubwild und Raubzeug bejagen zu können, das war mehr, als ich mir erträumen konnte. Und hin und wieder ein Reh erlegen. Wobei nicht allzu genau geschaut wurde, ob der Bock schon reif für die Kugel war. Dass ich mit dem Jugendjagdschein noch nicht allein jagen durfte, das scherte weder mich noch sonst irgendjemanden.
Die neun bis zwölf Kilometer ins Revier fuhr man mit dem Rad. Die Büchse über dem Rucksack auf dem Buckel, der Kurzhaar trabte nebenher. So ging’s durch die Dörfer. Saß eine Katze am Wegesrand, gab’s oftmals Ärger … Bis der Hund begriff, dass die Miezen innerorts tabu waren.
Ab und zu tauchte auf dieser Bühne der Mitpächter unseres Gönners auf. Nennen wir ihn Maxl. Nicht, dass mir seine Nachfahren noch den Kadi auf den Hals schicken. Im Gegensatz zu Hobbhahn, der stets so daherkam, wie man sich einen französischen Jäger vorstellt – mit kess schräger Baskenmütze und der Zigarette im Mundwinkel –, wirkte jener wie eine Karikatur von Geilfuß. Der rund- und blutdruckrotköpfige, behäbige, lodengewandete Bayer. Seine untersetzte Erscheinung mit einem Gesicht, einer aufgequollenen Semmel ähnlich, ließ auf einen gemütlichen Menschen schließen.
Mit ihm hatte es eine besondere Bewandtnis. War er nämlich wieder einmal abgetaucht, was jährlich ein- bis zweimal vorkam, erfuhren wir, dass er in die Nervenheilanstalt Eglfing eingewiesen wurde. Irrenhaus sagte man damals. Der Spottvers im Dorf lautete: „Eglfing mach’s Türle auf, der Maxl kommt im Dauerlauf!“ Das jeweils sichere Anzeichen, dass ein neuerlicher Anfall seines Irreseins bevorstand, war folgendes: Er öffnete die Ofentür und pieselte mit vollem Strahl in die Flammen, dass es zischte. Darauf musste man ihn schleunigst einweisen, denn diese „Löschaktion“ war ein Alarmsignal. Danach ging’s rund; er wurde aggressiv, randalierte, schmiss Gläser und Geschirr durch die Gegend und verprügelte jeden, der ihm über den Weg lief. Nach ein paar Monaten Therapie erschien er wieder, war brav, lammfromm und kümmerte sich, als wär’ nichts gewesen, um seinen großen Bauernhof. Im Herbst ging er sogar wieder mit auf die Jagd. Heutzutage undenkbar, dass ein Mensch mit einem solchen Defekt eine Waffe führen dürfte. Mir war er aufgrund seiner gewissen Unberechenbarkeit unheimlich, sodass ich bei Hasenstampereien, wenn er mit von der Partie war, auf die Teilnahme verzichtete. Ich hatte einmal seine Fünferschrote auf die Lederhose bekommen. Das tut einen teuflischen Schlag und brennt höllisch. An einer Wiederholung war ich, trotz aller Jagdpassion, nicht interessiert.
Im Laufe der Jahre erholte sich unser Rehbestand. Wir hatten Fütterungen eingerichtet, solide Hochstände gebaut, mit den Nachbarn Wildfolge und Grenzfrieden vereinbart. Das Revier war bestens gepflegt. Und Teilhaber Maxl, der immer wieder verschwand und neu aufkreuzte, entdeckte nun, da man allenthalben Rehe sah, seine Passion für die Bockjagd. Dagegen war nichts von meiner untergeordneten Position aus zu sagen, er war ja schließlich Mitpächter und mit seinem Landbesitz auch noch bedeutender Jagdgenosse. Mit dieser neu entdeckten, ungebremsten Leidenschaft trat jedoch ein Umstand ein, gegen den ich glaubte einschreiten zu müssen.
Wir hatten mit Zustimmung unseres Jagdnachbarn Lindinger 50 Meter vor der gemeinsamen Grenze einen Hochstand gebaut. Mit komfortabler, breiter Sitzbank, Lehne und Fußraste. Die Leiter war so schräg gestellt, dass unser Kurzhaar Birko ebenfalls bequem auf- und absteigen konnte. Der Hochstand diente hauptsächlich zum Fuchspassen und zur Beobachtung. Im Gegenzug hatte der Nachbar nach 100 Metern auf seiner Seite der Grenze eine Kanzel stehen. Ab und zu wurde wechselseitig auch das eine oder andere Reh erlegt. Alle Beteiligten waren damit einverstanden und der Frieden ging sogar so weit, dass Lindinger uns Gebrüder auch mal auf seine Jagd einlud. Doch diese Harmonie wurde nun durch Maxls Schießlust arg strapaziert. Er saß nämlich ausschließlich auf diesem bequemen Grenzsitz und jedes Reh, das sich dort zeigte, „ward des (mehr oder weniger) sichren Rohrs Gewinn“. Da von meiner Seite mit diesem Grenzschinder nicht zu reden war, wandte ich mich an seinen Kompagnon, an Hobbhahn. Der kratzte sich seinen ägyptischen Ramseskopf – den hatte er tatsächlich – und pfiff mich zurück. Das gehe mich nichts an, es sei das Recht des Mitpächters. Der könne ansitzen, wann und wo er wolle. Punkt! Nun schritt ich zur Selbsthilfe. Nicht legal,...