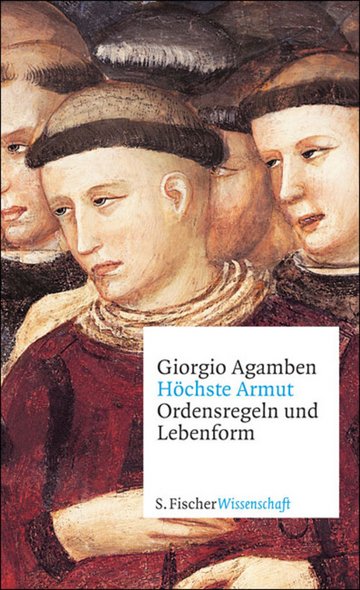2. Regel und Gesetz
2.1. Umso dringlicher wird es nun, die Frage nach der rechtlichen Natur der Ordensregeln zu stellen. Obgleich sie die Vorschriften des Klosterlebens in ihren Sammlungen berücksichtigt haben, fragten sich schon die Juristen und die Kanoniker, ob das Recht auf ein so eigentümliches Phänomen überhaupt angewendet werden kann. So gibt Bartolus in seinem Liber minoriticarum mit Blick auf die Franziskaner im selben Atemzug, in dem er feststellt, dass sich die sacri canones mit ihnen beschäftigt haben (circa eos multa senserunt, die venezianische Ausgabe von 1575 gibt hingegen sanxerunt, »sanktioniert, gesetzlich festgelegt«), unumwunden zu, dass »ihr Leben von so großer Ungewöhnlichkeit war (cuius vitae tanta est novitas), dass man das corpus iuris civilis nicht auf es anwenden konnte (quod de ea in corpore iuris civilis non reperitur authoritas)« (BARTOLUS, S.190v). Und auch die Summa aurea des Hostiensis spricht von der Schwierigkeit, den status vitae der Mönche in den Geltungsbereich des Rechts einzubeziehen (non posset de facili status vitae ipsorum a iure comprehendi). Auch wenn die Gründe für das Unbehagen je andere sind – für Bartolus die franziskanische Ablehnung jeden Eigentumsrechts, für Hostiensis die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der Regeln (diversas habent institutiones) –, die Verlegenheit der Juristen schuldet sich der eigentümlichen Neigung des Klosterlebens, sich mit der Regel zu vermischen.
Yan Thomas hat gezeigt, dass sich in der Tradition des römischen Rechts die Rechtsnorm niemals unmittelbar auf das Leben als umfassende biographische Wirklichkeit bezieht, sondern ausschließlich auf die Rechtsperson als abstraktes Zurechnungszentrum einzelner Taten oder Vorkommnisse. »Sie [die Rechtsperson] dient der Maskierung der konkreten Individualität durch eine abstrakte Identität, zwei Modalitäten des Subjekts, deren Zeiten sich nicht vermischen können, da die eine biographisch, die andere statuarisch ist« (THOMAS, S.136). Die Blüte der Ordensregeln seit dem 5. Jahrhundert und deren minuziöse Reglementierung des Daseins bis ins kleinste Detail, die regula und vita tendenziell ununterscheidbar werden lässt, sind Thomas zufolge ein der römischen Rechtstradition und dem Recht tout court wesentlich fremdes Phänomen: »›Vita vel regula‹, das Leben oder die Regel, das heißt das Leben als Regel. Das ist das Register – und gewiss nicht das des Rechts –, in dem die Legalität des Lebens als verkörpertes Gesetz gedacht werden kann« (ebd.). Man kann jedoch, wie einige dies getan haben, Thomas’ Einsicht auch in die entgegengesetzte Richtung weiterdenken und die Ordensregeln als Ausarbeitung einer Normierungstechnik betrachten, die es ermöglichte, das Leben als solches zum Rechtsgegenstand zu machen (COCCIA, S.110).
2.2. Eine Textanalyse der Regeln zeigt, dass ihr Verhältnis zur Sphäre des Rechts zumindest widersprüchlich ist. Denn einerseits geben sie nicht nur sehr bestimmt Verhaltensregeln im eigentlichen Sinn vor, sondern enthalten oft auch ein ausführliches Verzeichnis der Strafen, die den Mönchen drohen, wenn sie gegen jene verstoßen; andrerseits schärfen sie den Mönchen ebenso nachdrücklich ein, die Regeln nicht als rechtliches Dispositiv zu betrachten. »Der Herr gebe«, wie es im Schlusskapitel der Augustinusregel heißt, »dass ihr dies alles freudig befolgt, […] nicht wie Knechte unter dem Gesetz, sondern wie Freie unter der Gnade (ut observetis haec omnia cum dilectione, […] non sicut servi sub lege, sed sicut liberi sub gratia constituti)« (Regula ad servos Dei, PL, 32, 1377). Auf die Frage eines Mönchs, wie er sich seinen Schülern gegenüber verhalten solle, antwortet Palamon, der legendäre Lehrer des Pachomius: »Sei ihnen Vorbild (typos), nicht Gesetzgeber (nomothētes)« (Apophtegmata patrum, PG, 65, 563). Im selben Sinn mahnt Mar Abraham im Rahmen der Darlegung der Regel seines Klosters, uns nicht als »Gesetzgeber, weder unserer selbst, noch der anderen« zu betrachten (non enim legislatores sumus, neque nobis neque aliis – vgl. MAZÓN, S.174).
In aller Deutlichkeit tritt diese Ambiguität in den Praecepta atque iudicia pacomiani hervor: Sie beginnen mit der entschieden antilegalistischen Aussage plenitudo legis caritas [»die Fülle des Gesetzes [ist] die Liebe«], um unmittelbar darauf eine Reihe von Straftatbeständen aufzuzählen (BACHT, II, S.255). Derartige Kasuistiken finden sich in den Regeln sehr häufig. Mal stehen sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Vorschriften oder werden in besonderen Abschnitten der Regel zusammengefasst (das 13. und 14. Kapitel der Magisterregel oder die Kapitel 23 bis 30 der Regel des hl. Benedikt), mal bilden sie eigenständige Texte (wie in den zitierten Praecepta atque iudicia oder in den Poenae monasteriales des Theodoros Studites).
Einen Überblick über das, was man als das monastische Strafsystem bezeichnen könnte, liefern die Kapitel 30 bis 37 der Concordia regularum, in der Benedikt von Aniane die alten Regeln nach Themen aufgeschlüsselt hat. Die Strafe schlechthin ist die excommunicatio, also der völlige oder teilweise Ausschluss vom Gemeinschaftsleben für einen der Schwere der Schuld entsprechenden Zeitraum. »Hat sich ein Bruder nur leichterer Verfehlungen schuldig gemacht«, heißt es in der Benediktsregel, »so werde er von den gemeinsamen Mahlzeiten ausgeschlossen (a mensae participatione privetur) […]. Im Oratorium darf er weder einen Psalm noch eine Antiphon mit den anderen anstimmen noch eine Lesung vortragen, bis zur Verbüßung seiner Strafe. Das Essen erhalte er allein nach der Mahlzeit der Brüder […], bis er nach entsprechender Buße Verzeihung erlangt« (PRICOCO, S.188). Schwere Vergehen wurden mit dem Verbot jeglichen Kontakts zu den Brüdern geahndet. Diese hatten den Schuldigen völlig zu ignorieren: »Niemand segne ihn, und auch die Speise, die er erhält, werde nicht gesegnet. […] Sollte ein Bruder es wagen, ohne Erlaubnis des Abts mit einem exkommunizierten Bruder zu verkehren oder zu reden oder ihm eine Mitteilung zukommen zu lassen, soll er ebenfalls der Exkommunikation verfallen« (ebd., S.191). Im Wiederholungsfall ging man zur Anwendung körperlicher Strafen über, im äußersten Fall kam es zum Ausschluss aus dem Kloster: »Wenn sich die exkommunizierten Brüder als so hochmütig erweisen, dass sie im Stolz ihres Herzens verharren und dem Abt keine Genugtuung leisten wollen, werden sie am dritten Tag zur neunten Stunde eingekerkert und bis aufs Blut gegeißelt und, wenn es der Abt für tunlich hält, des Klosters verwiesen« (VOGÜÉ 2, II, S.46). In einigen Klöstern schien sogar eine als Gefängnis dienende Räumlichkeit (carcer) vorgesehen zu sein, in die jene weggeschlossen wurden, die sich der schlimmsten Vergehen schuldig gemacht hatten: »Der Mönch, der Kinder oder Jugendliche belästigt«, heißt es in der Regel des Fructuosus, »wird in Eisenketten gelegt und mit sechs Monaten Gefängnis bestraft (carcerali sex mensibus angustia maceretur)« (OHM, S.149).
Und dennoch ist nicht nur die Strafe kein hinlänglicher Beweis für den rechtlichen Charakter einer Vorschrift, auch die Regeln selbst legen nahe, dass die Bestrafung der Mönche – in einer Zeit, in der die Strafen in der Regel affliktiv waren – eine wesentlich moralische und bessernde Funktion hatte, vergleichbar einer vom Arzt verordneten Behandlung. So verbindet die Benediktsregel ihre Ausführungen zur Strafe der Exkommunikation mit der Mahnung, dass der Abt für die exkommunizierten Brüder besondere Sorge tragen soll:
Größte Sorge trage der Abt für schuldig gewordene Brüder, denn nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Deshalb muss er wie ein kluger Arzt alle Heilmittel anwenden und ihnen Senfpflaster schicken, das heißt alte, erfahrene Brüder, die den wankelmütigen Bruder ganz unvermerkt trösten, zu demütiger Buße anspornen und ihn aufrichten, damit er nicht in maßlose Traurigkeit sinke (PRICOCO, S.193).
Dieser medizinischen Metapher entspricht bei Basilius, dass er die Gehorsamspflicht nicht in den Horizont eines Rechtssystems stellt, sondern in das neutralere Umfeld der Regeln einer ars oder Technik. »Demjenigen, der zur Ausübung der Künste zugelassen wird«, heißt es im »der Autorität und dem Gehorsam« gewidmeten 41. Kapitel der Regel, »ist nicht erlaubt, das zu erlernen, was ihm sein Wille eingibt, sondern das, wozu er tauglich befunden wird. Der Mönch, der sich selbst verleugnet und allen seinen Eigenwillen abgelegt hat, tut nicht, was er will, sondern was ihm vorgeschrieben wird. […] Übt jemand eine Handwerkskunst aus, die bei der Gemeinschaft Gefallen findet, so darf er sie nicht aufgeben, denn es zeugt von Unbeständigkeit und Willensschwäche, den anstehenden Aufgaben keine Beachtung zu zollen; übt er keine aus, so soll er sich selbst keine wählen, sondern die übernehmen, die von den Alten gutgeheißen wird, damit er in allem den Gehorsam beobachte« (Regulae fusius tractatae, PG, 31, 1022).
In der Magisterregel wird das...