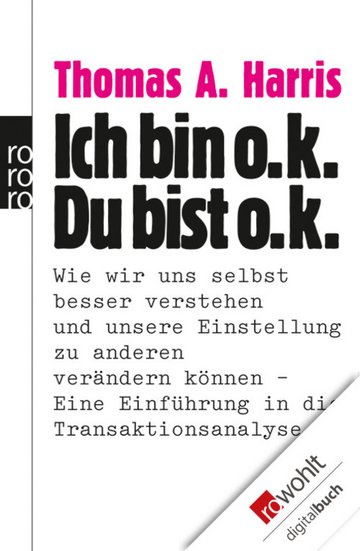Der Gehirnchirurg mit der Sonde
Wer die Richtigkeit einer Hypothese nachweisen will, muss empirisch abgesicherte Beweise dafür vorlegen. Bis vor kurzem gab es kaum genug bewiesene Auskünfte darüber, wie sich der Erkenntnisprozess im Gehirn abspielt, wie im Einzelnen die zwölf Milliarden Zellen des Gehirns arbeiten, wenn sie Erinnerungen speichern, und welche Zellen an diesem Vorgang beteiligt sind. Wie viel Erinnerung bleibt erhalten? Kann sie verschwinden? Arbeitet das Gedächtnis generalisierend oder spezialisierend? Warum lassen sich einige Gedächtnisinhalte leichter abrufen als andere?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden, zunächst theoretisch, Hypothesen aufgestellt, die es nun zu verifizieren gilt. Ein anerkannter Forscher auf diesem Gebiet ist Wilder Penfield, Neurochirurg an der Universität Montreal. Seit 1951 hat er aufschlussreiche Versuche ausgewertet, mit denen er die Hypothesen empirisch bestätigen oder korrigieren konnte.[1]
Penfield hatte Patienten mit Jackson-Epilepsie zu behandeln. Dabei handelt es sich um eine Sonderform der Epilepsie mit motorischen und sensiblen Anfällen, die von einem umschriebenen Krankheitsherd im Gehirn verursacht werden. Im Verlauf der operativen Eingriffe unternahm Penfield eine Reihe von Versuchen, bei denen er die Großhirnrinde des Schläfenlappens durch eine galvanische Sonde mit schwachen elektrischen Strömen reizte. Die Reaktionen auf diese Reizung hat Penfield untersucht und die Versuchsergebnisse mehrerer Jahre gesammelt. Der Patient war bei diesen Eingriffen an seiner Großhirnrinde nur örtlich betäubt, im Übrigen aber bei vollem Bewusstsein und konnte mit Penfield sprechen. Die Aussagen der Versuchspersonen lösten Überraschung aus.
Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden der Transaktions-Analyse und keine fachwissenschaftliche Abhandlung. Ich möchte betonen, dass Penfields Arbeiten hier nur deswegen dargestellt werden, weil sie die wissenschaftliche Grundlage bilden, auf der alles Folgende aufgebaut ist. Im Übrigen bleibt der Ausflug in die Fachwissenschaft auf dieses erste Kapitel beschränkt. Penfields Experimente lassen den gesicherten Rückschluss zu, dass unser Gehirn alles, was unser Bewusstsein jemals registriert, genau aufzeichnet und so speichert, dass es jederzeit abgerufen werden kann. Es empfiehlt sich vielleicht, die nächsten Seiten gründlich und mehr als einmal zu lesen, damit die Bedeutung der Befunde von Penfield ganz klar wird.
Penfield entdeckte, dass der Reiz, den er mit der Sonde auf eine bestimmte Geweberegion der Großhirnrinde ausübte, Informationen hervorrief, die nachweislich der Erinnerung des Patienten entstammten. Penfield fährt fort: «Der auf diese Weise in Gang gesetzte psychische Prozess bricht ab, sobald die Elektrode entfernt wird, kann sich aber wiederholen, wenn die Elektrode wieder angesetzt wird.» Er bringt dafür einige Beispiele.
Der erste Fall war S. B. Die Stimulation bei Punkt 19 in der ersten Windung des rechten Schläfenlappens veranlasste ihn zu der Äußerung: «Da war ein Klavier, und jemand spielte. Ich konnte das Lied hören.» Als der Punkt ohne Vorankündigung wieder stimuliert wurde, sagte er: «Jemand spricht mit einem anderen», und er nannte einen Namen, doch ich konnte ihn nicht verstehen … es war genau wie ein Traum. Der Punkt wurde zum dritten Mal stimuliert, wieder ohne Ankündigung. Da bemerkte er spontan: «Ja, ‹O Marie, o Marie!› – jemand singt es.» Als der Punkt ein viertes Mal stimuliert wurde, hörte er dasselbe Lied und erklärte, das sei die Erkennungsmelodie einer bestimmten Radiosendung.
Als Punkt 16 stimuliert wurde, sagte er, während die Elektrode angesetzt war: «Etwas bringt eine Erinnerung zurück. Ich kann Seven-Up Bottling Company sehen … Harrison Bakery.» Er wurde dann gewarnt, dass er stimuliert werde, doch die Elektrode war nicht angesetzt. Er antwortete: «Nichts.»
Als in einem anderen Fall, dem von D. F., ein Punkt an der Oberfläche des rechten Schläfenlappens […] stimuliert wurde, hörte die Patientin einen bestimmten Schlager, als würde er von einem Orchester gespielt. Wiederholte Stimulationen ließen dieselbe Musik anklingen. Während die Elektrode angesetzt blieb, summte die Patientin die Melodie, Strophe und Refrain, und begleitete so die Musik, die sie hörte.
Der Patient L. G. wurde veranlasst, «etwas», wie er sagte, zu erleben, was ihm früher geschehen war. Die Stimulation eines anderen Punktes brachte ihn dazu, einen Mann und einen Hund zu sehen, die bei ihm zu Hause auf dem Lande eine Straße entlanggingen. Eine Patientin hörte eine Stimme, die sie nicht recht verstehen konnte, als die erste Schläfenwindung anfangs stimuliert wurde. Als die Elektrode an etwa dem gleichen Punkt wieder angesetzt wurde, hörte sie deutlich eine Stimme, die «Jimmie, Jimmie» rief – Jimmie war der Name ihres Mannes, mit dem sie erst seit kurzem verheiratet war.
Eine von Penfields bedeutsamen Folgerungen war, dass die Elektrode eine einzelne Erinnerung hervorrief und nicht eine Mischung von Erinnerungen oder eine Verallgemeinerung.
Eine weitere Schlussfolgerung Penfields war, dass die Reaktion auf die elektrische Reizung unwillkürlich erfolgte:
«Unter dem zwingenden Einfluss der Sonde erschien im Bewusstsein des Patienten ein bekanntes Erlebnis, ob er nun seine Aufmerksamkeit darauf konzentrieren wollte oder nicht. Ein Lied ging ihm durch den Kopf, wahrscheinlich so, wie er es bei einer bestimmten Gelegenheit gehört hatte: Er fand sich als Teil einer bestimmten Situation, die sich entwickelte, genau wie die ursprüngliche Situation es getan hatte. Für ihn war es die Szene aus einem bekannten Stück, und er selbst war Schauspieler und das Publikum zugleich.»
Die vielleicht wichtigste Entdeckung war, dass nicht nur vergangene Ereignisse detailliert aufgezeichnet werden, sondern auch die Gefühle, die mit diesen Ereignissen verbunden waren. Ein Ereignis und das Gefühl, das von diesem Ereignis ausgelöst wurde, sind im Gehirn unauflösbar miteinander verwoben, sodass eines nicht ohne das andere hervorgerufen werden kann.
«Der Patient», schreibt Penfield, «empfindet wieder die Emotion, die ursprünglich die Situation in ihm bewirkt hatte, und er ist sich der gleichen Interpretationen bewusst, ob sie nun falsch oder richtig waren, die er zuerst auf das Erlebnis anwandte. Darum ist eine hervorgerufene Erinnerung nicht die genaue fotografische oder phonographische Reproduktion vergangener Ereignisse. Sie reproduziert das Ganze: was der Patient sah, hörte, fühlte und verstand.»
Erinnerungen werden durch die Sinnesreize aus unserer Alltagsumwelt fast ebenso hervorgerufen wie durch die elektrische Reizung mit Penfields Sonde. In beiden Fällen muss die auftauchende Erinnerung genauer als ein Wiedererleben statt als ein Wiederbeleben gesehen werden. Als Reaktion auf einen Reiz wird ein Mensch momentan in die Vergangenheit versetzt. Ich bin dort! Diese Realität kann den Bruchteil einer Sekunde oder aber viele Tage lang dauern. Nach diesem Erlebnis kann ein Mensch sich dann bewusst daran erinnern, dass er dort war. Die Reihenfolge bei der Gedächtnisarbeit ist: 1. Wiedererleben (spontanes, unwillkürliches Empfinden), 2. Wiedererinnern (bewusstes, gewolltes Nachdenken über das vergangene Ereignis, das gerade wiedererlebt wurde). An vieles, was wir wiedererleben, können wir uns nicht erinnern!
Die folgenden Berichte zweier Patienten illustrieren, wie gegenwärtig empfangene Reize vergangene Gefühle wecken.
Eine vierzigjährige Patientin berichtete, dass sie eines Morgens eine Straße entlangging und aus einem Geschäft ein paar Takte Musik hörte, die in ihr eine überwältigende Melancholie auslösten. Sie fühlte, wie sie von einer Traurigkeit übermannt wurde, die sie nicht verstehen konnte und deren Intensität «fast unerträglich» war. Mit ihren bewussten Gedanken konnte sie sich das nicht erklären. Nachdem sie mir das Gefühl beschrieben hatte, fragte ich sie, ob es etwas in ihrem früheren Leben gegeben habe, woran das Lied sie erinnerte. Sie sagte, sie könne keinen Zusammenhang zwischen dem Lied und ihrer Traurigkeit sehen. Ein paar Tage später rief sie mich an und erzählte mir, dass sie das Lied immer wieder vor sich hin gesummt hatte und dabei plötzlich von einer Erinnerung überfallen worden war, in der sie ihre Mutter am Klavier sitzen sah und hörte, wie sie dieses Lied spielte. Die Mutter war gestorben, als die Patientin fünf Jahre alt gewesen war. Damals hatte der Tod der Mutter eine tiefe Depression ausgelöst, die über einen längeren Zeitraum anhielt, obwohl ihre Angehörigen sie immer wieder dazu bringen wollten, ihre Zuneigung auf eine Tante zu übertragen, welche die Mutterrolle übernommen hatte. Die Patientin hatte sich bis zu dem Tag, an dem sie an dem Laden vorbeigegangen war, nie an das Lied erinnert oder daran, dass ihre Mutter es gespielt hatte. Ich fragte sie, ob die Erinnerung an dieses frühe Erlebnis sie von ihrer Depression befreit habe. Sie sagte, ihre Gefühle hätten dadurch eine andere Färbung bekommen. Wenn sie sich an den Tod ihrer Mutter erinnerte, hatte sie immer noch ein melancholisches Gefühl, doch sie empfand nicht mehr wie zuerst die ursprüngliche überwältigende Verzweiflung. Es sah aus, als erinnere sie sich jetzt bewusst an ein Gefühl, das anfänglich das Wiedererleben eines Gefühls war. In der zweiten Phase erinnerte sie sich, wie es gewesen war, als sie die ursprünglichen Empfindungen gehabt hatte. In der ersten Phase dagegen brach in ihr dasselbe Gefühl mit unverminderter Wucht hervor, das sie beim Tod...