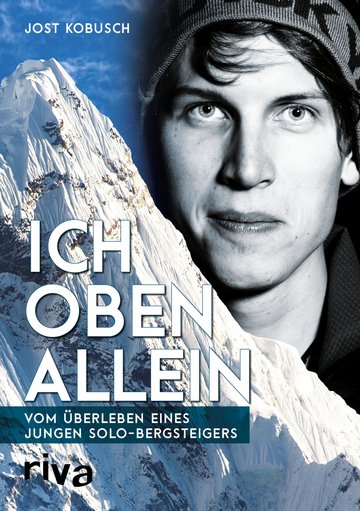2. Zukunft braucht Herkunft
Eine meiner jüngsten Kindheitserinnerungen ist, dass ich mit etwa vier Jahren auf der Arbeitsplatte unserer Küche sitze. Während mein Vater Falk mich mit guter Absicht dort hingesetzt hat, kommt meine Mutter Iris herein. Es entsteht ein Streit darüber, ob man mich dorthin setzen dürfe oder nicht. Meine Mutter reißt mich in der Hitze des Gefechts von der Arbeitsplatte, was den Streit noch weiter anfeuert. Ich habe keinerlei Erinnerung an Momente, in denen meine Eltern ein glückliches Paar waren, denn sie haben sich früh scheiden lassen. Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich bei Iris, die andere bei Falk. Doch als sich die Essstörungen meiner Mutter immer weiter zuspitzen und einen Punkt erreichen, an dem sie fast an ihnen stirbt, bleiben meine Drillingsschwester und ich bei unserem Vater. Er muss viel arbeiten, um für uns vier zu sorgen, und kommt erst am späten Nachmittag nach Hause, wo er dann meistens weiterarbeitet. Ich wachse mit Au-pair-Mädchen aus Lettland auf. Meine richtige Mutter sehe ich nur noch einmal die Woche. Mein Mutterersatz bleibt jeweils für ein Jahr, danach kommt jemand Neues. Es gibt keine Bezugsperson, auf die ich mich einstellen kann. Die Mutterliebe, die ich als Kind gebraucht hätte, kann ich von den jungen Frauen nicht bekommen. Insgesamt habe ich fünf solcher Au-pairs, bis mein Vater beschließt, das letzte Au-pair-Mädchen zu heiraten. Meine Schwestern freuen sich darüber. Aber das Einzige, was ich herausbringe, ist ein »Ach nö, nee«. Sandra ist 24 Jahre alt, als sie meinem Vater das Jawort gibt. Ich bin eifersüchtig. Zu ihrer Hochzeit frage ich sie, ob sie die Cola-Flasche für mich öffnen kann, die ich vorher kräftig durchgeschüttelt habe. Im nächsten Moment spritzt der ganze klebrige Inhalt auf das geliebte Hochzeitskleid. Heute weiß ich, dass das sehr unreif von mir gewesen ist. Ich rechne Sandra hoch an, dass sie mir diese Aktion nie nachgetragen hat. Mit der Hochzeit geht die junge Lettin eine große Verantwortung uns Kindern gegenüber ein. Ich bin bereits neun Jahre alt. Also schon etwas zu alt, um mich sofort an die Situation und die neue Stiefmutter gewöhnen zu können. Sie meint es in vielen Dingen gut, aber ich will ihre Hilfe nicht. Ich kann mit ihrer Autorität nicht umgehen und die Werte und Regeln, die sie aus ihrem Heimatland mitbringt, ergeben für mich keinen Sinn. Wir kämpfen beide um die Aufmerksamkeit und Liebe von Falk – leider ziehe ich dabei häufig den Kürzeren. Ich glaube, ich hätte damals einfach eine liebende Mutter gebraucht, die mich versteht. Iris sehe ich weiterhin einmal die Woche, doch die geringe Zeit, die wir Kinder mit ihr verbringen, verändert unser Verhältnis zueinander. Es fällt mir schwer, mich zu öffnen und jemand Neues in mein Leben zu lassen. Als Sandra mit Zwillingen schwanger wird, realisiere ich zum ersten Mal, wie weitreichend die Veränderungen sind, die die zweite Ehe meines Vaters mit sich bringt. Bereits mit zehn Jahren beginne ich, meine Wäsche selbst zu waschen. Ich kümmere mich darum, dass die Zufahrt sauber bleibt. Später gehört auch das Rasenmähen des großen Gartens zu meinen Aufgaben. Nach und nach übernehme ich weitere Aufgaben im Haus und helfe in der Werkstatt aus. Auf diese Weise verdiene ich mein Taschengeld, das alles in allem aber immer weit unter dem Durchschnitt meiner Freunde liegt. Mein Vater will damit meine Eigenständigkeit fördern, die für ihn die Voraussetzung für ein gutes Leben darstellt. Sein Motto lautet: Gib einem Armen zwei Fische und er ist für zwei Tage satt. Lehre ihn fischen und er ist es sein ganzes Leben. Viel Geld haben wir tatsächlich nicht zur Verfügung und ich leide unter der Tatsache, dass ich nicht wie die anderen Kinder in der Schule Markenklamotten tragen kann. Ich fühle mich ausgegrenzt und mein Selbstbewusstsein leidet darunter.
Zu meinem sechsten Geburtstag schenkt mir mein Vater ein Fahrrad. So wie ihm damals soll es mir ein großes Stück Freiheit eröffnen. Und so wird mein Bewegungsradius langsam größer und größer. Ich nutze das Rad nicht nur, um mir das Busgeld zu sparen, sondern auch um Pfandflaschen zu sammeln und mir etwas Geld dazu zu verdienen. In dieser Zeit entsteht mit Philipp, einem Nachbarsjungen, eine enge Freundschaft. Wir verbringen viel Zeit in den umliegenden Wäldern. Neben Philipp habe ich zwar noch andere Freunde, aber mit ihnen verbindet mich nicht so viel wie mit ihm. Wir teilen dieselben Interessen und spornen uns gegenseitig zu immer neuen Herausforderungen an: ein neuer Trick mit dem Skateboard oder ein noch höherer Sprung mit dem Fahrrad über eine selbstgebaute Sprungschanze. Trotzdem habe ich das Gefühl, nirgends wirklich dazuzugehören. Sehr oft mache ich mein eigenes Ding – und fühle mich sehr wohl damit. Zum einen empfinde ich vieles von dem, was die anderen spannend finden, als langweilig. Zum anderen fehlt mir meistens das Geld, um mit meinen Freunden etwas zu unternehmen oder essen zu gehen. Bei Schulunternehmungen stehe ich regelmäßig dumm da, wenn alle in einem Lokal sitzen und nur ich nichts esse. Kein Wunder, dass ich sehr geizig mit meinem bisschen hart verdienten Geld bin. Ich spare für materielle Dinge, zum Beispiel ein neues Fahrrad, von denen ich lange profitieren kann. Ich betrachte Ausgaben wie Investitionen, aus denen langfristig etwas Profitables hervorgehen kann.
Meinem Vater habe ich meine Eigenständigkeit und meine Einstellung zum Leben zu verdanken, aber ich spüre in seinem Verhalten auch eine gewisse Distanz – dieselbe Distanz, die er in seiner Kindheit von seinem Vater erfahren hat. Es fällt ihm schwer, mir Anerkennung oder Liebe zu zeigen, was ich als Kind nicht weiter hinterfragt habe. Wofür sollte ich auch Anerkennung bekommen? Ich bin schlecht in der Schule und habe auch sonst nichts Besonderes geleistet. Regelmäßig rufen die Lehrer bei meinen Eltern an, um sie über mein Fehlverhalten und die nicht gemachten Hausaufgaben zu informieren. Um der Realität zu entgehen, flüchte ich mich in die virtuelle Welt der Computerspiele. Meine Vorliebe gilt Spielen, in denen man fremde Welten erforscht, Gegenstände sammelt und Fähigkeiten weiterentwickelt. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man nach all der harten Arbeit wahnsinnig stark ist, die Welt erforscht hat und durch Schweiß und Blut zu einem Helden gereift ist. Die virtuelle Welt lässt mich im Gegensatz zur wirklichen Welt meine persönlichen Erfolge feiern und gibt mir das Gefühl, etwas wirklich gut zu können. Es kostet mich bis zu 175 Stunden, bis ich ein Spiel durchgespielt habe. Natürlich wirkt sich das auch auf meinen Alltag aus. Mehr und mehr kommt es mir so vor, als ob das Leben ein Computerspiel wäre. Die größten Fortschritte erzielt man, wenn man an den weniger starken Fähigkeiten arbeitet, sich seiner Schwächen bewusst wird und sich kontinuierlich verbessert und steigert. Nur so kann man Level 100 erreichen. Und gerade das ist es, was mich reizt: dieser Drang zur Perfektion. Ich beginne, diese Einstellung auf mein echtes Leben zu übertragen und komme zu dem Schluss, dass meine Höhenangst eine Schwäche ist, an der ich arbeiten muss. Irgendetwas sagt mir, dass ich diese Angst überwinden muss, damit mein Leben sich mit all seinen Chancen vollends entfalten kann.
Im Sportunterreicht war sie mir schon oft aufgefallen: die Kletterwand in der Turnhalle. Hochgetraut hatte ich mich nie, aber sie faszinierte mich. Deshalb zögere ich keine Sekunde, als ich mich in der sechsten Klasse für eine AG entscheiden muss. Ich wähle die Kletter-AG. Ein paar Wochen später stehe ich gemeinsam mit Philipp endlich vor der Kletterwand und schaue zweifelnd hinauf. Während die anderen die Kisten aufmachen und sich ihre Klettergurte anziehen, spüre ich meine steigende Nervosität. Der Karabiner an meinem Klettergurt schnappt zu und der Lehrer gibt mir das Signal, dass ich jetzt losklettern kann. Warum habe ich mich nur für die Kletter-AG entschieden? Ich beginne, meine Entscheidung zu bereuen, vor allem, als sich nach den ersten Zügen mein Kopf einschaltet und mir bewusst wird, dass Loslassen Absturz bedeuten könnte. Ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie ich auf dem Boden aufschlage. Aber ich schiebe den Gedanken schnell wieder beiseite und klettere immer höher, ich möchte unbedingt oben ankommen. Ich halte mich unnötig stark fest und verschwende viel zu viel meiner Kraft. Trotzdem komme ich zügig voran. Kurz bevor ich das Top erreiche, blicke ich nach unten und erwache wie aus einem Albtraum: Mein Puls schnellt in die Höhe, meine Atmung beschleunigt sich. In Gedanken sehe ich mich im Schwimmunterricht wieder auf dem Dreimeterbrett stehen. Ich schaue hinunter und überlege, ob ich springen soll. Ich habe schreckliche Angst vor der Höhe und dem Gefühl, zu fallen. Jedes Mal hatte ich mich umgedreht und war über die Leiter wieder zurück nach unten geklettert. Es war mir egal, was die Schulkameraden dachten. Ich konnte einfach nicht springen. Aber am Ende der sieben Meter hohen Kletterwand gibt es keine Leiter, über die ich einfach wieder absteigen kann. Ich muss den Sprung wagen, mich in den Klettergurt setzen und meinem Sicherungspartner vertrauen. Ich schließe meine Augen, lasse los und rufe: »Ab!« Mein Kletterpartner lässt mich langsam auf den Boden zugleiten, auf dem ich sanft aufkomme. Während ich unten stehe und meinen Karabiner öffne, schaue ich noch mal nach oben. Ein mächtiges Gefühl durchdringt mich. Habe ich etwa gerade für einen kurzen Moment meiner Angst in die Augen gesehen? Ja! Auch wenn ich gewissermaßen keine andere Wahl hatte, ich spüre, dass ich ein Stück daran gewachsen bin. Ich will mehr.
Von nun an gehe ich jede Woche für zwei Stunden in die Kletter-AG. Unser Lehrer, Herr Fälker, ist mit Leib und Seele dabei und versucht uns so viel wie möglich zu...