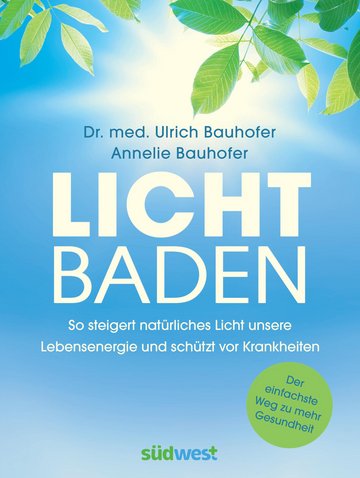Unsere innere Uhr
Lichtschalter in den Augen
„Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?“
Johann Wolfgang von Goethe
René Descartes hatte also recht mit seiner Annahme, dass es eine Verbindung zwischen den Augen und der Zirbeldrüse gibt. Das letzte Puzzleteilchen, um die Richtigkeit dieser These nachzuweisen, fanden Forscher der Brown University in Providence, Rhode Island, genau 352 Jahre nach seinem Tod. Der Neurophysiologe David Berson machte die bahnbrechende Entdeckung, indem er sich einem lang ignorierten Thema zuwendete – so bahnbrechend, dass die medizinischen Fachbücher umgeschrieben werden mussten.
Bis 2002 herrschte die Ansicht vor, in der Netzhaut unserer Augen gäbe es nur zwei Typen lichtempfindlicher Sinneszellen:
• Etwa 120 Millionen Stäbchen, die dafür optimiert sind, dass wir im Dunkeln sehen können und die bei hellem Sonnenlicht inaktiv werden.
• Und etwa 7 Millionen Zapfen, die unser Farbsehen sicherstellen. Ohne sie würden wir die Welt wie einen Schwarz-Weiß-Film wahrnehmen. Sie befinden sich hauptsächlich in der Sehgrube, dem Zentrum der Macula lutea, lateinisch für Gelber Fleck. Das ist die schärfste Stelle unseres Sehens, ein eng umschriebener Bereich im Zentrum der Netzhaut, durch den die Sehachse verläuft.
• Bei menschlichen Zapfen unterscheidet man zwischen dem S-Typ (Blau-Rezeptor), dem M-Typ (Grün-Rezeptor) und dem L-Typ (Rot-Rezeptor).
Sehen wir uns diese Sinneszellen noch etwas genauer an. Sie beherbergen Sehpigmente: Stäbchen (das Rhodopsin) und Zapfen (das Iodopsin), hochempfindliche Eiweißmoleküle, die ihre chemische Beschaffenheit verändern, sobald sie Licht empfangen – genau der Moment, der eine faszinierende Reaktionskaskade auslöst. Durch die chemische Veränderung wird das optische Lichtsignal in einen elektrischen Impuls übersetzt und an eine dritte Art Sehzellen, die sogenannten retinalen Ganglienzellen (RGCs), weitergeleitet, die spinnennetzartig über die gesamte Netzhaut verteilt sind. Die Fasern dieser Ganglienzellen, von denen man bis 2002 annahm, sie seien blind, vereinen sich zum Sehnerv. Von hier aus bahnen sich die Lichtimpulse den Weg zum Gehirn.
Allerdings stellte man fest, dass blinde Mäuse, die keine Stäbchen und Zapfen besitzen, trotzdem auf Licht reagieren. Wie konnte das sein? Lange Zeit wurde diese Frage ignoriert, obwohl die ersten Studien mit blinden Mäusen bis ins Jahr 1923 zurückreichen. Erst in den 1990er-Jahren befassten sich mehrere wissenschaftliche Untersuchungen damit, dass sich auch blinde Mäuse an Licht anpassen – also einem klaren Hell-dunkel-Rhythmus folgen. Non-Image Forming (NIF) – „Sehen ohne Bilderkennung“ – wurde erst entschlüsselt, als die Wissenschaftler auch in den retinalen Ganglienzellen ein Sehpigment identifizierten: Melanopsin.
Das menschliche Auge und seine Sinneszellen
Die Forschergruppe um David Berson fand nämlich heraus, dass die dritten „blinden“ Ganglienzellen keineswegs blind sind. Sie geben uns zwar nicht die Fähigkeit, Formen zu erkennen, aber sie registrieren minutiös die Umgebungshelligkeit und senden dementsprechende Lichtsignale weiter. In diesen ca. 1000 bis 2000 Ganglienzellen wird das Eiweißmolekül oder Sehpigment Melanopsin gebildet, das diese Zellen selbst lichtsensitiv werden lässt. Man unterscheidet Zellen, die auf „Licht an“ reagieren, und andere, die sich bei „Licht aus“ entladen. Man könnte sie also vereinfacht ausgedrückt als Lichtschalter der inneren Uhr bezeichnen. Sie schicken ihre Impulse weiter zum Nucleus suprachiasmaticus und zur Zirbeldrüse und informieren so die innere Uhr.
Licht - der große Taktgeber
Aus der ärztlichen Praxis
Immer wieder ist im Alltag von der inneren Uhr die Rede. Doch wie funktioniert sie überhaupt? Vor einigen Jahren kam Claudia Holbein, eine erfolgreiche Autorin und Vortragsrednerin, wegen Gewichtsproblemen zu mir in die Praxis. Ihr Lebensrhythmus folgte nur einer einzigen Regel – nämlich keiner. Sie aß unregelmäßig, sie schlief unregelmäßig, sie trieb unregelmäßig Sport, ihre Beziehungen waren kurz und unregelmäßig. Und auch ihr Gewicht folgte diesem gleichen Rhythmus: Sie nahm in völlig unregelmäßigen Abständen ab und wieder zu. Claudia Holbein hasste Struktur. Sie stemmte sich vehement gegen ein Grundgesetz des Lebens. Denn das Leben verläuft immer in regelmäßigen Rhythmen – Tag und Nacht, Woche, Monat, Jahreszeiten. Unser Herz schlägt in einem Rhythmus, wir atmen rhythmisch, der weibliche Zyklus folgt dem Rhythmus des Mondes.
In der Charaka Samhita, einem über 3000 Jahre alten vedischen Klassiker, steht: „Krankheiten entstehen durch den übermäßigen, den mangelnden Gebrauch oder den Missbrauch der Zeit, des Geistes und der Sinne.“ Schon vor Jahrtausenden hat man den weisen Umgang mit den zeitlichen Rhythmen der Natur richtig eingeschätzt. Missbrauchen wir heute die Zeit?
Auf einem medizinischen Kongress in der Nähe von Boston lernte ich Mitte der 1980er-Jahre mit Franz Halberg einen herausragenden Wissenschaftler kennen. Er gilt als der Mitbegründer der Chronobiologie, der Biologie der Zeit (aus dem Griechischen chronos). Es war für mich sehr bereichernd, diesem bescheidenen, freundlichen Mann zu begegnen, der augenscheinlich für seine wissenschaftliche Arbeit lebte. Nach seinem Medizinstudium in Innsbruck, wo er insbesondere die Funktion der Nebenniere studiert hatte, bekam Franz Halberg ein Forschungsstipendium der WHO für klinische Endokrinologie an der Harvard Medical School. 1949 wechselte er an die Universität von Minnesota und gründete dort seine Chronobiology Laboratories. Hier prägte er in den späten 1960er-Jahren den Begriff „zirkadianer Rhythmus“. Das eingedeutschte Wort „zirkadian“ wird von den lateinischen Begriffen circa und dies abgeleitet und bedeutet „ungefähr einen Tag“. Der zirkadiane Rhythmus ist die Fähigkeit eines Körpers, innere Vorgänge auf eine Periode von etwa 24 Stunden zu synchronisieren. Maß nimmt der Organismus dabei am Tag-Nacht-Zyklus, der sich im 24-Stunden-Takt mit einer Erdumdrehung gleichschaltet.
Halberg forschte darüber hinaus an vielen anderen wiederkehrenden Mustern, z. B. an wöchentlichen, monatlichen, jährlichen Zyklen oder Solarrhythmen. Er konzentrierte sich dabei besonders auf den Zusammenhang zwischen zeitlichen Perioden und dem Auftreten bestimmter Krankheiten.
Die Chronobiologie ist eine vergleichsweise junge Disziplin, die erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts in den wissenschaftlichen Fokus rückte. Das Fesselnde an ihr ist die Entdeckung der inneren Uhr, die für das hochkomplexe Zeitmanagement unserer Vitalfunktionen verantwortlich ist. Neben Franz Halberg gelten besonders Colin Pittendrigh von der Princeton University und Jürgen Aschoff vom Max-Planck-Institut Seewiesen als „Väter“ der inneren Uhr.
Sie erinnern sich an den Weg, den sich Lichtsignale durch das Gehirn zur Zirbeldrüse bahnen? Dabei passieren sie den Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus. Dieser kleine, stecknadelgroße Kern gilt als Sitz der inneren Uhr – wenn wir genau sind: der Master Clock. Denn eigentlich haben wir nicht eine, sondern viele innere Uhren, die nachgeordneten Post Clocks, in jeder Zelle sowie in jedem Or-gan oder Organsystem. Gregor Eichele vom Max-Planck-Institut Göttingen drückt es noch deutlicher aus und scherzt, dass wir über einen regelrechten Uhrenladen verfügen würden.
Die Master Clock ist, um es in einem Bild auszudrücken, der Dirigent des Orchesters unserer Körperfunktionen. Sie gibt jeder Post Clock sehr präzise ihren Einsatz und legt fest, wann welches Organ aktiv zu werden hat oder regenerieren soll. So schwingt sie den Taktstock zum harmonischen Zusammenspiel aller Zellen, Organe und Organsysteme. Damit unsere inneren Uhren aber alle gleich gehen, müssen sie synchronisiert werden, deshalb ist die Master Clock auf den 24-Stunden-hell-dunkel-Zyklus geeicht und hält das gesamte System stabil.
Der große Dirigent Herbert von Karajan ist einmal gefragt worden, was das Geheimnis seines Erfolgs sei. Er antwortete, er störe die Musik nicht. Was unsere Rund-um-die-Uhr-Gesellschaften tagtäglich tun, entspricht diesem Bild: Wir stören die Musik der inneren Uhr.
Vielleicht wird das Verständnis, wie groß unsere Disharmonie bereits geworden ist, klarer, wenn wir uns den filigranen, hochkomplexen Mechanismus vergegenwärtigen, mit dem die Master Clock arbeitet. Sie steuert unsere Biorhythmik mit dem Präzisionsinstrument Zirbeldrüse, das schon auf geringfügig veränderte Lichtsignale unmittelbar reagiert. Das Pinealorgan gibt seinen Botenstoff Melatonin in winzigen Mengen (Picogramm) in die Blutbahn ab, was man durchaus als Feintuning bezeichnen kann. Bei der Zelle angekommen, dringt das Hormon durch die Membran ein und teilt der Zelle mit, welche Stunde geschlagen hat. Dieses orchestrale Zeitmanagement teilt zu bestimmten Tages- oder Nachtzeiten den Organen ganz unterschiedliche Aufgaben zu. Wenn Melatonin ansteigt, werden wir müde und gehen zu Bett. Unser inneres Timing drosselt dann die Körperkerntemperatur, deshalb ist es sehr wichtig, nicht in überhitzten Räumen zu schlafen. Es senkt unseren Blutdruck, der Atem wird flacher, Leistungskurve und Konzentrationsfähigkeit werden nach unten gefahren und Reparatur- und Erholungsprogramme eingeleitet. Gegen Morgen dreht sich dieser Prozess um, die...