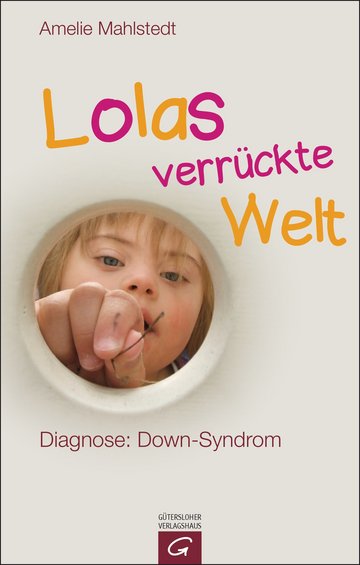Aller Anfang
Der Anfang. Jedes Buch beginnt mit dem Anfang. Es sei denn, man springt in der Zeit. Warum wird dem Anfang, der Diagnose Down-Syndrom, immer eine solche Bedeutung beigemessen? Dieser eine Moment, der alles ändert. Glaubt man zumindest. Am Ende ist es doch gar nicht so anders.
Was sehe ich, wenn ich an den ersten Tag denke? Fetzen, die sich immer wieder neu zusammenfügen.
Greta, mit der blauen Mütze und ihrer Puppe Elli in der Hand. Wie sie mich anschaut, mitten in der Nacht, auf Annettes Arm. Mit Augen, die nichts verstehen von dem, was mit ihr passiert, und doch alles wissen. Sie kennt Annette, ihre Tagesmutter. Gleich wird sie weiterschlafen, in dem Bett, in dem sie sonst ihren Mittagsschlaf hält. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Die Kirchturmuhr schlägt zwölf. Ich steige wieder ins Taxi, Annette winkt, Greta guckt. Jetzt habe ich Zeit für dich. Lola. Wenn du kommen willst, komm nur.
Eine Dreiviertelstunde später liegt sie zwischen meinen Beinen. Mit glatter rosa Haut, aufgeblähtem Bauch und schwarzen Haaren. Dabei wollten die Schwestern nur ein CTG messen, im Vorzimmer. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich aufs Klo muss. Da wusste die Schwester Bescheid, dass das Kind schon im Geburtskanal liegt. Und nach der nächsten Wehe rann mir Fruchtwasser und Blut die Beine hinab. »Pressen«, kommandierte die Schwester. »Nicht schreien. Alle Kraft ins Pressen.« Drei Wehen später glitt mir das Bündel zwischen die Beine, mit breitem Gesicht und kurzen Ärmchen. Seltsam, dachte ich. Das ist also Lola. Ricardo strahlte.
In gestärkte Tücher eingepackt überreichten sie mir die Schwestern einige Minuten später. Greta war im Geburtshaus zur Welt gekommen. Bei Kerzenschein. Eine Stunde hatte die Nabelschnur auspulsiert, nackt hatte sie zwei Stunden auf meinem Bauch liegen dürfen. Durch die vielen Tücher hindurch, konnte ich Lola kaum spüren. Ich versuchte, einen Blick zu erhaschen, auf ihr Gesicht, in ihre Augen. Einen Augenblick nur öffnete sie sie, und es kam mir vor, als würde sie schielen.
Dann mussten wir warten. Lola wurde untersucht und vermessen. »Ihre Augen sind so ähnlich wie meine, als ich Baby war. Ganz mandelförmig«, sagte ich. Und dachte, dass sie wohl eine nicht ganz so vorteilhafte Mischung unserer Gene erwischt hatte.
»Ich finde, sie sieht süß aus. Ganz wie du«, sagte Ricardo.
Die Uhr zeigte zehn nach eins. Vor einer guten Stunde hatten wir Greta bei Annette am Nordplatz abgegeben. Vor einer halben Stunde hatte ich ein Kind geboren. Ich trug dasselbe Kleid, mit dem ich am Montag meine Doktorarbeit verteidigt hatte. Heute war Samstag.
»Lola kam um 0:39 Uhr auf die Welt gerannt. Pumperlgsund und wohlauf«, schrieb ich und schickte die SMS an Annette, an meine Freundin Anna und an meine Mutter. Mit Anna hatte ich gegen acht telefoniert, als ich meine Wehen noch für Senkwehen hielt. Als ich kurz danach mit meiner Mutter sprach, waren daraus schon Geburtswehen geworden. Und meine Eltern zu Bett gegangen, um morgen früh von Wuppertal nach Leipzig zu fahren.
Gleich würden wir unser Bündel in die Arme gelegt bekommen. Und zu uns nach Hause fahren. Eine ambulante Geburt. Lola, mit schwarzem Haar und rosigem Gesicht, in meinem Arm. Morgen früh Blumen und Gratulanten. Sonne selbstverständlich.
Die Uhr zeigte zwei. Wir warteten noch immer.
Eine der beiden Schwestern, die auch bei der Geburt da gewesen war, betrat das Zimmer. Sie war höchstens 19. Eifrig wie ein Schulmädchen räumte sie das CTG auf und machte einige Notizen. Ihr Gesicht hatte einen kindlichen Ausdruck.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Sie untersuchen sie noch. Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte sie.
Da betrat auch die andere Schwester, deutlich älter, den Raum.
»Dauert es noch lange? Wann kann ich meine Tochter endlich wiederhaben?«, fragte ich.
»Wissen Sie, es dauert noch einen Moment. Weil ...«, sie zögerte. »Ihre Tochter hat eine Vierfingerfurche an einer Hand. Das ist so eine durchgehende Linie auf der Handfläche. Und ihre Augenachse ist etwas schräg. Das findet man auch bei Kindern mit Trisomie 21. Deswegen müssen sie sie noch untersuchen.«
Ich nickte. »Als ich klein war, hatte ich auch so mongoloide Augen. Das hat sie von mir.« Die Arme, dachte ich im Stillen.
Die Schwestern guckten interessiert. »Unsere Oberärztin hat auch eine Vierfingerfurche. Das kommt manchmal vor«, sagte die Ältere. »Bestimmt ist alles in Ordnung.«
»Bestimmt«, sagte ich. »Haben Sie schon einmal ein Kind mit Trisomie 21 auf die Welt gebracht?«
»Seit 35 Jahren arbeite ich als Hebamme, und noch nie ist bei mir ein mongoloides Kind geboren worden. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist bestimmt nur ein Zufall.« Sie lächelte und verließ den Raum.
Ich musste an meine Freundin Dorothea denken, wie sie von den »Mongölchen« sprach. Wenn sie ein Kind wollte, dann ein »Mongölchen«, weil die einen immer lieb haben. Ich musste bei dem Ausdruck an Monchichis denken, diese kleinen Kuschelfiguren mit den strubbeligen braunen Haaren und dieser Mischung aus Affen- und Kindergesicht. Eine ganze Sammlung davon hatte ich als Kind.
Die arme Lola, sie hatte wirklich eine ungünstige Kombination unserer Gene erwischt. Und ich erzählte Ricardo auf Spanisch, dass man Lola noch untersuchen müsse. Sein Deutsch war zu schlecht, um die Unterhaltung verstanden zu haben. Vom Verdacht auf Trisomie 21 erzählte ich nichts. Bestimmt war nichts dran.
Und wir warteten.
Ricardo saß auf dem Sofa in der Ecke des Raumes, hatte die Beine übereinandergeschlagen und wippte mit dem rechten Fuß. Ich dachte an Lola und daran, wie sich ihre Haut gleich anfühlen würde, auf meiner. Im Familienzimmer. Bestimmt würden sie uns heute Nacht nicht gehen lassen wollen, so spät noch.
Es war kurz nach drei, als die ältere Schwester zu uns trat. Ihre Augen waren starrer als zuvor, ihre Lippen leicht zusammengekniffen. Als sie sprach, blickte sie mich nicht an.
»Wir haben Ihre Tochter in ein Wärmebett gelegt. Sie war etwas blau. Die Ursache dafür ist unklar. Der kinderärztliche Notdienst kommt gleich.«
Lola, blau? Wo denn? Ich wollte sie im Arm halten. Jetzt sofort. »Ich kann sie auch auf meinem Arm wärmen«, sagte ich.
»Ihre Sauerstoffversorgung ist unzureichend. Wir müssen ihre Werte kontrollieren.« Ihr Blick hatte sich verändert. Ihre Stimme war bestimmter geworden.
»Legen Sie sich schlafen mit Ihrem Mann. Die Schwester wird Ihnen das Familienzimmer herrichten. Ihre Tochter ist bei uns in besten Händen.« Ihre Lippen formten ein Lächeln, und sie verschwand.
Kurz darauf kam die junge Schwester und führte uns zu unserem Zimmer. Vorbei an einem kleinen Kämmerchen. Darin lag Lola. In einem gläsernen Wagen. Im Neonlicht. Die Arme weit ausgebreitet. Neben ihr ein blinkender Apparat. Ich blieb stehen und schaute sie an. Das kleine Näschen. Die zarten Lider. Wie friedlich sie aussah. Ich traute mich nicht, sie anzufassen.
Das Familienzimmer war in sattem Gelb gestrichen und sah fast aus wie ein Hotelzimmer. Neben dem Bett hing eine geflochtene Wiege an Seilen von der Decke. Um unser Kind in den Schlaf zu wiegen. Unser Kind, das draußen lag, im Kämmerchen. Im Neonlicht. Allein. Der Schrank voller Babywindeln und Strampler. Auf dem Gang der Schrei eines Neugeborenen. Es war nicht unser Kind.
Ricardo ließ sich auf das Bett fallen und schlief ein, ohne ein Wort zu sagen. Ich musste an Lolas Näschen denken. Und an ihre Augen.
Es klopfte. Eine junge Frau kam herein, in Jeans und mit rotem Rollkragenpullover. Der kinderärztliche Notdienst. Sie war etwa so alt wie ich, sehr sympathisch, aber eine Ärztin hatte ich mir anders vorgestellt. Sie würde Lola jetzt untersuchen. Ob schon vor der Geburt irgendetwas aufgefallen sei. Ich erzählte von den niedrigen Herztönen und dass sie sehr klein gewesen sei. Und vom wenigen Fruchtwasser, weswegen man mich zur Geburt in die Klinik geschickt hatte. Wegen möglicher Anpassungsstörungen. Die junge Frau nickte und ging.
Anpassungsstörungen, dachte ich. Lola war vorhin gar nicht blau gewesen. Ich verstand nicht. Und musste wieder an ihre Augen denken, die mich schräg angeschaut hatten. Das Bild verschwamm. Ich hatte nicht genug Zeit gehabt, sie anzusehen. Als Greta damals nach ihrer Geburt auf meinem Bauch lag, hatte Ricardo sie angeblickt, mit diesem Strahlen in seinen Augen, demselben wie in der ersten Zeit unserer Liebe. Für diesen ersten Blick auf Lola hatten wir keine Zeit gehabt.
Klopfen an der Tür. Wieder die junge Frau im roten Pullover. Sie schaute mich an, anders als zuvor, unsicher. »Wir wissen nicht genau, was ihre Tochter hat. Es könnte eine bakterielle Infektion sein – oder«, sie schluckte, »ein Herzfehler. Um das abklären zu können, muss sie in eine Kinderklinik.« Ich nickte. Und spürte mein Herz schlagen.
»Wir rufen jetzt die Ambulanz. Sie können sich ausruhen«, sagte sie und sah sehr sachlich dabei aus. In meinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Gretas Mütze und ihre wissenden Augen, Lola zwischen meinen Beinen, ihre schrägen Augen und ihre Haut, die so gar nicht blau war, der ernste Blick der Schwester. Abklären, Herzfehler, Ambulanz. Und dieser unsichere Blick der Ärztin im roten Pullover. Ricardo schlief. Ich war alleine. Und wartete.
Stimmen auf dem Gang. Männerstimmen. Das mussten sie sein. Ich stand auf. Mein Körper erinnerte mich daran, dass ich vor etwa vier Stunden ein Kind geboren hatte. Ich tastete mich an der Wand...