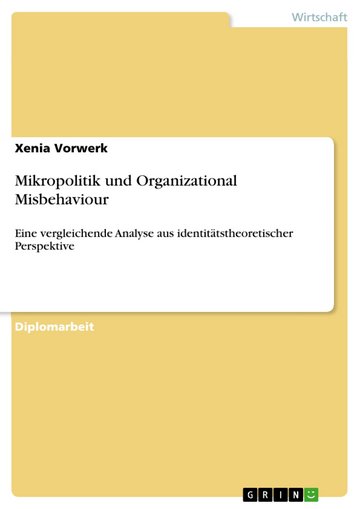Der Begriff ‚Identität’ wurde in der Vergangenheit aus den verschiedensten Perspektiven[3] und in den unterschiedlichsten Disziplinen analysiert. So zum Beispiel in der Politologie, Ethnologie[4], Philosophie, Psychologie[5] und Soziologie. Es gibt demnach keine allgemein gültige Definition des Begriffs der Identität. Die bedeutsamsten Impulse für die Identitätsforschung lieferte jedoch der ‚symbolische Interaktionismus’, eine Nebenrichtung der Soziologie und Sozialpsychologie, dessen Begründer G. H. Mead (1980) war.
Die Identitätsdiskussion basiert hier auf dem Problem, wie in Anbetracht umfassender gesellschaftlicher Determinationen eine Person Individualität, Persönlichkeit oder, anders ausgedrückt, individuelle Identität entwickeln kann (vgl. Neuberger, 2002, 372). Es werden Fragen gestellt, wie „Was für ein Mensch ist das?“ und “ Wie ist jemand zu dem Menschen geworden, der er ist?“ (Felsch, 1998, 103).
Müller (1981, 61 f.) sieht die individuelle Identität als Integrationsmechanismus, der eintritt, wenn „der Mensch sich selber als selbstbestimmtes Wesen nicht mehr vorfindet, sondern sich psychologisch in seiner Umwelt auflöst resp. seine Integration nicht mehr zu gewährleisten vermag“. Er beschreibt Identität mit Hilfe der Definition von Döbert et al. (1980, 9): „Identität ist das durch die menschliche Fähigkeit der Reflexivität ermöglichte und durch die soziale Interaktion geprägte individuelle Konzept der eigenen Existenz als Voraussetzung der Lebensgestaltung, eine symbolische Struktur, die es dem Menschen erlaubt, im Wechsel der biographischen Zustände und über die verschiedenen Positionen im sozialen Raum hinweg Kontinuität und Konsistenz zu sichern“.
In den Sozialwissenschaften ist der Begriff der Identität mit G. H. Mead in Beziehung zu setzen. Meads Werk (1980) „Geist, Identität und Gesellschaft“[6] gilt als Klassiker der Sozialpsychologie. Mead beschäftigt sich mit dem Thema Identität bzw. Selbst[7] basierend auf einer behavioristischen[8] sozialpsychologischen Sichtweise, unter der er versucht, das entscheidende Problem der Identität zu lösen. Dieses ist für ihn die Frage, „wie ein Einzelner (erfahrungsgemäß) so aus sich heraustreten [kann], dass er für sich selbst zum Objekt wird?“ (ebd. 180). Meads Hauptaugenmerk liegt auf der Bildung und Entwicklung von Bewusstsein, Identität und Kompetenz des Individuums in der sozialen Konstitution, d. h. in und durch vernetzte/n Handlungen von Menschen, die auf die Lösung eines gemeinsamen Problems abzielen (vgl. Felsch 1996, 136).
Die durch sein Werk erbrachte Leistung ist diejenige, „dass sich die Genese des menschlichen Selbst durch das Medium symbolisch vermittelter Interaktionen vollzieht“ (Gugutzer, 2002, 33). Aus dem Zusammenwirken zweier Dimensionen – der gesellschaftlichen und der individuellen Dimension – (‚ICH’ und ‚Ich’) ergibt sich die Identität eines Akteurs, welche sich in sozialen, insbesondere sprachlich vermittelten Interaktionen vollzieht.[9]
Mead (1980) setzt die Entwicklung von Identität mit der Entwicklung der Persönlichkeit gleich. Seine Überlegungen zur Persönlichkeitsentwicklung und zum Verstehen des menschlichen Denkens haben ihren Ursprung in einer Person-Umwelt-Interaktion. Die Entfaltung der Persönlichkeit versteht er als Ergebnis dieser Person-Umwelt-Interaktion (vgl. Felsch, 1996, 136), denn Identität kann nur im sozialen Kontext entstehen: Identität erwächst binnen eines gesellschaftlichen Erfahrungs- und Tätigkeitsprozesses, stellt also ein Bindeglied zwischen Akteur und Gesellschaft dar (vgl. Mead, 1980, 177). Der Sprachprozess ist ein maßgeblicher Bestandteil der Identitätsentwicklung (vgl. ebd. 177). Indem der Akteur auf sich selbst reagiert, tritt Identität auf. Nur in der Sprache, so Mead, kann ein Individuum „sich selbst zum Objekt“ werden und er wird erst dann eine Identität erlangen können, wenn er „sich selbst zum Objekt“ (ebd. 184) geworden ist. Damit ist die Kommunikation entscheidend für den Entwicklungsprozess der Identität, denn ihre Anwendung ermöglicht es dem Individuum, auf sich selbst zu reagieren (vgl. ebd.): Der Akteur wird sich selbst zum Objekt, indem er auch (aus der Haltung der anderen) zu sich selbst spricht (vgl. Felsch, 1996, 137). Dies erfolgt durch Reflektieren und Denken. Die Sprache ist zentrales System signifikanter Symbole, welche die Grundlage des menschlichen Bewusstseins und der Fähigkeit zum reflektiv-intelligenten Handeln bildet (vgl. Müller, 1981, 62). Es wird eine Antwort auf die vorangestellte zentrale Frage zur Identitätsentwicklung[10] ermöglicht: Der Akteur tritt erfahrungsgemäß aus sich heraus, indem er „die Haltungen anderer Individuen gegenüber sich selbst innerhalb einer gesellschaftlichen Umwelt oder eines Erfahrungs- und Verhaltenskontextes einnimmt, in den er ebenso wie die anderen eingeschaltet ist“ (Mead, 1980, 180).
Laut Mead (1980) erwächst die Identität bzw. die Persönlichkeit eines Akteurs, das Selbst, aus zwei Phasen der Erfahrung. Diese bezeichnet er kurz mit ‚ICH’ und ‚Ich’[11]. Identität ist ein „gesellschaftlicher Prozess“ (ebd. 221). Sie entfaltet sich aus dem „Zusammenspiel von Sich-selbst-als-Objekt- Erfahren [‚ICH’] und Sich-selbst-als-handelndes-Subjekt-Erleben [‚Ich’]“ (Felsch, 1996, 139; Felsch, 1998, 104). Die beiden Phasen, die es im Folgenden zu unterscheiden gilt, laufen im Prozess der Identitätsbildung getrennt ab, stellen aber Teile eines Ganzen dar (vgl. Mead, 1980, 221). Die Identität eines Akteurs wird durch die Übernahme der Haltungen anderer Akteure, die zu seiner gesellschaftlichen Gruppe gehören, und durch die sich daraus ergebende Beeinflussung des eigenen Verhaltens entwickelt. Während er die Haltungen der anderen übernimmt, läuft der Teilprozess des ‚ICH’ ab. Der Teilprozess ‚Ich’ ist die Reaktion des Individuums auf die übernommenen Einstellungen.
Das ‚ICH’ verkörpert Erwartungen und Reaktionen, die erlernten sozialen Rollen sowie die für das Selbstwertgefühl relevante Anerkennung der Interaktionspartner (vgl. Hillmann, 1994, 350). Hat sich ein Akteur die Haltungen seiner organisierten Gruppe einverleibt, so kennt er die Wünsche der Mitglieder und die Reaktionen auf jede seiner Handlungen. Das ‚ICH’ wird durch das Vorhandensein dieser Anschauungen der Gruppenmitglieder bestimmt, auf welches das ‚Ich’ reagiert (vgl. Mead, 1980, 218). Identität „(hat) der Einzelne… nur im Bezug zu den Identitäten anderer Mitglieder seiner gesellschaftlichen Gruppe. Die Struktur seiner Identität drückt die allgemeinen Verhaltensmuster seiner gesellschaftlichen Gruppe aus, genauso wie sie die Struktur der Identität jedes anderen Mitglieds dieser gesellschaftlichen Gruppe ausdrückt“ (ebd. 206). Das ‚ICH’ ist daher durch die Haltungen anderer organisiert. Es repräsentiert „die eher bestimmte, festgelegte, erinnernde Seite des Selbst“ (Felsch, 1996, 140; vgl. Mead, 1980, 218 ff.). Im Teilprozess ‚ICH’ wird auf Ansprüche, Forderungen und Pflichten der Gesellschaft eingegangen (vgl. Mead, 1980, 219). Er ist der konventionelle, gewohnheitsmäßige, soziale Teil der Identität (vgl. ebd. 241). In ihm tritt gesellschaftliche Kontrolle zum Vorschein, indem er indirekt auf das impulsive Verhalten des ‚Ich’, auf dessen Richtung und Ausmaß, einwirkt (vgl. ebd. 254).
Im zweiten Teilprozess der Identitätsbildung, dem ‚Ich’, wird auf eine gesellschaftliche Situation, die in der Erfahrung des Individuums liegt, reagiert. „Es ist die Antwort des Einzelnen auf die Haltungen der anderen ihm gegenüber, wenn er seine Haltung ihnen gegenüber einnimmt“ (Mead, 1980, 221). Das ‚Ich’ tritt in die Erfahrung eines Individuums erst ein, nachdem eine Handlung verwirklicht wurde (vgl. ebd. 219). Es entfaltet sich mit der Sozialisation. Es ist eine historische Figur, die in der eigenen Erfahrung direkt auftritt, denn das ‚Ich’ präsentiert sich stets in der Erinnerung (vgl. ebd. 217). Es bezieht sich auf die Einmaligkeit des Individuums (vgl. Hillmann, 1994, 350). Im Gegensatz zum ‚ICH’ ist das ‚Ich’ die individuelle, spontane, kreative, aktive und vor allem unbewusste Seite des Selbst (vgl. Felsch, 1996, 140; Gugutzer, 2002, 33). Es ist nicht möglich, das Verhalten des ‚Ich’ im Voraus zu bestimmen. „Die Reaktion auf eine Situation, so wie sie in seiner unmittelbaren Erfahrung aufscheint, ist unbestimmt – und das macht das ‚Ich’ aus“ (Mead, 1980, 219). Das ‚Ich’ produziert das „Gefühl der Freiheit, der Initiative“ (ebd. 221): Es ist eine Situation gegeben, auf die der Akteur reagieren kann. Er ist sich seiner selbst und der Situation bewusst. Sein Verhalten in einer Situation ist jedoch niemals vollkommen absehbar (vgl. ebd. 220) oder „berechenbar“ (ebd. 221) und auf keinen Fall schon gegeben (vgl. ebd. 219). Der hohe Wert des ‚Ich’ ist der, dass er die Möglichkeit bietet, Ideen und neue Lösungen für Probleme...