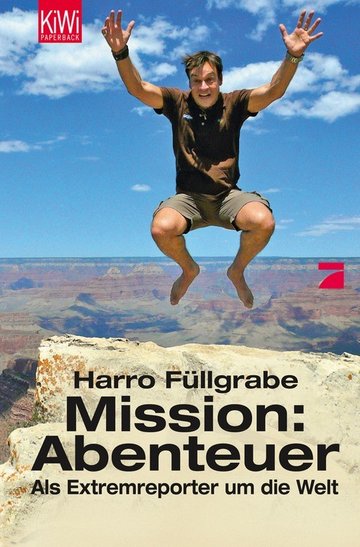Eines meiner beeindruckendsten Abenteuer beginnt um halb vier Uhr morgens mit dem Klingeln des Weckers. Vor dem Hotel in Lima wartet Andres Lares. Er will mit uns hinauf in die Anden fahren. Auf der Fahrt stockt der Motor immer wieder und spuckt schwarze Rauchwolken aus, aber er hält durch und nach vier Stunden erreichen wir unser Ziel, die Passstraße Abra de Anticona im südlichen Andenhochland, auf einer Höhe von 4818 Metern. Hier verläuft auch die Trasse der Peruanischen Zentralbahn, der höchsten Eisenbahnlinie der Welt. Steif und müde klettern wir aus dem Wagen und folgen Andres zu einer kleinen Gruppe wartender Männer.
Carlos, Lucio und Jaime sind mit einem anderen Wagen gekommen und begrüßen uns herzlich. Zusammen mit Andres sind hier jetzt zwei »Danzantes de Tijeras« (Scherentänzer) und zwei Musiker versammelt. Andres spielt die Geige, Jaime die Harfe, Carlos und Lucio werden tanzen. Die »Danza de Tijeras« ist ein Schamanentanz, bei dem die Tänzer mit einer Art Schere in den Händen zum Rhythmus der Musik klappern.
An einem See, von hohen, schneebedeckten Gipfeln umgeben, finden wir den idealen Ort für die Filmaufnahmen. Jetzt kann es losgehen. Carlos, der als »Danzante« den Künstlernamen »Llaspa« trägt, soll mich in die Hintergründe des sagenumwobenen Tanzes einführen, dessen Ursprünge weit in der Vergangenheit liegen. Schon zu Zeiten der Inkas sind Scherentänzer durch die Anden gezogen und haben mit ihren Ritualen die Götter der Berge, des Himmels und von Mutter Erde um ihre Unterstützung gebeten.
Carlos und Lucio ziehen sich um und stellen sich in ihren traditionellen Gewändern an den Straßenrand. Auch die beiden Musiker, Andres und Jaime, streifen ihre Ponchos über. In ihren weißen Kostümen, die mit knallbunten Stickmustern, Kordeln und Pailletten versehen sind, fallen sie in der kargen Hochanden-Landschaft sofort auf. Alle, die an dieser kleinen Truppe vorbeifahren, hupen ihnen freundlich zu, winken oder halten sogar an, um ein Foto mit ihnen zu machen. Bis heute genießen die Scherentänzer höchstes Ansehen in der Bevölkerung – sie sind richtige Heilige.
Nachdem wir die Begrüßungsszene abgedreht haben, reicht mir Llaspa ein buntes Tuch, welches er in landestypischer Weise zusammengeschnürt hat: als traditionellen Tragebeutel, einem Rucksack nicht unähnlich, in welchem die Opfergaben für die Götter transportiert werden. Wir marschieren los, immer in Richtung der schneebedeckten Berggipfel, die steil vor uns in den klaren blauen Himmel ragen. Andres geht mit seiner Geige voraus, gefolgt von Llaspa, dann komme ich, nach mir Lucio, der andere Tänzer, und Jaime, der seine mannsgroße Harfe mitschleppt. Wir klettern auf über 5000 Meter Höhe und bereits nach kurzer Zeit hechle ich wie ein Mops mit Asthma. Der Kameramann trägt keuchend die knapp 14 Kilogramm schwere Kamera und macht immer wieder halt, um Bilder von unserer kleinen Karawane zu machen.
Schließlich gibt Carlos ein Zeichen und bittet uns, stehen zu bleiben. Nun gilt es, den idealen Ort für die Opferzeremonie zu finden. Diese muss an einem Fels stattfinden, es soll jedoch keine große Erhöhung sein, da man den Göttern seine Unterwürfigkeit zeigen will und sich nicht mit ihnen auf eine Stufe stellen darf. Nur so seien die Götter einem gewogen. Als die perfekte Stelle gefunden ist, darf ich meinen Rucksack abstellen und die Opfergaben ausbreiten: eine flache Lehmschüssel, in der das rituelle Feuer entzündet werden soll, eine Mischung aus verschiedenen Kräutern, Duftholzspänen und weihrauchartigen Harzen, außerdem einige größere Holzscheite, deren Duft an Räucherstäbchen erinnert. Und zu guter Letzt noch eine große Flasche mit verdammt starkem Zuckerrohrschnaps und eine Flasche Wein, filterlose Inka-Zigaretten und selbstverständlich jede Menge Kokablätter.
Nachdem er einen Becher mit dem Zuckerrohrschnaps gefüllt hat, taucht Carlos alias Llaspa seinen Finger hinein und schnippt ein paar Tropfen in jede Himmelsrichtung. Das sei für die Götter, sagt er und kippt einen Teil des Schnapses auf den Boden: »Das ist für Mutter Erde!« Er verneigt sich vor der bedrohlich wirkenden Kulisse der Berge und trinkt den Rest. Dann füllt er den Becher erneut, reicht ihn hinüber und bedeutet mir, es ihm gleichzutun. Als ich zum Trinken ansetze, spüre ich schon an dem intensiven Duft des Zuckerrohrschnapses, dass das jetzt wirklich hart wird. Ich kippe, schlucke – und ringe hustend nach Luft. Junge, das Zeug ist wirklich stark! Ich habe das Gefühl, dass mir der Alkohol sofort in den Kopf steigt. Die dünne Luft macht die Sache nicht besser. Das Opfer wird noch drei Mal vollzogen. Und obwohl ich aufpasse und die Menge sehr vorsichtig dosiere, spüre ich die unheimliche Wirkung dieses Opfertrankes: Meine Sicht ist vernebelt, ich torkle, als ich den Becher weitergeben will, und muss grundlos grinsen. Die Redakteurin und der Kameramann raten mir, nicht so viel von diesem Teufelszeug zu trinken, aber was soll ich machen? Hier heißt es ganz oder gar nicht! Entweder ich werde wirklich Teil dieses Schamanenkults oder ich kratze nur an der Oberfläche. Ich mache weiter!
Nun soll ich meine Hände zu einer Schüssel geformt vor mir halten, denn Llaspa schüttet mir einige Kokablätter hinein. Er liest mir die Zukunft aus den in meinen Händen liegenden Blättern. Sein Mienenspiel scheint zu besagen, dass bei mir so weit alles ganz gut aussieht.
Die Kokablätter haben eine dunkelgrüne Oberseite und eine etwas hellere Unterseite. Liegen die Blätter überwiegend mit ihrer dunklen Seite nach oben in den offenen Händen, ist das ein gutes Zeichen. Sind jedoch mehr helle Unterseiten zu sehen, sieht die Sache anders aus. Außerdem gibt es da noch so etwas wie Lebenslinien und Schicksalslinien. Das habe ich aber alles nicht mehr so richtig verstanden, denn kurz danach muss wieder ein Alkoholopfer erbracht werden – mein mittlerweile viertes.
Als Nächstes stopfen wir uns die Kokablätter in den Mund und zerkauen sie, schlucken darf man sie allerdings nicht. Nachdem die Blätter zu einer Art Brei zerkaut worden sind, werden sie in eine Backentasche geschoben und dort immer wieder mit Speichel vermischt. Der Speichel sorgt dafür, dass die Wirkstoffe der Pflanze herausgespült und aktiviert werden: Nach einer Weile bewirken sie, dass man Hunger, Müdigkeit und Kälte nicht mehr empfindet.
Außerdem bemerke ich nach einer gewissen Zeit eine leichte Taubheit in Zahnfleisch und Zunge, so wie nach einem Zahnarztbesuch, wenn die Betäubung noch anhält. Getrocknete Kokablätter sollen sehr wirksam gegen die Höhenkrankheit sein, da sie die Sauerstoffaufnahme verbessern. Aus all diesen Gründen werden sie schon seit mehr als 5000 Jahren genutzt.
Dann kommen die filterlosen Inka-Zigaretten ins Spiel. Wie bei einer Friedenspfeife stoßen wir den Rauch in alle vier Himmelsrichtungen und anschließend in Richtung Boden. Für die Götter und für Mutter Erde! Auch an dieses Ritual schließt sich wieder ein Alkoholopfer an. Llaspa beginnt zu lallen, und auch ich bin nicht mehr ganz Herr meiner Sinne. Ich muss jetzt höllisch aufpassen, denn die Arbeit ist noch längst nicht erledigt.
Das Feuer zu Ehren der Götter wird entzündet. Als in der Lehmschale das Duftholz und die Kräuter-Harz-Mischung zu glimmen beginnen, entwickelt sich nach und nach dichter Rauch, der aus der Schüssel in den Himmel steigt. Er duftet angenehm süßlich und soll die Götter und Mutter Erde besänftigen. Jetzt ist das Kokaopfer fällig: Wir spucken die grüne Kokamasse in unsere Hände und werfen sie dann in die Schüssel, die jeder in beide Hände nehmen muss, um den Rauch in alle Himmelsrichtungen steigen zu lassen. Dabei soll der Götter gedacht werden. Nur so kann man sich ihrer Unterstützung sicher sein. Als wir den Topf wieder auf den Boden setzen, steigt der Rauch trotz oder gerade wegen des nun aufkommenden Windes in Richtung der Berge auf. Ein gutes Zeichen! Die Götter sind auf unserer Seite!
Nach einem erneuten Alkoholopfer gräbt Llaspa unmittelbar unter dem großen Felsen mit seiner Schere ein Loch in den Boden, um den letzten Opferritus vorzubereiten. Wir haben kurz zuvor aus dem großen Haufen Kokablätter die schönsten und saubersten herausgesucht. Sie dürfen nicht beschädigt sein und auch sonst keinen Makel aufweisen: Vollkommenheit ist hier verlangt. So manches Blatt, das ich zu Beginn für würdig befunden habe, findet keine Gnade vor den Experten und wird wieder aussortiert. Nach einiger Zeit aber habe ich es raus und kann mich an dem Auswahlverfahren beteiligen.
Als wir zwölf perfekte Blätter bestimmt haben, legen wir sie in das ausgehobene Loch. Paarweise angeordnet, sollen sie die Gegensätze der Andenwelt symbolisieren: Himmel und Erde, Schwarz und Weiß, Feuer und Wasser.
Wir fügen vier Inka-Zigaretten hinzu und opfern den ebenfalls mitgebrachten Wein. Jeder muss mit dem vollen Becher in Richtung Berggipfel prosten, mit dem Finger wieder ein paar Tropfen in die vier Himmelsrichtungen schnippen und dabei ein persönliches Gebet sprechen, mit dem wir den Beistand der Götter erbitten. Ich ahne bereits, was als Nächstes kommen wird. Und tatsächlich: Wir gießen ein wenig Wein aus dem Becher in die vier Ecken des Lochs – und müssen auch den Rest wieder opfern, indem wir ihn trinken.
Nachdem wir dieses Ritual hinter uns gebracht haben, geht es weiter in Richtung See. Inzwischen hat der Wind zugelegt, Wolken bedecken den vorher stahlblauen Himmel, und es ist deutlich kälter geworden. Doch von alldem merken wir kaum etwas: Wir müssen die Götter wirklich mit unserer...