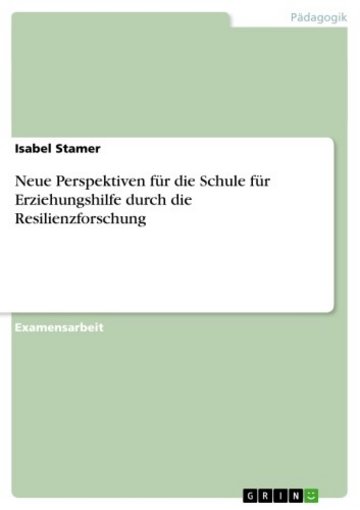„Auch Wissenschaften unterliegen Moden, Strömungen des Zeitgeists oder
- in der Sprache der Wissenschaftsphilosophie - Forschungsparadigmen und ihrem Wechsel“[69]. Beginnend mit der traditionellen Risikoforschung deckte die Studie von Werner und Smith (1982) auf der Hawaiianischen Insel Kauai das folgende Phänomen auf: „Trotz massiver Belastungen und widrigster Lebensumstände entwickelt sich eine nicht unerhebliche Zahl der so aufgewachsenen Kinder zu gesunden Erwachsenen“[70]. Dieses Ergebnis wurde Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre (beginnend in den USA) als Wunder begriffen, ebenso wurden Kinder, welchen eine erfolgreiche individuelle Bewältigung schwerwiegender Belastungen gelang, als „Superkids“[71] verherrlicht oder als „unverwundbare Kinder“[72] bezeichnet.
Man kann sagen, dass diese Ergebnisse einen solchen Paradigmenwechsel angetrieben haben, der sich seit dem in den Fachgebieten der Psychologie und der Medizin vollzieht und sich u.a. auf den Bereich der Sonderpädagogik auswirkt. Bestimmte Themengebiete wie <Krankheit>, <Pathogenese> oder <Defizit> geraten ins Abseits, während sich andere wie <Gesundheit>, <Salutogenese> oder <Kompetenz> statt dessen in den Blickpunkt der Forschung drängen.
Schon an den neuen Begriffen wird deutlich, welche aktuelle Neuorientierung sich hinter ihnen verbirgt: “Weg von der Erforschung von Krankheiten, hin zur Erforschung von Gesundheit“[73]. „Ein verändertes Bild des Menschen mit einem neuen Verständnis von Krankheit (und Gesundheit) und einer zunehmenden Beachtung krankheitsvorbeugender und gesunderhaltender Prozesse“[74]. Bisher konzentrierte man sich auf die Erforschung der Ursachen von Fehlentwicklungen und Inkompetenz. In der Resilienzforschung liegt der Schwerpunkt des Interesses bei dem Individuum mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Lebensbewältigung[75], bei der Suche „...nach den vielfältigen Wurzeln dieser kindlichen Widerstandskraft“[76].
Dies hieße für die Pädagogik bei Verhaltensgestörten und die Schule für Erziehungshilfe nicht mehr nur defizitorientiert zu suchen und zu intervenieren, sondern in Richtung eines „Kompetenzmodell des Individuums“[77] zu denken und zu handeln. Genau dies versucht die Resilienzforschung.
Bevor ich mich im nächsten Kapitel mit dieser Neuorientierung an den Kompetenzen der Kinder und mit dem Gehalt insbesondere für die Schule für Erziehungshilfe beschäftige, werde ich zunächst auf die Begrifflichkeiten, Möglichkeiten und Grenzen der Resilienzforschung genauer eingehen.
„Ziel dieses Forschungsbereiches ist es, ein besseres Verständnis darüber zu erlangen, welche Faktoren psychische Gesundheit bei Kindern erhalten und fördern, die Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind“[78].
ANTHONY prägte für diese o.g. „Superkids“ oder „unverwundbaren Kinder“ den Begriff <unverletzlich> und <Unverletzlichkeit> (aus dem engl. `invulnerable´), der jedoch eine absolute Immunität gegenüber negativen Lebensbedingungen und körperlichen Beeinträchtigungen impliziert. So hat sich statt dessen die Bezeichnung <resilient> und das entsprechende Substantiv <Resilienz> (aus dem engl. `resilience´) durchgesetzt, da diese Begrifflichkeiten eher relationalen Charakter haben[79]. Dieses Konstrukt der „Resilienz“ ist definitionsgemäß weitreichend und noch ungenau.
STAUDINGER konstatiert, dass sich zwei Resilienz-Konstellationen unterscheiden lassen. „Eine erste, bei der „normale“ Entwicklung trotz Beeinträchtigungen aufrecht erhalten werden kann, und eine zweite, bei der „normale“ Entwicklung nach einem ersten „Entwicklungseinbruch“ wiedererlangt wird“[80]. GÖPPEL stellt dementsprechend fest: „Ein bestimmtes Entwicklungsbild bei einem Kind, etwa ein erfreuliches Maß an Selbstvertrauen, Sozialkompetenz und Lernbereitschaft, kann nicht per se als Ausdruck von Resilienz gewertet werden, sondern wird zu diesem erst durch den Umstand, daß die Kenntnis der Entwicklungshintergründe ein anderes Entwicklungsbild hätte erwarten lassen. Resilienz bedeutet also stets, daß besondere Widerstände und Schwierigkeiten zu überwinden waren, daß eine besondere Bewältigungsleistung erbracht wurde“[81].
GOETZE (1997) veranschaulicht den Ansatz der Resilienzforschung wie in Abbildung 3[82].
Abb.3
In den meisten Publikationen ist man sich einig, dass Resilienz ein Prozess ist. EGELAND (1993) führt an, dass dieser „...in vielfältiger Weise von inneren und äußeren Faktoren abhängig ist, [...] gefördert und erleichtert, aber auch gefährdet und erschwert werden kann“[83]. Dem entspricht GÖPPEL, indem er festhält: „Die Resilienz ist weniger eine fixe Gegebenheit der Kindheit oder eine Funktion bestimmter Persönlichkeitszüge, sondern sie entwickelt sich über die Zeit und den Kontext von Unterstützung durch die Umgebung“[84]. Und auch MASTEN sieht Resilienz als den „...Prozess, die Fähigkeit oder das Ereignis erfolgreicher Adaptation angesichts herausfordernder oder bedrohender Umstände“[85].
So darf man nicht denken, dass ein Mensch, wenn er „...einmal auf das entsprechende Gleis der „resilienten“ Entwicklung gesetzt“[86], dauerhaft resilient ist und stets allen Widrigkeiten des Lebens vollkommen trotzen kann. Statt dessen gibt es im gesamten Verlauf des Lebens eines Menschen eine sich fortlaufend verändernde Balance zwischen der Verwundbarkeit und der Widerstandskraft eines Menschen.
In der Literatur wird der Ansatz der Resilienz häufig in Verbindung mit den Begriffen „Empowerment“ und „Coping“ geführt. Der Begriff Empowerment ist in der amerikanischen Sozial- und Behindertenarbeit seit einigen Jahren nicht mehr wegzudenken, da in seinem Rahmen Selbsthilfe-Initiativen und Elternbewegungen behinderter Kinder entstanden sind[87]. THEUNISSEN beschreibt die Empowermentphilosophie als ein neues Paradigma des Helfens. Zum einen gilt es, „...sich selbst [zu-]befähigen und ermächtigen; aber auch jemanden dazu [zu] verhelfen, sich zu emanzipieren“[88]. Die Bedeutung des Begriffsanteils „power“ bezieht sich auf Stärke, Kompetenz, Widerstandskräfte und Bewältigung kritischer Lebenssituationen und gründet auf den Forschungsresultaten der Resilienzforschung[89].
„Coping“ stammt von dem englischen Verb „to cope“ ab und kann mit „bewältigen, meistern“[90] übersetzt werden. MARGALIT definiert es „...als die Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen, die von einem Individuum bei der kognitiven und emotionalen Bewertung von Stressoren [...] angewandt werden“[91]. So nennt man Strategien, die ein Kind anwendet, um Krisen zu bewältigen und ihnen gegenüber sozusagen resilient zu sein, Coping-Strategien. Diese sind unterteilt in aktive (z.B. Informationssuche, Problemlösen) und vermeidende (z.B. Leugnen schwieriger Situationen, Flucht vor Problemen) Coping-Verhaltensweisen[92].
„Im Licht der Ergebnisse der Resilienzforschung kann menschliche Entwicklung in einem dynamischen Zusammenhang betrachtet werden. Danach sind Entwicklungsrisiken nicht einfach neutralisierbar. Sie müssen aber im Zusammenhang mit schützenden Faktoren gesehen werden, über die jeder Mensch im Sinne individueller Eigenschaften oder charakterlicher Voraussetzungen verfügt, oder aber, die sich als Ressourcen in seinem Lebensumfeld aktivieren lassen“[93]. Diese Schutz- oder Protektivfaktoren (im Folgenden näher beschrieben) ermöglichen es Kindern, sich trotz hoher Risikobelastung normal zu entwickeln. „...„Resilienz“ oder „Widerstandskraft“ ist das Ergebnis dieser schützenden Prozesse“[94].
Göppel spricht dennoch einen gewichtigen Gesichtspunkt in Bezug auf die als resilient identifizierten Personen an, wenn er darlegt, dass ihr Trotzen vielfältiger Probleme und das Erreichen schulischen und beruflichen Erfolges trotz großer Hindernisse, d.h. „...diese permanenten Anstrengungen doch auch ihren Preis hatten“[95]. So stellte man gerade bei „resilienten“ Personen „...nicht selten eine auffällige Häufung psychosomatischer Beschwerden, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber langfristigen intimen Bindungen und eine ihnen oftmals selbst schwer erklärliche Unfähigkeit, die eigenen Erfolge entspannt zu genießen“[96] fest.
Im Folgenden versuche ich einen Überblick über die Vielzahl von Fragen zu geben, die durch dieses neue Forschungsfeld aufgeworfen werden (in der Hoffnung, einige davon im Verlauf der...