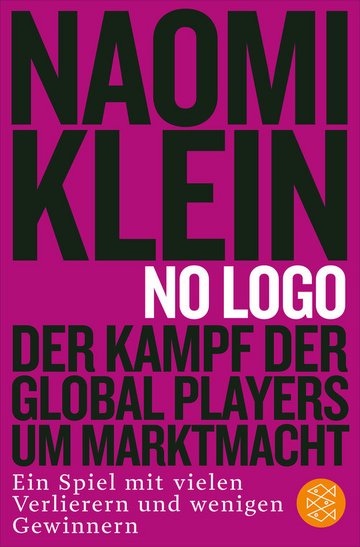Einführung Ein Netz von Marken
Wenn ich den Kopf schief lege und mein linkes Auge zukneife, sehe ich von meinem Fenster aus nur das Jahr 1932 bis hinunter zum See. Braune Lagerhäuser, Schornsteine mit der Farbe von Hafermehl, verblasste, auf Backsteinwände gemalte Schriftzeichen, die Marken wie »Lovely« und »Gaywear« anpreisen, die es längst nicht mehr gibt. Dies ist das alte industrielle Toronto der Textilfabriken, Kürschnereien und für den Großhandel produzierten Brautkleider. Bis jetzt hat noch niemand einen Weg gefunden, Geld zu machen, indem er diesen Backsteinkästen mit der Abrissbirne zu Leibe rückt, und im kleinen Umkreis von acht oder neun Blocks ist die neue Stadt planlos über die alte geschichtet worden.
Ich schrieb dieses Buch, als ich in einem zehnstöckigen Lagerhaus in den gespenstischen Überresten des alten Textilviertels von Toronto wohnte. Viele ähnliche Gebäude sind schon lange mit Brettern vernagelt, ihre Fensterscheiben sind zerbrochen, und ihre Schornsteine halten die Luft an; ihre einzige noch verbliebene kapitalistische Funktion besteht darin, auf ihren teerbeschichteten Dächern große glänzende Reklametafeln zu tragen, die die Autofahrer an die Existenz von Molsons Bier, Hyundai-Autos und EZ Rock FM erinnern, wenn sie auf der Schnellstraße am Seeufer im Stau stehen.
Die Schichtung der Jahrzehnte in dem Viertel an der Spadina Avenue, das sich wie so viele ähnliche Stadtviertel in einem postindustriellen Übergangsstadium befindet, hat einen wundervollen zufälligen Charme. Die Lofts und Ateliers sind voller Leute, die genau wissen, dass sie eine Rolle in einem Stück urbaner Performance-Kunst spielen, aber meistens geben sie sich alle Mühe, keine Aufmerksamkeit auf diese Tatsache zu lenken. Wenn jemand zu viel Besitzanspruch auf das »wirkliche Spadina« erhebt, dann fühlen sich plötzlich alle nur noch als unbedeutende Requisiten, und das ganze kunstvolle Gebäude bricht zusammen.
Gleich an der Ecke meines Blocks wurde als Denkmal für die Textilarbeiterinnen in den Sweatshops ein riesiger Fingerhut errichtet. Dieses kitschige Monument für die Arbeitskräfte in den Ausbeutungsbetrieben der Textilbranche ist nur die deutlichste Manifestation einer schmerzhaften neuen Selbstwahrnehmung des Viertels. Überall in meiner Umgebung werden die alten Fabrikgebäude umgewidmet und in sogenannte »Loftwohnungskomplexe« mit Namen wie »Candy Factory« verwandelt. Natürlich gibt es auch einen Markt für Eigentumswohnungen in luxusrenovierten alten Sweatshops mit Badewannen und schiefergetäfelten Duschen, unterirdischem Parkhaus, Räumen mit Oberlicht und Conciergen, die rund um die Uhr im Dienst sind.
Mein Vermieter, der sein Vermögen der Herstellung und dem Vertrieb von Regenmänteln der Marke London Fog verdankt, hat sich bisher hartnäckig geweigert, unser Gebäude zur Einrichtung von Eigentumswohnungen mit besonders hohen Decken zu verkaufen. Irgendwann wird er dem Druck nachgeben, aber bis jetzt sind immer noch ein paar Textilfirmen bei ihm eingemietet. Sie sind zu klein, um nach Asien oder Mittelamerika umzuziehen, und aus irgendwelchen Gründen wollen sie dem Trend in der Branche auch nicht folgen und Heimwerker gegen Stücklohn beschäftigen. Der Rest des Gebäudes ist als Wohn- und Arbeitsraum an Yogalehrer, Dokumentarfilmer, Graphiker, Schriftsteller und andere Künstler vermietet. Die Kleiderleute aus dem Büro gegenüber, die immer noch Mäntel verkaufen, sehen schrecklich unbehaglich drein, wenn die Marilyn-Manson-Klone aus der Künstlerszene kettenklirrend und in schenkelhohen Lederstiefeln mit der Zahnpastatube in der Hand zum gemeinsamen Waschraum stampfen. Aber was können sie tun? Wir sind im Augenblick alle hier zusammengepfercht, eingeklemmt zwischen der harten Realität der wirtschaftlichen Globalisierung und der unausrottbaren Rockvideo-Ästhetik.
JAKARTA – »Frag sie, was sie herstellt, was auf dem Label steht. Verstehst du – Label«, sagte ich, griff nach hinten und schlug den Kragen meines T-Shirts hoch. Die indonesischen Arbeitskräfte waren inzwischen an Leute wie mich gewöhnt. Fremde, die mit ihnen über die furchtbaren Arbeitsbedingungen in den Fabriken sprachen, wo sie für multinationale Konzerne wie Nike, Gap und Liz Claiborne schneiden, nähen und leimen. Aber diese Näherinnen sehen ganz anders aus als die ältlichen Textilarbeiterinnen, denen ich daheim im Aufzug begegne. Hier sind alle jung, manche gerade erst fünfzehn und kaum eine älter als dreiundzwanzig.
An jenem Tag im August 1997 hatten die unerträglichen Arbeitsbedingungen zu einem Streik in der Textilfabrik Kaho Indah Citra in dem Industriegebiet Kawasan Berikat Nusantar am Stadtrand von Jakarta geführt. Der Grund für den Arbeitskampf der Kaho-Arbeiterinnen, deren Tagesverdienst umgerechnet zwei Dollar betrug, waren die zahlreichen Überstunden, die sie ohne die gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung leisten mussten. Nach einem dreitägigen Streik bot das Management einen Kompromiss an, der für eine Region mit einem entschieden zu entspannten Verhältnis zur Arbeitsgesetzgebung typisch war: Die Überstunden waren nicht mehr Pflicht, aber die Bezahlung blieb weiterhin niedriger als gesetzlich vorgeschrieben. Die 2000 Arbeitskräfte kehrten an ihre Nähmaschinen zurück – alle außer 101 jungen Frauen, die das Management als die Unruhestifter betrachtete, die den Streik ausgelöst hatten. »Unser Fall ist noch immer nicht geklärt«, sagte mir eine dieser Arbeiterinnen, völlig niedergeschlagen und ohne Hoffnung auf eine positive Lösung.
Ich sympathisierte natürlich mit den Opfern, aber als Fremde aus dem Westen wollte ich die Markennamen der Textilien wissen, die in der Kaho-Fabrik hergestellt wurden. Wenn ich daheim von der Sache berichtete, würden sie mir als journalistischer Aufhänger dienen. Also drängten wir uns nun zu zehnt in einem Betonbunker, der kaum größer war als eine Telefonzelle, und spielten mit Begeisterung Firmen-Charade.
»Diese Firma stellt lange Ärmel für die kalte Jahreszeit her«, sagte eine der Arbeiterinnen.
»Sweaters?«, riet ich.
»Nein, keine Sweaters, glaube ich. Wenn man ausgehen will, und es ist kalt draußen, dann zieht man einen …«
»Mantel an«, rief ich.
»Ja, aber keinen schweren, einen leichten.«
»Eine Jacke!«
»Ja, wie eine Jacke, aber keine Jacke – sondern lang.«
Die Verwirrung ist leicht zu erklären: Am Äquator herrscht nicht gerade großer Bedarf an Mänteln, weder im Kleiderschrank noch im Wortschatz. Und doch kommen immer weniger Kanadier mit der Kleidung der letzten beharrlichen Näherinnen aus der Spadina Avenue durch ihre kalten Winter. Immer mehr tragen die Produkte junger asiatischer Frauen, die in heißen Klimaregionen wie der von Jakarta arbeiten. Im Jahr 1997 importierte Kanada für 11,7 Millionen Dollar Anoraks und Skijacken aus Indonesien, im Vergleich zu 4,7 Millionen im Jahr 1993.[1] So viel wusste ich bereits. Aber ich kannte immer noch nicht den Markennamen der langen Mäntel, die die Kaho-Arbeiterinnen zusammengenäht hatten, bevor sie ihre Arbeit verloren.
»Lang, ja. Und was steht auf dem Label?«, fragte ich wieder.
Es gab eine kurze Diskussion und dann, endlich, eine Antwort: »London Fog.«
Ein globaler Zufall, vermute ich. Ich begann, den Arbeiterinnen zu erzählen, dass meine Wohnung in Toronto früher eine Textilfabrik von London Fog gewesen war. Doch ich hörte abrupt damit auf, als die Arbeiterinnen ganz entsetzte Gesichter machten. Der Gedanke, dass ich in einem Gebäude wohnte, in dem sich ein Textilbetrieb befand, hatte sie in Angst und Schrecken versetzt. In diesem Teil der Welt verbrennen jedes Jahr Hunderte von Arbeitskräften, weil ihre Schlafquartiere über feuergefährlichen Sweatshops liegen.
Als ich so im Schneidersitz auf dem Betonboden des kleinen Schlafraums saß, kamen mir meine Nachbarn von daheim in den Sinn: der Ashtanga-Yoga-Lehrer im zweiten Stock, der Trickfilmzeichner aus der Werbebranche im vierten und der Aromakerzenvertrieb im achten. Es scheint, dass die jungen Frauen in den Ex-portproduktionszonen eine Art Mitbewohner von uns sind, mit uns verbunden durch ein weltumspannendes Netz von Stoffen, Schuhbändern, Franchisebetrieben, Teddybären und Markennamen. Ein weiteres Logo, das wir gemeinsam hatten, war Esprit, eine der Marken, die ebenfalls in der Zone hergestellt wurden. Als Teenagerin hatte ich in einem Geschäft gearbeitet, das Esprit-Kleidung verkaufte. Und natürlich war auch McDonald’s präsent: Eine Niederlassung hatte gerade in der Nähe von Kaho eröffnet, sehr zum Verdruss der Arbeiterinnen, für die das angeblich so preisgünstige Essen völlig unerschwinglich war.
Berichte über das weltweite Netz von Logos und Produkten sind normalerweise in der euphorischen Marketingsprache des Global Village abgefasst, jener phantastischen Welt, in der Stammesmitglieder im fernsten Regenwald eifrig auf ihre Laptops hacken, sizilianische Großmütter Internetfirmen betreiben und »Global Teens« einen »weltweiten Kulturstil« gemeinsam haben, um eine Website von Levi’s zu zitieren.[2] Alle Konzerne, von Coca-Cola über McDonald’s bis zu Motorola, bauen ihre Marketingstrategie auf dieser postnationalen Vision auf, doch es ist die schon lange laufende IBM-Kampagne »Lösungen für einen kleinen Planeten«, die das egalitäre Versprechen eines durch Logos vernetzten Erdballs am eindrucksvollsten zum Ausdruck...