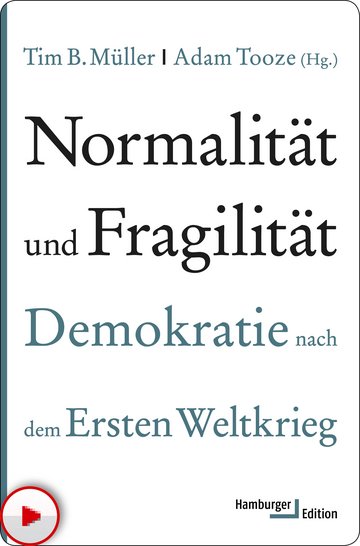Tim B. Müller | Adam Tooze
Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg
Gibt es eine Geburtsstunde der modernen Demokratie? Die jüngste Forschung bietet Grund, zur Untersuchung dieser Frage in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere auf die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg zu blicken. Das ist auch der Ansatz, den dieser Band vorschlägt und verfolgt. Sein Thema ist das making of democracy im Ersten Weltkrieg und vor allem nach 1918. Er begreift die Demokratie dieser Zeit konsequent als etwas im Entstehen Begriffenes. Eine solche Lesart folgt aus einer vergleichenden, nationale Grenzen überschreitenden Betrachtungsweise.
Aber damit wird die Vorgeschichte nicht ausgeblendet. Bereits im späten 19. Jahrhundert baute sich eine globale Demokratisierungswelle auf und machte sich ein weltweites Demokratisierungsverlangen bemerkbar. Erweiterungen des Wahlrechts waren an der Tagesordnung, doch das allgemeine Wahlrecht lag für die meisten Gesellschaften noch fern. Diese ungleichen, aber gleichzeitigen Entwicklungen sind als »Demokratisierungsepisoden« bezeichnet worden. Die Demokratie wurde zur globalen Erwartung.1 Das gilt auch für traditionell als demokratisch geltende Gesellschaften, die jedoch erst in dieser Epoche entscheidende Demokratisierungsschübe erlebten.2
In dieser Perspektive summierte sich im Ersten Weltkrieg und unmittelbar danach die Vielzahl der Demokratisierungsimpulse, teils unabhängig vom Krieg und teils bedingt oder beschleunigt durch den Krieg, zu einem qualitativen, fundamentalen Wandel. Die Demokratiegeschichte ist eine Geschichte multipler Temporalitäten. Sie ist ohne Vorläufer und Vorbilder, ohne Traditionen, in die sich die Handelnden nach dem Ersten Weltkrieg einschrieben und auf die sie sich zur Legitimationsstiftung beriefen, nicht denkbar. Aber sie ist auch nicht begreifbar, ohne die Neuartigkeit der Globalität, Gleichzeitigkeit und Geschwindigkeitssteigerung zu registrieren, die mit dem Beginn des massendemokratischen Zeitalters einherging, und die zuvor ungekannten Herausforderungen zu berücksichtigen, denen sich all diese neuen Demokratien gegenübersahen und für die sie angemessene Umgangsweisen entwickeln mussten. Die Grundregeln des Politischen änderten sich schlagartig. Neue Unsicherheiten und neue Möglichkeiten strukturierten den politischen Handlungshorizont.
Diese Lesart beruht auch auf theoretischen Einsichten. Ein so vielfältiges und vielschichtiges gesellschaftliches Gefüge wie Demokratie lässt sich nicht auf den Punkt bringen; dieses Gewebe aus Vorstellungen und Handlungen, Institutionen und Ideen, Gewohnheiten und Affekten beschreibt eine politisch-kulturelle Entwicklung und keine definitive, historisch stillgestellte Verfassungsordnung. Das Prozesshafte der Demokratie fasst der französische Denker und Historiker der Demokratie, Pierre Rosanvallon, in das mittlerweile vielzitierte Aperçu, wonach es einer Geschichte der Demokratie »nicht allein darum geht, dass die Demokratie eine Geschichte hat. Es gilt, den radikaleren Gedanken in Betracht zu ziehen, dass die Demokratie eine Geschichte ist.«3
Rosanvallon gehört zu den Stichwort- und Impulsgebern neuer Geschichten der Demokratie, denen nationale Pädagogik, das Verteilen von Zensuren und die normative Überhöhung einer selbst nicht historisierten Gegenwart widerstrebt, ohne dass sie den Zusammenhang ignorieren, der diese Geschichte, die sich selbst Demokratie nennt, in all ihrer Widersprüchlichkeit verbindet. Die Grundlagen für ein solches Vorgehen wurden schon vor Jahren gelegt.4 Es gab seitdem bedeutende und verdienstvolle Unternehmungen, die internationale Forschung über die Demokratie seit 1900 oder in der Zwischenkriegszeit ins Gespräch zu bringen, wobei es zumeist jedoch beim Festhalten am Definitorischen blieb, wenn auch die der gegenseitigen Übersetzbarkeit zwischen den Disziplinen dienenden Definitionen immer offener wurden.5 Bis in maßgebliche historische Darstellungen hinein überwiegt dabei nach wie vor eine pessimistische Perspektive, die eher die extremen Krisen, die Schwäche oder den Untergang der Demokratie erklären als ihre Chancen ausloten oder Erwartungshorizonte erkunden will. Ambivalenzen – etwa die Spannungen zwischen individuellen Rechten und kollektiven Ligaturen, der Ruf nach Führung und Stärkung der Exekutive oder die in Demokratien ubiquitäre Parlamentarismus- und Parteienkritik – treten dabei kaum als konstitutive, »normale«, unvermeidliche, weiterhin theoretisch und praktisch herausfordernde Merkmale von Demokratien auf, sondern häufig als destruktive Vorboten des Zerfalls.6
Einen anderen Weg weisen Interventionen und Untersuchungen, die sich vom Versuch der historischen Fixierung lösen und mit einem nominalistischen Zugriff experimentieren, der jedoch kein antiquarischer Nominalismus ist. Diese Debattenrekonstruktionen setzen bei den Vorstellungen und Erwartungen, Selbst- und Situationswahrnehmungen der Zeitgenossen an, sie analysieren Ereignisse und Entwicklungen in ihren individuellen Kontexten, sie sind kontingenzsensibel. Zugleich leugnen diese Ansätze nicht das Kontinuitätsproblem, das sich auch im Hinblick auf die vielen zu rekonstruierenden Demokratie-Geschichten stellt: Die Handelnden schrieben sich selbst in eine kontinuierliche Geschichte der Demokratie ein, die auch als Akteursvorstellung nur in Überschreitung lokaler Kontexte und unter Zuhilfenahme strukturanalytischer Vorgehensweisen zu erschließen ist. Zuletzt verschließen sich diese Forschungen und Überlegungen nicht der theoretischen Herausforderung, die sich aus dieser Historisierung von Kulturen und Konzeptionen der Demokratie ergibt: Sie zwingt uns, die Fragen nach der Fragilität und Stabilität, nach den Integrationsmöglichkeiten und Ausgrenzungstechniken, nach den Erschöpfungszuständen und der Kreativität, nach den Potenzialen – den eröffneten wie den unausgeschöpften – und Grenzen der Demokratie neu zu stellen. Demokratie lässt sich auf diesem historischen Fundament nur als fragile und fluide politische Ordnung denken, in der keine unüberwindlichen Hürden den Optimismus vom Zusammenbruch, das Selbstverständlichwerden von der Befeindung der Demokratie trennen.7
Aber man muss beides erkennen und erforschen – die optimistische Erwartung und die zerstörerische Mischung aus Ressentiments und Resignation, die enthusiastische Kreativität und die gewaltsame Gegenbewegung bis hin zur Auflösung, die Schattenseiten und die strahlende Hoffnung, die nicht nur eine Nation, sondern viele Gesellschaften beinahe gleichzeitig nach dem Ersten Weltkrieg erfasste. Um das zu leisten, wird kein Weg vorbeiführen an einer erneuten Rekonstruktion zeitgenössischer Perspektiven und Handlungszusammenhänge, die davon Abstand nimmt, Gewissheiten zu wiederholen, die schon zu lange feststehen, ohne immer wieder auf ihre sachliche und theoretische Plausibilität überprüft worden zu sein – ein in der Wissenschaft üblicher, von immer neuen Erkenntnissen und Erfahrungen geleiteter Revisionsprozess. Eine solche Rekonstruktion muss das Gedachte und Geschehene vom Anfang erschließen und nicht vom Ende zurückblicken; es ist eine der Aufgaben der Geschichtswissenschaft, die Geschichte »dem Schein des Soges von Notwendigkeit der Strukturen und Prozesse« zu entziehen, »an individuelle Entscheidungen, an kontingente Ereignisse, an Alternativen und Optionen« zu erinnern, »die Offenheit aller Situationen im Bewusstsein zu halten«, oder wie es eine Neuformulierung dieses historistischen Grundsatzes ausdrückt: »Wer nur nach der Vorgeschichte der Probleme […] der zeitlich je unterschiedlichen Gegenwarten fragt, folgt einer verborgenen Teleologie und blendet jene Entwicklungen aus, die abgebrochen wurden, die scheiterten oder im Sande verliefen.«8 Das gilt nicht nur für den deutschen Fall. Die amerikanische, die britische, die französische oder die schwedische Geschichte der »Zwischenkriegszeit« sind nicht weniger explizit oder implizit teleologischen Interpretationen unterzogen worden, in denen die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg als langfristig irrelevantes Intermezzo der Katastrophen oder als Durchgangsstation einer bruchlosen Demokratiegeschichte erscheinen.9 Erkenntnistheoretisch ist es eine konstante Herausforderung für die Geschichtswissenschaft, aus dem Späteren nicht auf das Frühere zu schließen, nicht in die Falle der »embryogenetischen Obsession« zu tappen, einen dem jeweiligen individuellen Zusammenhang angemessenen Umgang mit den Problemen von Kontinuität und Konsistenz zu finden, der bei den Gegenwartserfahrungen und Zukunftserwartungen der Zeitgenossen ansetzt.10
An dieser Stelle setzt der vorliegende Band ein, der auf eine Tagung im Hamburger Institut für Sozialforschung im November 2013 zurückgeht. Die Absicht war, Demokratien und Demokratie nicht als etwas Fixiertes zu untersuchen, sondern »Geschichte in the making zu erfassen, während sie ihr volles Potenzial aufweist«, bevor es sich in eine...