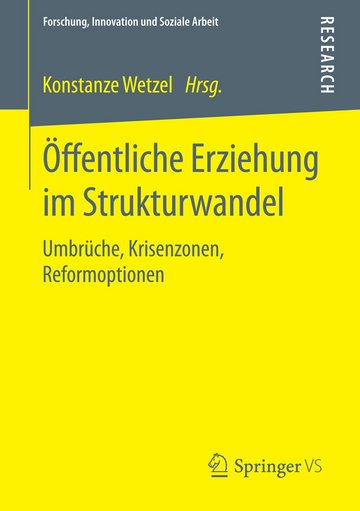| Vorwort | 6 |
| Inhaltsverzeichnis | 9 |
| I Lebensweltlicher und pädagogisch-institutioneller Strukturwandel | 11 |
| Veränderte Lebens- und Bildungswelten von Kindern und Jugendlichen | 12 |
| 1. Veränderungen von Kindheit und Jugend | 12 |
| 2. Bildungsprozesse finden in allen Lebensbereichen statt – Notwendigkeit eines breiten Bildungsbegriffs | 13 |
| 3. Ein „aneignungsorientierter“ Blick auf Schule | 19 |
| 4. Einbeziehung informeller und öffentlicher Bildungsräume in die Bildungslandschaften | 23 |
| Literatur | 29 |
| Die Transition vom Kindergarten zur Grundschule –Der Zeitpunkt der Weichenstellung zum Einstieg inden Anfangsunterricht oder mystifizierter Übergangim Bildungssystem? | 32 |
| 1. Bildungsbiografische Problembetrachtungen | 33 |
| 2. Interdisziplinäre Organisationsentwicklung | 39 |
| 3. Professionalisierungsfragen | 43 |
| 4. Qualitätsfragen | 45 |
| 5. Fazit | 48 |
| Literatur | 48 |
| Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Lernkulturverschränkter Ganztagsschulen im Spannungsfeldzwischen sozialpolitischen, gesellschaftlichen undpädagogischen Erwartungen | 52 |
| 1. Ganztägige Schulen – ein Geflecht an Erwartungen | 52 |
| 1.1. Sozialpolitische Zugänge: Die Ganztagsschule als Unterstützungs- und Entlastungsinstrument für Familie und insbesondere Fraue | 53 |
| 1.2. Die bildungspolitisch-gesellschaftliche Perspektive: Ganztagsschulen als Mittel zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems | 54 |
| 1.3. Die pädagogische Perspektive: GTS als Instrument zur verstärkten individuellen Förderung von Schülerinnen und Schülern | 55 |
| 2. Erfüllen ganztägige Schulen die Erwartungen? | 55 |
| 2.1. IST-Stand-Analyse: Belegte Wirkungen | 56 |
| 2.1.1. Sozialpolitische Zugänge | 57 |
| 2.1.2. Gesellschaftliche Auswirkungen | 58 |
| 2.1.3. Pädagogische Wirkungen | 58 |
| 2.1.4. Resümee zur Forschungslage | 59 |
| 2.2. Bildet sich an verschränkten Ganztagsschulen eine andere Lernkultur? | 60 |
| 2.2.1. Fragestellung und Erwartungen | 60 |
| 2.2.2. Erhebungsverfahren | 60 |
| 2.2.3. Stichprobe | 63 |
| 2.2.4. Ergebnisse zum Schul- und Klassenklima | 64 |
| 2.2.5. Unterschiede in der Schulzufriedenheit | 66 |
| 2.2.6. Gewalt und abweichendes Verhalten | 67 |
| 2.2.7. Merkmalsverläufe während der Sekundarstufe I | 68 |
| 2.2.8. Zusätzlicher Lernaufwand und Lernunterstützung | 69 |
| 2.3. Resümee | 70 |
| 3. Implikationen | 71 |
| 3.1. Situationsanalyse | 71 |
| 3.2. Zielkonzepte und Handlungsansätze | 73 |
| 3.2.1. Die ökologische Entwicklungspsychologie von Urie Bronfenbrenner | 74 |
| 3.2.2. Die Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan | 75 |
| 3.2.3. Die evolutionäre Erkenntnistheorie von Maturana & Varela | 75 |
| 3.3. Welche Kombination von Rahmenbedingungen garantiert einen pädagogischen Mehrwert? | 76 |
| Literatur | 77 |
| Abgehängt und ausgeklinkt: Jugend im sozialen „Off“ – Perspektiven der Exklusionsforschung auf soziale Ungleichheit im Jugendalter | 79 |
| 1. Soziale Exklusion aus theoretischer Perspektive | 79 |
| 2. Jugend am Rande der Gesellschaft: Worüber sprechen wir überhaupt? | 81 |
| 3. Konsumorientierung als Ringen um Inklusion | 84 |
| 4. Lebenssinn und Lebensbewältigung in prekären Situationen | 87 |
| 5. Einschrumpfung der Lebensäußerungen | 90 |
| 6. Was passiert, wenn nichts passiert? | 92 |
| Literatur | 94 |
| II Sozialpädagogisches Handeln und innere Schulreformen | 96 |
| Die Erweiterung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags: Ganztagsbildung und Schulsozialarbeit | 97 |
| 1. Gesellschaftlicher Strukturwandel und erweiterter Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule | 98 |
| 1.1. Zentrale Aspekte des gesellschaftlichen Strukturwandels | 98 |
| 1.1.1. Strukturaspekte, die die klassischen gesellschaftlichen Funktionen der Schule betreffen | 98 |
| 1.1.2. Generelle Veränderungen in den Inhalten und Formen der sozialen Integration | 100 |
| 2. Ganztagsbildung als Rahmenkonzept für die Verständigung und Kooperation zwischen Schule und Sozialer Arbeit | 102 |
| 2.1. Sozialwissenschaftlich aufgeklärtes Bildungsverständnis | 102 |
| 2.2. Verschiedene Formen des Lernens | 103 |
| 3. Bildendes Lernen entlang der Sinndimensionen allgemeiner Bildung als gemeinsame Aufgabenstellung von Schule und Sozialer Arbeit | 105 |
| 3.1. Historisch-politische Bildung: Aktive Aneignung und reflexive Vermittlung epochaltypischer Schlüsselprobleme | 106 |
| 3.2. Existentielle Bildung: Sensible Auseinandersetzung mit Menschheitsproblemen | 109 |
| 3.3. Ethische Bildung: Schaffung entwicklungsangemessener Verantwortungsräume | 111 |
| 3.4. Vielseitige Bildung: Entspannte Erfahrungs- und Entwicklungsförderung | 114 |
| 3.5. Selbstbestimmte Bildung: Ganztagsschule als kind- und jugendgemäßer Sozialraum | 115 |
| 3.6. Gemeinwesenbezogene Bildung: Implementierung integrativer Bildungs-, Sozial- und Beschäftigungslandschaften | 117 |
| 3.7. Perspektive: Die Projekte „Ganztagsbildung“ und „Schulsozialarbeit“ benötigen einen langen Atem | 120 |
| Literatur | 121 |
| Gesundheitsförderung als Bildungsaufgabe – Perspektiven für die Ganztagsschule | 125 |
| 1. Gesundheit als Aufgabe der Schule | 127 |
| 2. Von der Gesundheitserziehung zur „gesunden Schule“ | 129 |
| 3. Chancen und Grenzen von Gesundheitsförderung und gesundheitsbezogener Bildungsarbeit in der Schule | 132 |
| 4. Fazit | 135 |
| Literatur | 136 |
| Innovatives Schulmanagement – Eine Herausforderung: Ganztägige Praxis Handelsschule NEU | 140 |
| Vorstellungen und Visionen für die Tätigkeit als Direktorin an der Bundeshandelsakademie Villach | 140 |
| Motivation und Vertrauen durch Zutrauen & Wertschätzung | 141 |
| Corporate Governance Code – Zutrauen schafft Vertrauen | 142 |
| Migration als Herausforderung & Chance – Internationale Schule | 143 |
| Neue Schwerpunkte und neue Ausbildungszweige und -wege | 143 |
| Plattform Offene Schule - Ort der Begegnung | 144 |
| Lebensraum Schule - das Milieu bestimmt die Qualität | 144 |
| Qualitätsmanagement: Das Jetzt bestimmt die Zukunft | 144 |
| Neupositionierung der HAK Villach im Wirtschafts- und Kulturraum der Alpe-Adria-Region | 145 |
| Gleichstellungsbedingungen – Genderprojekt | 145 |
| Stärkung des Leistungswillens und der sozialen Kompetenz | 145 |
| Fördern und fordern | 145 |
| Priorität: Praxis HAS NEU | 145 |
| Projektbeschreibung PRAXIS HAS - ein Schulversuch | 146 |
| Motivation | 146 |
| Strategie der Umsetzung | 146 |
| Ausgangslage und Konzeption der PRAXIS HAS NEU | 147 |
| Kriterien der Praxis HAS NEU | 148 |
| Zeithorizont und inhaltliche Darstellung | 149 |
| Meilensteine | 150 |
| Voraussetzungen für die formale Antragstellung waren | 151 |
| Visionen, Team, Planung | 152 |
| EU geförderte Werteinheiten für die KOEL Stunden | 152 |
| KOEL: kompetenzorientiertes, eigenverantwortliches Lernen | 152 |
| Kooperationsvertrag mit der Partnerfirma ÖBAU Rössler als Lernfirma | 154 |
| Resümee der Evaluierung | 156 |
| Wesentliche Erkenntnisse – ein Auszug aus der Schüler Innenbefragung Oktober 2014 | 156 |
| Ausblick | 157 |
| Aufbaulehrgang | 157 |
| Die Kärntner Volkshochschulen – Grundbildung unddas Nachholen des Pflichtschulabschlusses als Einstiegin das Lebensbegleitende Lernen | 160 |
| 1. Zahlen, Daten, Fakten – PIAAC Studie 2011/12 | 162 |
| 2. Die Zielgruppe | 163 |
| 3. Wie kommt es dazu? | 164 |
| 4. Konzeptionelle und didaktische Schwerpunkte | 165 |
| 4.1. Integrierte Lebensplanungs- und Bildungsberatung | 168 |
| 4.2. Zusatzangebote | 169 |
| 4.2.1. Politische Bildung | 169 |
| 4.2.2. Medienkompetenz | 170 |
| 4.2.3. Outdoor-Aktivitäten | 170 |
| 5. Menschen erreichen | 170 |
| 6. Fazit | 172 |
| Literatur | 172 |
| III Krisenhafte Beziehungen im Übergangsfeld von Schule und Ausbildung | 174 |
| Bildung und Beschäftigung – Der Beitrag von internationalen Wirtschaftsorganisationen zur Debatte | 175 |
| 1. Blick auf die Bildung | 175 |
| 2. Economic and Employment Outlook | 176 |
| 3. Education and Training 2020 - European Union | 177 |
| 4. Zum Begriff „Bildung“ | 178 |
| 5. Bildung und Beschäftigung | 178 |
| 6. Beitrag internationaler Organisationen | 179 |
| 7. Wirkungszusammenhänge zwischen Internationalen Organisationen und Nationaler Politik | 179 |
| 8. Bildung ist mehr | 180 |
| 9. Vielfältige Zugänge internationaler Organisationen | 180 |
| 10. Wirkungen internationaler Auseinandersetzung mit Bildung und Beschäftigung | 182 |
| 11. Bestärkung und Bestätigung durch internationale Vergleiche | 183 |
| 12. Verantwortung für Politik: Nutzen von Evidence | 183 |
| Literatur | 184 |
| Zum Phänomen Schulversagen – pädagogische,soziale und systemische Perspektiven sowiestrategische Ansätze und Maßnahmen in Österreichzu dessen Verhinderung | 186 |
| 1. Vorbemerkungen | 186 |
| 2. Zum Phänomen Schulversagen bzw. (Aus-)Bildungsabbruch | 187 |
| 3. Internationale Diskurse revisited | 198 |
| 4. Strategische Ansätze und Maßnahmen im nationalen Kontext | 203 |
| 5. Schlussbetrachtungen | 208 |
| Literatur | 212 |
| Die Rolle der Sozialen Arbeit im Übergangssystem Schule – Arbeitswelt | 215 |
| 1. Das Übergangssystem | 217 |
| 2. Reformperspektiven im Ausbildungs- und Übergangssystem | 219 |
| 3. Herausforderungen für die Soziale Arbeit | 222 |
| 4. Gestaltungsmaximen | 223 |
| Literatur | 225 |
| Jugendcoaching als Reformansatz am Übergang Schule – Beruf | 227 |
| 1. Vier zentrale Faktoren als Ausgangsbasis | 228 |
| 1.1. Jugendarbeitslosigkeit | 228 |
| 1.2. Early School Leavers | 228 |
| 1.3. Out-of-Labour-Force Risiko | 229 |
| 1.4. Europa 2020 | 229 |
| 2. Das Konzept „Jugendcoaching“ als Reformansatz | 229 |
| 3. Zielgruppen | 230 |
| 4. Methodische Konzeption | 231 |
| 4.1. Vernetzung und Kooperationen | 231 |
| 4.1.1. Schulen | 232 |
| 4.1.2. Offene Jugendarbeit, Jugendzentren und Jugendämter | 232 |
| 4.1.3. Erziehungsberechtigte | 232 |
| 4.1.4. Wirtschaft | 233 |
| 4.2. Drei-Stufen-Modell | 233 |
| 4.2.1. Stufe 1 | 234 |
| 4.2.2. Stufe 2 | 234 |
| 4.2.3. Stufe 3 | 235 |
| 5. Wirkungsorientierung | 236 |
| 6. Erfahrungen und Ergebnisse | 236 |
| 7. Ausblick | 237 |
| Literatur | 237 |
| Autorinnen und Autoren | 239 |