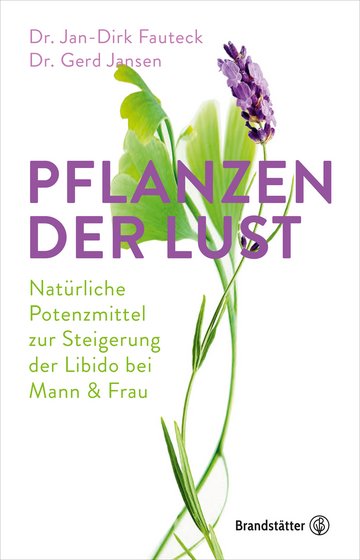Hormone und Botenstoffe: Das Orchester der Lust
Hormone und Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, dirigieren wichtige Vorgänge in unserem Körper, von Bedürfnissen wie Hunger und Durst bis zu unserer psychischen Befindlichkeit. Es versteht sich also von selbst, dass diese auch für Lust und Leidenschaft wesentlich sind. Und wirklich ist es ein wahres hormonelles Orchester, das für ein erfülltes Liebesleben sorgt. Worauf es dabei aber ankommt: die richtige Balance. Denn ihr Gleichgewicht spielt neben vielen anderen Faktoren, wie sozialen und psychologischen Bedingungen, eine Rolle dabei, wann und wie oft wir Lust empfinden.
Dieses Wechselspiel an biochemischen Substanzen – als der „Software“ – ist übrigens auch deshalb so interessant, weil in unserem Gehirn – der „Hardware“ (Krüger 2018) – unterschiedliche Software-Akteure auftreten: je nachdem, ob wir uns gerade neu verliebt haben, Lust oder eine tiefe Verbundenheit zu unserem Partner empfinden. (Siehe Abb. 10)
Die Sexualhormone
Eine wichtige, wenn nicht sogar grundlegende Rolle, um erregende Gefühle und Lust zu verspüren, nehmen die sogenannten Steroidhormone ein, wie Östrogene, Testosteron oder DHEA. Denn sie sorgen dafür, dass bestimmte neuronale Schaltkreise überhaupt auf innere und äußere Reize, also Stimuli, reagieren. (Krüger 2018) Vereinfacht ausgedrückt: Östrogene und Testosteron sind die Basis dafür, dass andere Hormone und Botenstoffe, die unsere körperlichen Reaktionen beim Lustempfinden steuern, ausgeschüttet werden. (Pfaus 2009) Sie wirken darüber hinaus auch direkt auf die Genitalien und sorgen dafür, dass diese beispielsweise auf Berührungen reagieren. Außerdem haben sie Auswirkungen auf das Gehirn, wo sie zum Beispiel die sexuelle Empfänglichkeit und den sexuellen Appetit fördern, Fantasien anregen, die Stimmung verbessern oder das Geruchsempfinden erhöhen. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch: Je niedriger Östrogen und Testosteron sind, umso weniger sensibel reagieren wir auf Berührung oder andere sexuelle Stimuli.
ABB. 10: Die Biochemie der Liebe
Östrogene
Das sogenannte „Weiblichkeitshormon“ wird bei Frauen vor allem in den Eierstöcken gebildet, bei Männern in den Hoden – wenn auch in niedrigerer Konzentration als bei Frauen –, des Weiteren in den Nebennieren, im Gehirn und im Fettgewebe.
Östrogene haben Einfluss auf die Stimmung und verbessern den Geruchssinn, sie beeinflussen aber auch die Leistungsfähigkeit und unsere kognitiven Fähigkeiten. So erzielen Frauen rund um den Eisprung, wenn ihr Östrogenspiegel am höchsten ist, oft bessere Ergebnisse bei Wettkämpfen und Prüfungen, was Studien bereits vor Jahrzehnten beweisen konnten. (Pfaus 2009) Mit zunehmendem Alter nimmt der Östrogenhaushalt übrigens ab – ein Grund, warum Frauen in der Menopause oft über verminderte Gedächtnisleistung klagen. (Fauteck & Kusztrich 2014) Auch nach einer Geburt, wenn der Östrogenspiegel einer Frau zu rasch abfällt, kann das bei manchen Frauen zu Unruhe und Gereiztheit, labiler Stimmung, Depressivität und Schlaflosigkeit führen.
Östrogenmangel betrifft Mann und Frau
Für das Lustempfinden der Frau spielen Östrogene eine minimale Rolle. Allerdings kann sich ein Östrogenmangel negativ auf die Lubrikation auswirken, d. h. die Befeuchtung der Scheide. Diese ist aber wichtig, um die körperliche Vereinigung lustvoll erleben zu können. Ist die Scheide zu trocken, kann das Schmerzen beim Eindringen des Penis und beim Geschlechtsverkehr verursachen und damit die Lust erheblich beeinträchtigen. (Meston & Frohlich 2000) Hinzu kommt, dass ein Östrogenmangel auch die Stimmung beeinflusst: eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir sexuelles Verlangen spüren.
Ein Östrogendefizit kann übrigens auch für Männer problematisch werden und zeigt sich durch Symptome, die jenen von Frauen in den Wechseljahren durchaus ähnlich sind, darunter Schlaf- und Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen, nächtliche Schweißausbrüche. Ein chronischer Östrogenmangel kann darüber hinaus beispielsweise zu erektilen Dysfunktionen, Osteoporose, Arthrose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. (Römmler 2014)
Östrogenexzess bei Männern
Männer haben in fortschreitendem Alter aber oft nicht mit einem Östrogenmangel zu kämpfen, sondern vielmehr mit einem sogenannten Östrogenexzess, also einem Zuviel dieses Hormons. Anzeichen dafür können sein: Übergewicht, Adipositas (Fettsucht), metabolisches Syndrom, also Stoffwechselstörungen, und ein Nachlassen der Libido.
Was ist ein metabolisches Syndrom?
Ein metabolisches Syndrom, auch Syndrom X genannt, ist eine Ansammlung von Risikofaktoren, wie zum Beispiel hoher Blutzucker, hohes Cholesterol, hoher Blutdruck und ein großer Hüftumfang, die sich auf die Funktion der inneren Organe auswirken können. Die Folgen sind schwere Erkrankungen, wie Typ-2-Diabetes, Herz- und Schlaganfälle. Dabei erhöht bereits ein einzelner Risikofaktor die Anfälligkeit für diese Krankheiten.
Ein erhöhtes Fettgewebe beim Mann muss aber nicht zwingend einen Östrogenexzess bedeuten, auch wenn es sehr häufig der Fall ist. In der Therapie eines Östrogenüberschusses hat sich übrigens eine Änderung des Lebensstils bewährt, so zum Beispiel durch mehr sportliche Betätigung, insbesondere Krafttraining, eingeschränkten Alkoholkonsum und ausgewogene Ernährung. (Römmler 2014)
Testosteron
Testosteron galt lange Zeit als das Männlichkeitshormon. Richtig ist aber, dass sowohl Männer als auch Frauen über dieses Hormon verfügen, wenn auch in unterschiedlicher Konzentration.
Tiefe Stimme, Bartwuchs, mehr Muskeln – der hohe Testosteronspiegel des Mannes zeigt sich auch äußerlich. Breite Schultern und schmale Hüften – das typische männliche V – weisen auf einen besonders hohen Testosteronspiegel hin. (Fisher 2017) Dank des hohen Testosterons haben Männer übrigens auch kaum unter schlaffer Haut zu leiden, ganz anders Frauen, deren niedrigerer Testosteronhaushalt oft an einer Bindegewebsschwäche, also der Cellulite, erkennbar ist.
Wie wichtig Testosteron für Männer ist, um ihr sexuelles Interesse und ihre Erregbarkeit aufrechtzuerhalten, wurde vielfach durch Studien bestätigt: Ältere Männer, die an einem ausgeprägten Testosteronmangel leiden, zeigten oft erheblich geringeres sexuelles Interesse. Eine individuelle Testosterontherapie wiederum kann in diesen Fällen die sexuelle Lust wiederherstellen. (Bancroft 2005)
Das sexuelle Verlangen richtet sich somit nach der Höhe des Testosteronspiegels, was durch verschiedene Studien belegt ist: So dachten Sportler, die Testosteron eingenommen hatten, öfter an Sex, hatten öfter eine Morgenerektion und mehr Orgasmen. (Fisher 2004) Das gilt in ähnlicher Weise auch für Frauen: Ihr Verlangen steigt nach der Einnahme von geringen Mengen Testosteron ebenfalls.
Junge Elternschaft senkt Testosteron
Interessant: Wenn Männer Väter werden, verändert sich ihr Testosteronspiegel. So konnte eine Studie zeigen, dass bereits vor der Geburt des Kindes das Testosteron sinkt und gleichzeitig das Östradiol, das zu den Östrogenen zählt und „Bevaterungsgefühle“ hervorruft, steigt. – Eine hormonelle Situation, die sich kurz nach der Geburt des Kindes sogar noch intensiviert. (Berg & Wynne-Edwards 2001)
Frauen, die nach der Geburt ihr Neugeborenes stillen, verspüren meist ebenfalls weniger Lust auf Sex mit dem Partner. – Eine Situation, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie Mutter sind. Die verminderte Libido von jungen Müttern steht auch in einem Zusammenhang mit einem niedrigeren Testosteronspiegel. Anders verhält es sich bei jungen Müttern, die ihre Babys mit der Flasche füttern – so das Ergebnis einer anderen Studie. (Alder & Bancroft 1988)
Einflussfaktor Zyklus
Vielleicht haben Sie es, wenn Sie eine Frau sind, bereits beobachtet: Rund um den Eisprung haben Sie mehr Lust auf Sex – kein Wunder, denn dann ist Ihr Testosteronspiegel am höchsten. (Van Goozen et al. 1997, Pfaus 2009) Viele Frauen fühlen sich zu diesem Zeitpunkt auch attraktiver und offener Männern gegenüber. (Haselton & Gangestad 2006)
Der Zyklus einer Frau hat übrigens auch Einfluss auf die Partnerwahl: Während des Eisprungs werden vom weiblichen Geschlecht besonders männliche Herren bevorzugt, mit symmetrischen Gesichtszügen und potenziell hohen Vaterqualitäten. Zu den anderen Zykluszeiten kommen auch...