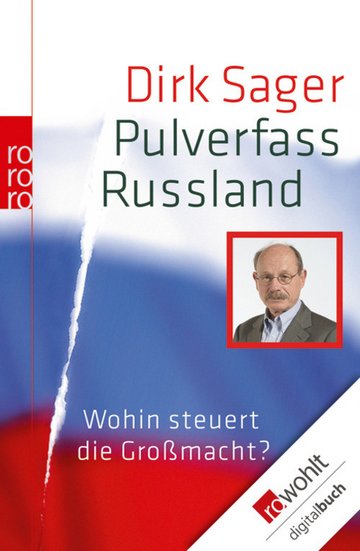Vorwort
Aufstieg und Niedergang, Hoffnung und Desillusionierung – wie in einem Mahlstrom wirbelt Russland zwischen den Polen der Extreme: Moskau als «Drittes Rom» oder eine Hölle auf Erden. Nach wirtschaftlichem Aufstieg während Putins Präsidentschaft, dem wahnhaften Streben nach dem Wiedererlangen von Stärke und Macht, hat auch Russland die weltweite Wirtschaftskrise erreicht. So selbstgewiss hatte sich die Führung im Kreml gewähnt als Herrscher über die weltgrößten Reserven an Energie. Damit schien das Land besser gerüstet für eine neue Weltmachtrolle als durch jede militärische Streitmacht. Das war der Ausgangspunkt für eine neue Etappe «des russischen Weges», wie der große Moskauer Historiker Juri Afanassjew die Politik der jüngeren Zeit beschreibt, ein Sendungsbewusstsein, gekennzeichnet durch einen «Messiaskomplex» und Expansionsdrang. Er nennt es eine Rückkehr zu alten Traditionen: «Tatsächlich bedeutet ‹zurückkehren› in Russland, dass wir uns an einem Ort wiederfinden, den wir genau genommen niemals wirklich verlassen haben.»
Nun taumelt die Wirtschaft zwischen Smolensk im Westen und Wladiwostok im fernen Osten des Landes. Und noch ist nicht ausgemacht, ob diese neuerliche Prüfung wie eine Kur gegen den Großmachtwahn wirkt oder zu tiefen sozialen und politischen Verwerfungen führt – gefährlich für Russland selbst und seine Nachbarn. Wer durch das Land reist, stößt immer wieder auf die Spuren lastender Geschichte, im Norden die im Schnee versunkene Welt der Straflager, Gastgeber in den Dörfern, die vom Schicksal ihrer Vorfahren im Gulag erzählen. Die Last dieser Geschichte wird nicht leichter, wenn in einer kosmetischen Operation die Maske des Grauens zu einem makellosen Antlitz hergerichtet wird. Es mag sogar sein, dass die Krise Russland viel schlimmer trifft als manch ärmeres Land, gerade weil die politische Führung Masken trägt, des Stolzes, des Ingrimms und ohne erkennbares Empfinden für die Tragik des Geschehens in vorangegangenen Jahrzehnten. Alexander Jakowlew, Weggefährte Gorbatschows und Mitarchitekt von Perestroika und Glasnost, Geburtshelfer eines neuen demokratischen Russlands, wehrte sich bis in seine letzten Tage gegen den Prozess des Verdrängens und Vergessens. Er erkannte darin eine fundamentale Gefahr für den neuen Staat. Bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte im Oktober des Jahres 2000 – Putin war gerade ein halbes Jahr Präsident – warnte er vor der für ihn absehbaren Entwicklung und erklärte: «Unsere Ermüdung hindert uns daran, klar zu erkennen, dass der Amtswalter die ganze Fülle der Macht erneut ergriffen hat und dabei die Verfassung, die Gesetze und den Menschen niederhält.» Nicht etwa die ausländischen Kommentatoren oder Korrespondenten erhoben als Erste die Stimme, sondern Wissenschaftler und Politiker in Moskau. Und unter ihnen waren es die Alten, jene, die die Zeit der Tyrannei noch in klarster Erinnerung hatten, die am eindringlichsten warnten. Sie erkannten, dass die Weichen gestellt wurden für einen neuerlichen Weg ins Abseits, als ob es die Geschichte nicht gegeben hätte.
Butowo war damals ein Dorf vor den Toren Moskaus. Am Rand der von Kiefern umstandenen Siedlung aus Holzhäusern lag der Schießplatz – den Widerhall von Gewehr- und Pistolenschüssen kannten die Anwohner. Doch seit dem 8. August 1937 drangen des Nachts und in den frühen Morgenstunden auch die Rufe von Frauen und Männern in die Hütten – Gebete und das Flehen, man möge doch um Gottes und der Kinder willen ein Einsehen haben. Es begann, was später Stalins «Großer Terror» oder die «Große Säuberung» genannt wurde, obwohl das vom Staat verordnete Morden längst schon zur Gewohnheit geworden war.
An jenem ersten Tag wurden 91 Menschen erschossen. Die nach dem Ende der Sowjetunion erstellten Listen der in Butowo Getöteten zählen insgesamt über zwanzigtausend Namen. Die Opfer, die Tag und Nacht in Lastwagen herangekarrt wurden, waren keineswegs, wie später offiziell behauptet wurde, in ihrer Mehrzahl Parteimitglieder. Zu den Erschossenen gehörte Tatjana Iwanowna, eine Frau in den Dreißigern. Man weiß von ihrem Schicksal, weil Verwandte später den Ort der Erschießung aufsuchten, wo die Leiche von Tatjana Iwanowna irgendwo unter der wuchernden Grasnarbe in einem Graben verscharrt worden war. Als Grund für ihre Verhaftung und Exekution reichte es, dass sie in ihrer Jugend mit einem deutschen Unternehmer in Moskau verheiratet war, der nach der Revolution sie und das Land verließ. Daraus konstruierte das NKWD, so hieß der Geheimdienst damals, den Vorwurf der Spionage.
Dass sich die Spuren ihres Lebens in jener Zeit nicht verloren, ist einfachen Kirchenleuten und der Menschenrechtsorganisation «Memorial» zu danken. Die einen bauten nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft am Rand der Erschießungsstätte eine Kirche aus Holz. Und gemeinsam trug man die Namen der Hingerichteten zu einem Totenbuch zusammen. Der Staat zeigte kein Interesse für das Gedenken an diesen Teil seiner Geschichte. Wer in späteren Jahren nach Butowo fuhr, durchquerte die Ödnis der Vorstadt, wo sowjetische Industriebrachen und grelle Reklamewände die Lust am Verdrängen spiegelten. Man hatte Mühe, das Ziel zu erreichen, weil es auf keinem Stadtplan verzeichnet war und keine Schilder den Weg wiesen. Endlich angekommen, traf man in einem Haus neben der Kirche die selbst ernannten Hüter des vergessenen Ortes. Dort hatten sie die Dokumente gesammelt, gewährten Einblick in die langen Listen, ein paar Menschen, die sich staatlicher Gewissenlosigkeit entgegenstemmen, wie man sie immer wieder in Russland trifft, so gradlinig und offenherzig in Mitgefühl und Gastfreundschaft, wo sie doch fast nichts zu teilen hatten.
Als ich im März 1980 zum ersten Mal nach Moskau kam, wagte kaum jemand von Butowo zu sprechen. Doch bei aller Tristesse in der Endphase der Herrschaft Leonid Breschnews, die rückblickend als die «Zeit der Stagnation» betrachtet wird, gab es Zeichen der Hoffnung. Angesichts des politischen und ökonomischen Niedergangs griff im Land die Erkenntnis um sich, dass die Zeit der Lügen nicht andauern konnte, dass hinter den Kulissen des sich pompös gebärdenden Gebildes von Staat und Partei etwas Neues entstehen musste, auch wenn noch niemand wusste, wie die Zukunft aussehen würde. So dachten nicht nur diejenigen, die damals von Amts wegen abfällig Dissidenten genannt wurden. Selbst im Zentralkomitee der Kommunisten regten sich unruhige Geister.
Valentin Falin, der frühere sowjetische Botschafter in Bonn, war auf interne Dokumente zu den Erschießungen polnischer Offiziere in Katyn 1940 gestoßen, die nach Lesart der Partei immer noch den Deutschen angelastet wurden. Falin, damals Berater des Generalsekretärs Juri Andropow, der Breschnew im Amt gefolgt war, drängte darauf, das Geheimnis zu lüften und zu bekennen, dass die Mörder dem NKWD angehörten und die Exekutionen auf Geheiß Stalins vollzogen worden waren.
Die Zeit war noch nicht reif für solche Wahrheiten. Falin wurde aus dem Zentralkomitee entlassen, und man traf ihn fortan im Redaktionshaus der Zeitung «Iswestija», wo er als Kommentator arbeitete. Auch dieses abrupte Ende einer Karriere war ein Beleg für die wachsende Unruhe im Apparat, in dem Falin keineswegs ein Einzelgänger blieb. Später gelangte er wieder zu Ansehen und Ehren, als Michail Gorbatschow ihn in sein Team berief.
Auf Ungeduld und Widerspruch konnte man auch fernab der Hauptstadt stoßen, etwa bei Fabrikdirektoren oder Kolchosvorsitzenden, die das Elend der Wirtschaft in ihren eigenen Betrieben erlebten. Der sowjetische Koloss war erstarrt, erschöpft nicht zuletzt von der Fixierung auf den Rüstungswettlauf mit den USA. Aber die Vorbeben der kommenden Veränderungen waren zu spüren. Die vagen Hoffnungen jener frühen achtziger Jahre schlugen um in Euphorie, als Gorbatschow die Stunde der Wahrheit einläutete. Er wies einen neuen Weg ohne Umkehr, wie es damals schien, einen Weg, der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit – so phantastisch das noch klingen mochte – keinesfalls ausschloss. In den Straßen Moskaus demonstrierten Bürger für ihre Rechte. Im August 1991 verteidigten sie die demokratischen Ansätze gegen jene Kräfte in Geheimdienst und Partei, die das alte System wiederherstellen wollten.
Kaum zwanzig Jahre sind seither vergangen. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erscheinen so fern wie eh und je. Ohne Zweifel, die sowjetischen Zeiten sind endgültig vorüber. Das heutige Russland hat zwar manches gemein mit jenem untergegangenen Staatsmoloch, doch es ist ein anderes Land geworden. Die Grenzen sind offen, jedenfalls für alle, die das Geld haben, um zu reisen. Das wiedererblühte St. Petersburg erinnert an das «Palmyra des Nordens», wie die Dichter ihre Stadt einst genannt haben. Und wer heute durch Moskau fährt, mag sich zuweilen in Las Vegas wähnen. Andernorts ist der Wetteifer mit Manhattan unverkennbar.
Inmitten der Stadt liegt der Kreml. Er ist umkränzt von Baukränen, die die Silhouette des neuen Reichtums in den Himmel zeichnen. Das Machtzentrum des großen Landes steht wie seit Urzeiten in weißer, unschuldiger Reinheit am Ufer der Moskwa, als sei es ein Märchenschloss. Dabei ranken sich um den Palast grausame Mythen und Legenden von Machtintrigen und Herrscherwahn. Ein führender Politiker der nachkommunistischen Zeit empfahl einst, man möge die Festung als Museum zur Besichtigung freigeben, damit sich die Betrachter an den Kulissen düsterer Geschichte erbauen könnten. Der neuen Politik jedenfalls könne in diesen Mauern kein Glück beschieden sein.
Auch damals, als ich nach Moskau kam, war die Burganlage aus dem Mittelalter eine...