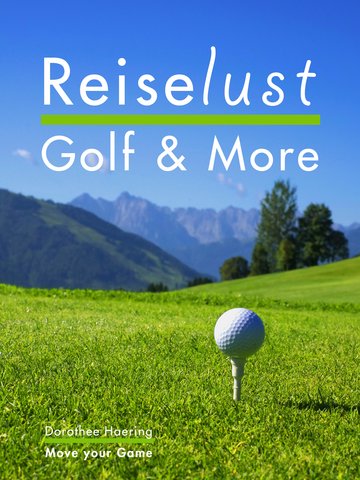11 Jo Hanns Rösler – Autor & Humorist
»Oft fragen Freunde meine Frau: ›Wie kann man mit einer Concierge leben?‹ ›Mit einer Concierge?‹ fragt meine Frau erstaunt. Sie sagen: ›Mit einem Mann, der wie eine Hausmeisterin in der Nachbarschaft alles ausplaudert, was im Haus geschieht. Ihm ist doch nichts heilig. Immer wieder sind Sie und Ihre Töchter und Ihre Schwiegersöhne der Mittelpunkt seiner Geschichten. Wenn ich Sie wäre, Frau Kitty, ich ließe mir das nicht gefallen! Ich kratzte ihm die Augen aus. Soll Ihr Mann doch über die Römer schreiben, wenn er unbedingt schreiben muß!‹ Kitty hat dafür nur ein Lächeln übrig. Kitty hat für alles nur ein Lächeln übrig. Am meisten aber lächelt sie – geduldig – über mich.«
Dies ist eine kleine Kostprobe aus einem der vielen Bücher, die Jo Hanns Rösler im »Röslerhaus« zu Papier brachte. Er wurde 1899 in Königstein an der Elbe geboren und bezeichnete sich immer als Erzähler. Bereits in jungen Jahren veröffentlichte er erste Gedichtbände. Nach dem ersten Weltkrieg publizierte er unter anderem im »Simplicissimus« und im »Berliner Tagesblatt«. Seine erfolgreichste Zeit war in den fünfziger und sechziger Jahren, als seine Geschichten wöchentlich in den großen Rundfunkzeitungen und Illustrierten erschienen.
Jung heiratete er eine Wiener Schauspielerin namens Kitty und das Paar lebte in Paris, Berlin, Wien, auf Mallorca, bis sie 1935 sesshaft wurden auf dem Berghof über Bad Feilnbach. Auch wenn in seinen Büchern von drei Töchtern die Rede ist, hatte er lediglich zwei, Christine und Josefine, von ihm nur Mumei genannt. Jo Hanns Rösler starb 1966 in München.
⇒ Leseprobe überspringen
Textausschnitt aus: »Meine Töchter und ich«
»Kein Schnupfen ist so ansteckend wie die Liebe. War unser Haus bisher davon verschont geblieben, so merkte ich jetzt, dass Unruhe in die Herzen meiner Töchter kam. Wenigsten der beiden größeren, der siebzehnjährigen und der sechzehnjährigen. Es begann damit, dass sie weniger Appetit hatten, sich sorgfältiger frisierten, die Hände pflegten, ohne dass man es ihnen sagen mußte, dass die Naht ihrer Strümpfe immer gerade saß und die Absätze ihrer Schuhe immer höher wurden. Auch machten sie sich auffällig häufig beim Telefon zu schaffen, und oft erlebte ich, dass sie schnell den Hörer auflegten, wenn ich überraschend eintrat, und mir sagten: ›Es war falsch verbunden, Papa.‹ (...)
Wir erlebten unsere Überraschungen. Es war eine schöne Blamage für mich. Wir wussten nur, dass er Emil hieß. Von heute auf morgen fanden wir überall den Namen Emil. Auf die Zeitung gemalt, in die Bücher gekritzelt, auf den Kalender geschrieben. Emil! Emil! Emil!!! Ich hatte Emil bisher nie für einen schönen Namen gehalten. Ich war immer der Meinung, ein Mann für meine Töchter müsse Juan oder Hendrik oder wenigsten Viktor Emanuel heißen. Aber nein, in Carolines steifer Schrift stand überall Emil.
›Ihr müßt Emil endlich einmal sehen, Papa!‹ sagte Caroline eines Tages. Ich verschluckte mich beim Kaffee.
›Hat er ernste Absichten?‹
›Wie meinst du das, Papa?‹
Ich wurde plump.›Will er dich heiraten?‹ fragte ich.
Caroline lachte. ›Aber, Papa! Du bist wirklich gelungen! Nein, Emil gefällt mir, ich bin richtig in ihn verliebt, ich finde ihn hinreißend, rassig, himmlisch ... ich muß ihn haben, Papa! Wenigsten für kurze Zeit!‹
Mir wurde die Sache unheimlich. Ich starrte entsetzt meine Tochter an.
›Am Mittwoch kommt er‹, sagte sie.
›Was? Hierher? Zu uns?‹
›Ja. Sieh ihn dir einmal an.‹
›Wozu?‹
›Vielleicht gefällt er dir genauso wie mir.‹
›Niemals, wenn du keine ernsten Absichten hast!‹
›Sei nicht pathetisch, Papa!‹
Mir blieb nichts erspart. Am Mittwoch kam er. Ich hatte ihn schon durchs Fenster erblickt, ein junger Mann, gar nicht so übel. Es gibt schlimmere. Sogar einen kleinen Wagen hatte er. Ungeduldig, wie immer auf die Uhr schauend, ging der junge Mann, Emil also, vor meinem Haus auf und ab. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass Caroline eingetreten war und hinter mir stand.
›Wie gefällt er dir, Papa?‹ Kann ich ihn haben?‹
Ein Töchtervater hat ein dickes Fell. Ich bin von meinen Töchtern allerhand gewöhnt. Aber dies ging mir entschieden zu weit. Sozusagen über die Hutschnur. Ich blies mich auf und schrie sie an:
›Was unterstehst du dich?‹
›Aber, Papa! Ich bin alt genug.‹
›Eine dumme Gans bist du, die nicht weiß, was sie redet! Hinaus!‹
Als ich allein war und die Situation überdachte, die mir als Vater beschieden war, kam ich immer mehr in Erregung. Ich würde diesem Burschen da unten gehörig die Leviten lesen. Hinauswerfen würde ich ihn, vierkant. Das war doch alles nur sein Einfluss. Was sind das für Redensarten für ein wohlerzogenes Mädchen? Kann ich ihn haben, Papa? Wie man bei Tisch nach einem Apfel greift! Das ist nur der Umgang mit diesem funkelnagelneuen Jüngling, dem offenbar nichts heilig ist. Typisch für unsere Zeit. Tipptopp in Schale, schon einen eigenen Wagen, beredt wie ein Buch, aber was für ein Buch! Ein Schmöker! Eine Schwarte ohne Moral! Und so etwas in den Händen eines jungen Mädchens, das gerade das Lesen gelernt hat und dem man eher ein Märchenbuch der Liebe in die Hand drücken sollte. Aber das, was da unten auf der Straße stand, das war mehr ein Lehrbuch für den praktischen Hausgebrauch der Liebe. Ich redete mich immer mehr in Zorn, mir fielen tausend Todesarten für den Vernichter des seelischen Friedens meiner Tochter ein, für jenen Emil, der die ersten Kapitel der Liebe offenbar übersprungen hatte, die romantischen Spaziergänge beim Mondschein, die heimlichen Gedichte, traurigen Seufzer, das versteckte Händchendrücken. Wenn ein Mädchen aber vor ihren Vater hin tritt und, ohne vor Scham in die Erde zu sinken, mit frecher Stirn sagt: ›Kann ich ihn haben, Papa?‹ – was für ein Abgrund tut sich dann auf!
Ich hörte Schritte. Die Tür ging auf. Meine Tochter schob den jungen Mann ins Zimmer.
Dies hier ist mein Herr Papa!‹ sagte sie lachend. ›Vertragt euch!‹
Der junge Mann machte eine korrekte Verbeugung. Ich reichte ihm zunächst die Hand. Hinauswerfen konnte ich ihn immer noch.
›Caroline hat mir schon von Ihnen erzählt‹, sagte ich. ›Dann sind Sie also über unsere Pläne im Bilde?
›Sehr sogar, Herr Emil!‹ fauchte ich wütend.
Meine Tochter sprang dazwischen. ›Aber, Papa!‹
Ich schob sie beiseite. ›Das Gespräch führe ich!‹ sagte ich. Und zu jenem gewandt, der meinen Zorn immer mehr entfachte:
›Das, was Sie Ihre Pläne zu nennen belieben, Herr Emil – ‹
›Aber, Papa! Das ist Herr Lindinger!‹
›Mit Vornamen Emil! schrie ich.
›Nein. Thomas!‹
›Wieso Thomas? Ich denke Emil? Wo ist Emil?‹
›Unten vorm Haus.‹
›Traut er sich nicht herauf?‹
›Hahaha!‹ machte der junge Mann, der sich Thomas nannte.
Er schien mir reichlich albern. Und so etwas hatte sich meine Tochter nun ausgesucht! Macht Hahaha und guckt mich an! Als Vater kommt man sich immer ein wenig dümmlich vor, wenn uns unsere Töchter junge Männer präsentieren. Wenn nun gar einer lacht, und wir wissen nicht, warum er lacht, uns sozusagen ins Gesicht lacht, wo es gar nichts zu lachen gibt, wird einem der Rock zu eng.
›Und Sie? Wer sind Sie überhaupt, wenn Sie nicht Emil sind?‹ herrschte ich ihn an.
Caroline nahm seine Hand und die meine, jedoch die seine zuerst und sagte:
›Aber, Papa! Emil heißt doch der kleine Wagen, der unten vorm Haus steht und auf dem ich vor der Fahrstunde fahren gelernt habe.‹
›Was? Das ist Emil? Emil ist ein Auto?‹
Der junge Mann, der nicht Emil war, nickte:
›Ja. Mein Wagen, Herr Rösler.‹
Caroline betätigte es:
›Und da Thomas auf zwei Jahre zum Studium nach Kanada geht, muß er ihn weggeben. Kann ich ihn haben, bis Thomas zurückkommt, Papa?‹ (...)«
⇒ Leseprobe überspringen
Das Herz eines Lehrers
Ein Mensch kann im Laufe seines Lebens viel Dinge besitzen, alles wird er nie sein eigen nennen. Es gibt zahlreiche Menschen, die haben nie ein Auto besessen, kein Fernsehgerät, kein Haus, keinen Garten, keine eigene Wohnung. Dazu hat es nie gereicht und Gehaltsempfänger, zu denen auch die Lehrer zählen, sind auch in unserem Wirtschaftswunderland die armen Teufel. Doch das sind materielle Güter, die man verschmerzen kann, wenn man sie verschmerzen muss. Es gibt aber auch Menschen, die haben nie in ihrem Leben einen Freund besessen, nie einen hilfreichen Nachbarn gefunden, die haben keine Brüder gehabt und keine Schwestern, einige sogar – Gott sei Dank nur wenige – nicht einmal ihre Eltern gekannt.
Eines aber hat jeder Mensch, ob arm oder reich, in seinem Leben gehabt: einen Lehrer. Ein Lehrer bedeutet für die kleinen ABC-Schützen ihre erste Begegnung mit der Pflicht, mit dem Leben überhaupt, und deswegen bleiben uns allen bis ins hohe Alter unsere Lehrer unauslöschlich in der Erinnerung. Ich sehe noch heute alle meine Lehrer vor mir und weiß von jedem den Namen. Ich war nie ein guter Schüler, vor allem in den höheren Klassen haperte es bei mir in Deutsch. Meine schlechteste Note im Abitur war nicht Latein, nicht Griechisch, nicht Mathematik, sondern Deutsch. In meinem Reifezeugnis steht: »Deutsch 3b« - bei Note 4 wäre ich durch gefallen. Und heute lebe ich davon und ernähre meine Frau und meine Töchter und meine Enkel mit meinem Deutsch. Es hapert auch heute noch...