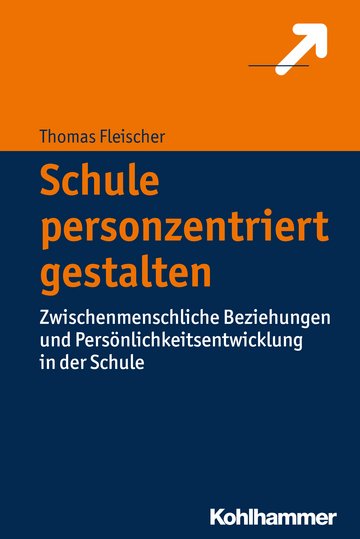1 Einleitung
1.1 Bedingungen und Anforderungen der Gegenwartsgesellschaft
Der Personzentrierte Ansatz ist ein wichtiger Bestandteil der Humanistischen Psychologie, die neben der Verhaltensmodifikation und der Psychoanalyse die dritte Kraft unter den psychologischen Richtungen darstellt. In den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat dieser Ansatz viel Anerkennung und Verbreitung gefunden. Obwohl der Personzentrierte Ansatz die psychologische Beratung in ihren verschiedenen Anwendungsfeldern sowie die pädagogische Arbeit in Schulen und in der Erwachsenenbildung nachhaltig geprägt hat, leidet er unter einem schwachen Image, da er häufig als veraltet angesehen wird. Es stellt sich die Frage, welche Bedeutung der Ansatz dennoch heute für die pädagogische Arbeit hat.
Der Personzentrierte Ansatz hat diejenige Haltung differenziert beschrieben, die Grundlage für die Gestaltung von Kontakt, Begegnung, Kommunikation und Kooperation in allen gesellschaftlichen Bereichen ist. Seine Wirksamkeit zeigt sich nicht nur im Kontext professioneller Berufsausübung, sondern auch im öffentlichen und privaten Bereich. Die personzentrierte Haltung schafft ein positives, konstruktives Klima in jeder zwischenmenschlichen Beziehung, gestaltet somit die soziale Wirklichkeit und macht sie humaner.
Will man die Frage nach der Bedeutung und Aktualität des Personzentrierten Ansatzes beantworten, scheint es sinnvoll, Bezug zu nehmen auf jene Analysen der Gegenwartsgesellschaft, die die Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit für die Lebensgestaltung der Menschen beschreiben. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind gekennzeichnet sowohl durch Komplexität und Intransparenz als auch durch die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und schnellem Wandel. Dazu gehören u. a.
• Veränderungen der Arbeitswelt durch Auflösung von Normalbiographien, Deregulierung und Flexibilisierung, Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse, Globalisierung;
• Pluralisierung von Lebensformen durch Bedeutungswandel von Partnerschaft, Ehe und Familie, neue Formen des Zusammenlebens, ein großes Ausmaß an Trennungen und Scheidungen;
• Veränderungen im Geschlechterverhältnis, Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit;
• Verschärfung sozialer und insbesondere materieller Ungleichheiten, Ausgrenzung und Marginalisierung in drastischer Weise;
• Zunahme des Lebens in virtuellen Welten: Internet, soziale Netzwerke, Computerspiele, Filme, Unterhaltung, aber auch IT-Learning, internationale Kommunikation und elektronische Überwachung;
• Durchlässigkeit der Grenze zwischen Arbeit und Privatleben durch ständige Erreichbarkeit;
• Fortschreiten von Migration und Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft, zum Teil auch der Entwicklung von Parallelgesellschaften.
Schon diese wenigen Hinweise zeigen, dass die Veränderungen sowohl mit Individualisierung als auch mit der Auflösung bisher Halt gebender Strukturen einhergehen. Dies bedeutet für die Einzelperson eine Zunahme der Selbststeuerung und Selbstverantwortung bezüglich der eigenen Orientierung und der Entscheidungen sowie die Kunst, sich immer wieder selbst zu erfinden. Erforderlich ist eine aktive Haltung gegenüber dem eigenen Leben, die das Ich zum Zentrum hat, ihm Handlungschancen und Möglichkeiten eröffnet und ihm auf diese Weise erlaubt, die auftauchenden Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen und umzusetzen, d. h., die Menschen gewinnen neue vielfältige Handlungsoptionen. Dabei ist allerdings jede Person mehr oder weniger auf sich selbst gestellt und kann nur in Bezug auf die eigenen Erfahrungen und Lebensentwürfe eine Wahl treffen. Es bestehen vielseitige Möglichkeiten und Freiheiten, die zugleich Gestaltungs- und Entscheidungszwänge sind und die erhebliche, individuell zu tragende Risiken in sich bergen. Neue Unübersichtlichkeiten, Umbrüche und Veränderungen können verunsichern, ängstigen und Stressreaktionen verursachen. Deshalb ist heute mehr denn je eine Persönlichkeit gefragt, die sich ihrer selbst sicher ist, die weiß, was sie kann und wozu sie fähig ist, und die lebt, was sie in ihrem Inneren ist.
Das aktuelle Selbst ist keine fertige Gestalt, sondern befindet sich in einem anhaltenden Prozess des Werdens (vgl. Keupp 2002, 279). Je weniger kulturelle Normen eine Richtschnur darstellen, desto mehr ist jeder Einzelne darauf angewiesen, in sich selbst ein Gefühl von Stimmigkeit und damit einen Kompass zu finden, der ihm Orientierung bieten kann. Durch die multimediale Konsum- und Kulturindustrie findet der Mensch zwar eine Vielzahl von Vorbildern, Beispielen und Angeboten, aus denen er auswählen kann, durch deren Vielfalt fühlt er sich aber auch häufig überfordert. Nur wer in sich selbst sein Zentrum findet, kann selbstbestimmt sein Leben gestalten (vgl. Keupp 2002).
Im Kontrast zu dieser allgemeinen gesellschaftlichen Perspektive ist die Stabilität im Lehrerberuf relativ hoch. Da die meisten Lehrkräfte im Beamtenverhältnis arbeiten, können sie mit einer lang andauernden Beschäftigung in einem unkündbaren Arbeitsverhältnis rechnen. Das ermöglicht ihnen, sich langfristig in ihrem Berufsfeld und damit auch in ihrem Privatleben einzurichten. Dennoch sind auch sie mit Neuerungen konfrontiert und erleben die Turbulenzen gesellschaftlicher Veränderungen im Kontakt mit Schülern, deren Erziehungsberechtigten, den kommunalen Trägern, dem Jugendamt etc. Auch die Vorgaben und Bestimmungen durch die Kultusbehörden bringen erhebliche Veränderungen, Belastungen und Irritationen in die Schule (PISA, Schulentwicklung, Evaluation, Inklusion etc.). Hier bedarf es bei Lehrern einer stabilen Persönlichkeit, die sich selbst zum Zentrum hat und die mit dem eigenen Beruf identifiziert ist. Dies beinhaltet eine verlässliche Kenntnis der eigenen beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Vorlieben und Interessen, aber auch der eigenen Grenzen. Das Wissen über äußere Gegebenheiten und das System Schule sowie die Einsicht in die private Welt und die eigenen Ressourcen gehören ebenfalls dazu. Erst dann können persönliche Impulse und Interessen auf der einen Seite sowie private und berufliche Handlungsmöglichkeiten auf der anderen Seite ausbalanciert werden.
Die Gegebenheiten einer unübersichtlichen, individualisierten Gesellschaft fordern also ein eher Ich-zentriertes Selbstverständnis. Gleichzeitig wird auf der anderen Seite die Bedeutung von Beziehungen als eine wichtige Kraftquelle zur Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung gesehen. Beziehungen sind »Lebensmittel«, nur dass man heute soziale Netze und Beziehungen aktiver als früher herstellen und bewusst pflegen muss. Dies gelingt leichter mit positiven kommunikativen und dialogischen Kompetenzen. Bei der Pluralität von Werthaltungen und Orientierungen für das Zusammenleben und -arbeiten muss Vieles miteinander ausgehandelt werden. Ein Alltag mit Freiheiten und Möglichkeiten verlangt von Paaren, Familien, Arbeitsgruppen, in betrieblichen sowie schulischen und insbesondere kollegialen Kontexten eine Beziehungs- und Aushandlungsakrobatik. Im sozialen System Schule ist es erforderlich, dass die Beteiligten in der Lage sind, Unterschiede und Widersprüchlichkeiten auszuhalten. Sowohl in Bezug auf sich selbst als auch in Bezug auf Andere erweist sich das Wahrnehmen und Beschreiben von Unterschieden sowie deren Respektierung und Wertschätzung als notwendig.
1.2 Der Mensch ist Mittelpunkt
Im Folgenden stelle ich einige Grundannahmen des Personzentrierten Ansatzes vor und beschreibe deren Bedeutung für die aktive Lebensbewältigung und -gestaltung in unübersichtlichen und riskanten Zeiten. Hierbei geht es zunächst um die Philosophie und um das Menschenbild, die dem Personzentrierten Ansatz zugrunde liegen. Dabei kommt auf der einen Seite die Einzelpersönlichkeit, das Subjekt, in den Blick, auf der anderen Seite die jeweils gegebenen sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.
Ausgangspunkt meiner Überlegungen sind meine Beobachtungen, die ich in den vielen Jahren meiner Berufsausübung als Schulpsychologe mit Schülern, Lehrkräften, Schulleitungen und Schulbehörden machte. Wiederholt erlebte ich, dass die menschliche Seite in ihrer Psycho-Logik im Unterricht, in Kollegien und in Schulentwicklungsprozessen nicht angemessen berücksichtigt wird. Die offiziell verordnete und unterstützte Schulentwicklung hat nur einen eingeschränkten Ertrag und Nutzen für Schüler sowie für Lehrkräfte und Schulleitungen erbracht. Nach Untersuchungen von Schlee ist das Lern- und Arbeitsklima »nur selten von gegenseitigem Respekt,...