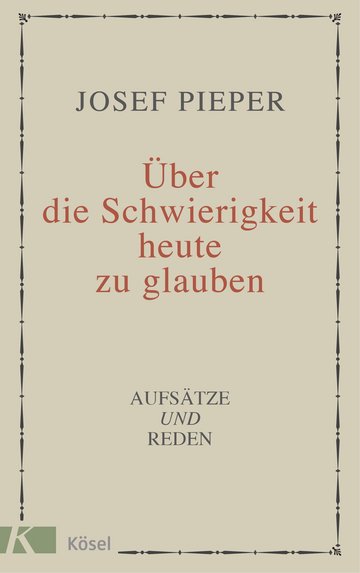Über die Schwierigkeit, heute zu glauben
Das Vertrackte an aller Erörterung von Gründen und Gegengründen im Felde des Glaubens erklärt sich dadurch, dass Glaube, genaugenommen, gar nicht auf Gründen, jedenfalls nicht auf formulierbaren Sachargumenten, beruht und also auch nicht durch solche Argumente erschüttert werden kann. Natürlich ist das eine einigermaßen missverständliche Ausdrucksweise; aber die Sache ist eben äußerst kompliziert. Einerseits geschieht Glauben, wenn es mit rechten Dingen zugeht, nicht ins Blaue hinein, selbstverständlich nicht. Anderseits ist die Entscheidung, zu glauben, auch nicht einfach der Schlusssatz einer Argumentation. Man ist niemals, etwa durch die Gesetze der Logik, genötigt, zu glauben. Glauben ist seiner Natur nach gerade nicht eine zwingende Schlussfolgerung. Wenn ich eine Rechnung durchführe, dann kann ich eines Augenblicks nicht anders, als das Resultat anzuerkennen; es ist mir einfach nicht möglich, ich bringe es gar nicht zustande, der wahren Erkenntnis, die sich mir da zeigt, Widerstand zu leisten. Aber dem Glaubenden zeigt sich der Sachverhalt, den er im Glauben akzeptiert, gerade nicht; da ist keine Nötigung durch die Wahrheit. Da ist wohl die Glaubwürdigkeit eines anderen, eben dessen, der mir versichert, es verhalte sich so, wie er sagt. Und diese Glaubwürdigkeit lässt sich natürlich auch nachprüfen, bis zu einem gewissen Grad. Jedenfalls kann es so viele Gründe geben für die Glaubwürdigkeit eines Zeugen, dass es unvernünftig wäre und übrigens auch unanständig [vielleicht], ihm nicht zu glauben. Dennoch: ich »muss« das nicht, ich muss ihm nicht schon glauben. Zwischen der klaren zwingenden Einsicht in die Glaubwürdigkeit eines Menschen einerseits und dem ihm wirklich entgegengebrachten Vertrauen und Glauben anderseits liegt ein völlig freier Willensakt, zu dem nichts mich zwingen kann und niemand – wie man mir ja auch die Liebenswürdigkeit eines Menschen noch so überzeugend und bezwingend vor Augen führen mag, ohne dass ich ihn darum schon lieben müsste. Man kann »widerwillig« zugeben, dass etwas sich so oder so verhält, aber man kann weder widerwillig lieben noch auch widerwillig glauben. Das steht schon bei Augustinus in seinem Johannes-Kommentar: nemo credit nisi volens – niemand glaubt, es sei denn freien Willens. Weil also Glauben seiner Natur nach auf Freiheit beruht und aus der Freiheit entspringt, darum ist er – wie übrigens auch das schlichte, noch gar nicht religiöse Einander-Glauben-Schenken im alltäglichen mitmenschlichen Umgang – ein in besonderem Sinn unaufhellbares Phänomen, etwas dem Geheimnis mindestens Benachbartes und Verwandtes.
Eben dies macht es begreiflich oder doch begreiflicher, warum es seine spezifische Misslichkeit hat, in bezug auf Glauben oder auch in Bezug auf Nichtglauben überhaupt von Gründen zu reden, von sachlichen Argumenten. Entscheidend ist in allem Glauben nicht der Sachverhalt, der sich dann mehr oder weniger zwingend begründen oder auch widerlegen ließe; entscheidend ist das Persönliche, die Begegnung, heißt das, der Person des Zeugen, der die Wahrheit eines Sachverhaltes verbürgt, mit der Person des Glaubenden, der sich, indem er den Sachverhalt akzeptiert, auf die Person des Bürgen verlässt. Das hat mit »Irrationalismus« nicht das mindeste zu tun. Es handelt sich allerdings darum, dass man sieht: eine Person und ihre Qualitäten, etwa ihre Glaubwürdigkeit, werden unserer Erkenntnis auf völlig andere Weise zugänglich und fassbar als etwa eine exakt zu messende Naturtatsache.
Sokrates hat einmal von sich gesagt, er traue sich zu, einen Liebenden unfehlbar zu erkennen. Woran erkennt man so etwas? Niemand, auch nicht Sokrates, hat auf diese Frage je eine durch rationale Nachprüfung erweisbare Antwort zu geben vermocht. Und dennoch würde er, Sokrates, zweifellos darauf bestehen, dass es sich beileibe nicht um ein bloß subjektives Gefühl handle, nicht um eine bloß irrationale Impression, vielmehr um objektive, in der Begegnung mit Realität zustande gekommene, wahre Erkenntnis. Aber: was ließe sich dafür an Gründen ins Feld führen, an Gründen, wohl zu bedenken, die einem anderen oder gar jedermann plausibel erscheinen könnten? Und so gibt es, höchst erwartbarerweise, auch beim Zustandekommen des Glaubens – Glauben heißt immer primär so viel wie: jemandem glauben – unabsehbar viele mögliche Weisen der Vergewisserung, die vielleicht allein für diesen bestimmten Einzelnen etwas bedeuten, während sie einem anderen, einem Dritten gar nichts besagen. Darum ist es durchaus begreiflich, was freilich auch immer wieder einmal vergessen wird, dass die Glaubensentscheidung natürlicherweise ihren Ort hat in der persönlichen Geschichte des Glaubenden selber. Dem einen wird, während er die Kathedrale von Rouen betrachtet, plötzlich die Gewissheit zuteil, die »Fülle« müsse das Signum der Gottesoffenbarung sein, während jemand anders, wie Simone Weil es von sich selber berichtet, die Christuswahrheit annimmt, als sie auf dem Gesicht eines jungen Kommunikanten erschüttert die Nähe Gottes aufleuchten sieht. Wer wollte es unternehmen, das Gewicht, die Gültigkeit solcher Gründe zu beurteilen? Dies, meine ich, sollte man sich deutlich gemacht haben, bevor man daran geht, nun dennoch, was natürlich sehr wohl sinnvoll möglich ist, von formulierbaren Argumenten zu sprechen – wobei vor allem von Gegenargumenten, von Einwänden, von Schwierigkeiten die Rede sein soll.
Der Generalnenner für eine ganze Gattung von Schwierigkeiten wider den Glauben scheint mir eine bestimmte Vorstellung von »kritischem Denken« zu sein oder vielmehr das Bewusstsein der Verpflichtung, in einem sehr bestimmten Sinne »kritisch« sein zu müssen, wofern man sich nicht einer intellektuellen Unredlichkeit und Unsauberkeit schuldig machen will. »Kritisch sein« bedeutet hier, das heißt für ein am Wissenschaftlichkeitsideal orientiertes Denken: nichts gelten zu lassen, nichts als wahr und wirklich anzunehmen, das sich nicht exakt erweisen lässt. Diese Normvorstellung ist für das Gemeinbewusstsein bereits so selbstverständlich geworden, dass ich mir gut denken kann, dass einer, der dies hört, sich verwundert fragt, wieso ein moderner, denkender Mensch sich jemals von dieser Forderung sollte dispensieren können. Was sonst könnte ihm als Haltung empfohlen oder zugemutet werden? Auf diese Frage würde ich folgendermaßen antworten: Solange einer als Wissenschaftler fragt und forscht, das heißt, solange er unter einem speziellen partikulären Aspekt einen klar abgegrenzten Teilbereich der Realität erforscht [indem er etwa den Erreger einer bestimmten Infektionskrankheit zu ermitteln sucht oder indem er festzustellen trachtet, was eigentlich, physiologisch gesehen, des Näheren geschieht, wenn ein Mensch stirbt] – so lange ist er in der Tat auf jene Normvorstellung von kritischem Denken verpflichtet. Er darf, falls er nicht etwas wissenschaftlich Unverantwortliches tun will, nichts gelten lassen, das sich nicht durch positive Nachprüfbarkeit ausweisen kann. Aber: so wenig diese wissenschaftliche Betrachtungsweise entbehrt werden kann, so wenig genügt sie zur Darlebung der vollen geistigen Existenz des Menschen. Der aus dem vollen Lebensimpuls des Geistes existierende Mensch fragt nämlich unstillbar nach dem Ganzen der Realität und nach dem Gesamtzusammenhang der Welt. Auch wenn er es zunächst mit einem ganz speziellen und ganz konkreten Phänomen oder Geschehnis zu tun hat – er will wissen, wie es damit unter jedem denkbaren Aspekt letzten Grundes bestellt ist. Es genügt ihm nicht, zu erfahren, was [zum Beispiel] im Tode physiologisch geschieht. Er will, soweit nur eben möglich, das »komplette Faktum« kennen, the complete fact, wie der Harvard-Philosoph Alfred North Whitehead es formuliert hat. Und wenn »kritisch sein« so viel besagt wie »besorgt sein, dass etwas Bestimmtes nicht geschehe«, dann richtet sich seine Sorge eben hierauf: dass nur ja kein Element der Realität zugedeckt, übersehen, vergessen, unterschlagen werde – was sehr wohl auch geschehen könnte durch die Selbstbeschränkung des Geistes auf das, was man exakt nachprüfen kann. Hier also kommt eine andere Gestalt von kritischer Haltung in Sicht, für welche »kritisch sein« vor allem heißt: sich nur ja kein Element des Wahrheitsganzen entgehen zu lassen und deswegen eher eine weniger exakte Vergewisserung in Kauf zu nehmen als eine mögliche Einbuße an Wirklichkeitskontakt.
Solche Offenheit für das Ganze ist allerdings eine anspruchsvolle und schwer zu realisierende Sache, nicht weil dazu besondere Bildungsanforderungen erfüllt sein müssten, sondern weil dazu eine Unbefangenheit der Seele vorausgesetzt ist, die viel tiefer schweigt als die sogenannte wissenschaftliche Objektivität. Vonnöten ist ein Sich-Auftun der geheimsten Antwortkräfte der Seele, über das vielleicht unser bewusstes Wollen gar nicht mehr verfügt. Der zutreffendste Name für diese Haltung, den es gibt, ist wahrscheinlich das biblische Wort von der simplicitas, von der Einfältigkeit des Auges, wodurch es dann geschehe, dass unser ganzer Leib im Licht sei.
Es versteht sich von selbst, dass solche Haltung nichts zu tun hat mit irgendeiner neutralen Passivität. Zu ihrer Realisierung ist im Gegenteil die uneingedämmte Energie des geistigen Lebensvollzugs und zugleich die äußerste seismografische Empfindlichkeit und Wachheit des Herzens gefordert. Denn es gibt unendlich viele verborgene, oft genug kaum kenntliche Möglichkeiten des Sichverschließens. Es gibt zum Beispiel einen Mangel an Offenheit, der, ohne dass irgendein Gestus...