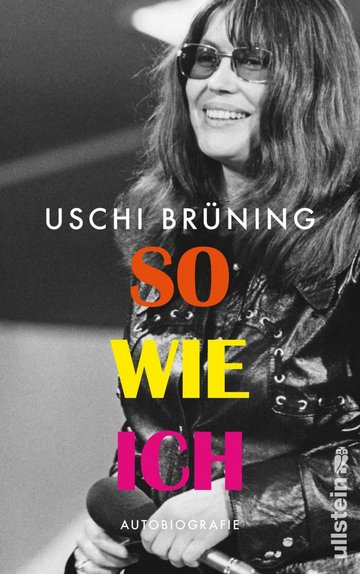Eine Kindheit in Leipzig
Am liebsten würde ich erzählen, mein Vater war Orgelspieler in Harlem und meine Mutter Gospelsängerin, und ich sang schon als Kind mit ihr zusammen im Gospelchor. Aber so war es nicht.
An dem Dienstag im März 1947, an dem ich als zweites Kind meiner Mutter Clärchen zur Welt kam, tat sich etwas in Leipzig. Zum zweiten Mal nach dem Krieg öffnete die Leipziger Messe ihre Tore zur Welt. In die fast wiederhergestellten Ausstellungshallen am Völkerschlachtdenkmal kamen 5000 Aussteller, davon 1350 aus den westlichen Besatzungszonen. Zum ersten Mal stellten auch »volkseigene Betriebe« aus der sowjetischen Zone, der späteren DDR, aus. Und die russischen Behörden teilten den Gaststätten zusätzliches Waschpulver zu, damit die Tischdecken sauber waren.
Am Tag meiner Geburt war der Himmel grau, es fiel leichter Schnee. Ob dieser Dienstag ein Glückstag für meine Mutter war, weil sie mich wirklich gewünscht hatte? Vielleicht, aber sie hatte bereits ein Kind allein großziehen müssen. Mit dessen Vater, einem Feinmechaniker, war sie nicht verheiratet gewesen. Er wohnte bei seiner Mutter und kümmerte sich nicht.
Mein Vater war Kraftfahrer. Ihn hatte Clärchen geheiratet. Aber er verschwand, als ich gerade ein Jahr alt war, und ich sah ihn so gut wie nie wieder. Einmal hat er uns zu Hause besucht. Da war ich fünf Jahre alt. Ein fremder Mann für mich, der meiner Schwester, die nicht seine Tochter war, etwas mitbrachte, mir aber nicht.
Wir drei, meine Mutter, meine fünf Jahre ältere Schwester Inge und ich, wohnten in der Marthastraße 3 im Osten von Leipzig, in der »Villa Bröckelputz«, wie meine Mutter sie nannte, in zwei kleinen Zimmern, Küche, Flur, Klo auf dem Hof. Das mussten wir uns mit den Mietern unter uns teilen. Bei Wind und Wetter die Treppen runter, und dann war es auch noch dauernd besetzt, weil der Mann von unten dort rauchte und Zeitung las. Für mich wurde das Klo auf dem Hof später so etwas wie ein Rückzugsort. Ich las da, endlich einmal ungestört.
Der Leipziger Osten war traditionell ein Arbeiterviertel. Die Häuser waren heruntergekommen, die Gegend galt als verrufen, daran änderte sich auch zu DDR-Zeiten nichts. Uns war das egal, auch wenn ich spürte, dass auf uns Kinder aus der Marthastraße von den Bewohnern der Reclamstraße, einem besseren Viertel jenseits des Rabet-Parks, herablassend geblickt wurde. Inzwischen gibt es die Marthastraße gar nicht mehr, das ganze Viertel wurde abgerissen.
Unsere Mutter war Kaffee- und Kaltmamsell, so hieß das, zuständig für die kalten Speisen und das Buffet. Sie arbeitete im Schichtdienst in einer Gaststätte des Leipziger Zoos. Das war praktisch, denn wir Kinder konnten sie besuchen, ohne Eintritt zu bezahlen. Wenn sie oft erst nachts nach Hause kam, war sie müde und erschöpft. Unterstützung bekam die Alleinerziehende nicht, auch nicht, nachdem die DDR gegründet worden war. Im Gegenteil: Weil sie nicht in die SED eintreten wollte – sie hatte noch vom BDM, dem Bund Deutscher Mädel aus der Nazizeit, genug –, wurde sie häufig für Spätschichten eingeteilt. Du hast ja keine Parteiversammlungen, hieß es.
Da es niemanden außer uns gab, keine Großeltern, keine Tanten und Onkel, waren wir Kinder uns oft selbst überlassen. Eigentlich konnten wir tun und lassen, was wir wollten. Wir streunten herum, spielten in Trümmern, die es noch reichlich gab, den Schlüssel um den Hals. Mich beeindruckten der Scherenschleifer, die Heißmangel oder der Eismann, der nicht Speiseeis brachte, sondern Eisblöcke oder Stangeneis zum Kühlen der Lebensmittel. Oder der Leierkastenmann mit seinem Äffchen.
Weil unsere Väter kaum oder gar nicht Unterhalt zahlten, kamen Vergnügungen oder Ausflüge nur selten infrage. Aber wir sangen viel miteinander. Unsere Mutter, bei aller Resolutheit eine romantische, verträumte Frau, konnte sogar leidlich Gitarre spielen. Als sie jung war, hatte sie sich ein anderes Leben erhofft. Doch ihr Traum scheiterte an den Umständen. Sie wollte Schauspielerin werden, wie es ihre Eltern waren. Als Laienschauspieler waren sie oft auf Tournee gewesen, und so kam es, dass meine Mutter in Magdeburg geboren wurde.
Clärchens Mutter kam aus einfachen Verhältnissen und wurde von den wohlhabenden Hamburger Schwiegereltern nicht gelitten. Sie erhielt auch keine Unterstützung, wenn ihr alkoholkranker Mann, unser Großvater, wieder einmal in eine Anstalt musste. Beide Großeltern, mütterlicher- und väterlicherseits, haben wir, meine Schwester und ich, nicht mehr kennengelernt.
Einmal wurde meine Mutter wegen ihrer geschwächten Gesundheit in ein Kinderferienlager gegeben. Dort bekam sie einen Ausschlag, der in Holland behandelt werden sollte. Was sich wie ein Ausflug anhört, endete in einer Katastrophe. Bei einer viel zu langen Bestrahlung verbrannte man ihr die Haarnerven. Die Folge: Die Haare wuchsen nie mehr nach. Ein kahler Schädel war damals noch kein Modetrend, kein Zeichen der Emanzipation und weiblicher Stärke, es gab noch keine Ikonen wie Sinéad O’Connor oder Grace Jones, die den rasierten Kopf zum eigenen Look machten.
Für unsere Mutter war es ein Verhängnis, ein Makel, ein tiefer Einschnitt ins Selbstbewusstsein. Immer, wenn jemand bei uns klopfte oder klingelte, suchten wir hektisch nach ihrer Perücke. Diese Verunsicherung, verbunden mit panischer Angst, hat sich auf uns Kinder übertragen, und es bedurfte einer großen Kraftanstrengung, sie abzulegen.
Eines Tages, als ich wieder einmal allein durch unser Viertel streunte, näherte sich mir ein Sittlichkeitsverbrecher, der sich in der Gegend herumtrieb. Er lockte mich mit dem Versprechen, mir etwas Süßes zu geben, in einen Hausflur und zeigte sich. Mit der Süßigkeit in der Hand lief ich davon, ahnte mehr, als ich es wusste, dass etwas passiert war, was nicht passieren sollte. Dieses Ereignis hat wohl den Ausschlag dafür gegeben, dass unsere Mutter beschloss, uns – ich war fünf, meine Schwester zehn Jahre alt – in die Obhut eines Heimes zu geben. Es war zu gefährlich geworden, uns allein zu lassen.
Wir kamen in ein etwa zehn Kilometer von zu Hause entferntes katholisches Kinderheim in Engelsdorf. Es war 1931 von Karmeliterinnen gegründet worden und trug den Namen »Sankt Josefsheim von der heiligen Gertrud«. Im sozialistischen Bildungsdiktat waren die kirchlichen Heime wahre Inseln der Lernfreiheit, staatlich verordnete Erziehungspläne wurden unter dem Dach der Kirche ignoriert. Dafür gab es Strenge und unbedingten Glauben.
Dort untergebracht zu werden fand ich nur furchtbar. Von heute auf morgen war ich ohne die geliebte Mutter, ohne die Schwester – weil sie älter war, kam sie in einen anderen Schlafsaal. Dass ich mit anderen Mädchen den großen Raum teilen musste, mit Betten in Reih und Glied, mit Gebeten vor dem Essen und vor dem Schlafengehen, dann Licht aus und Ruhe, damit wollte ich mich nicht abfinden, obgleich ich manches auch spannend fand. Und immerzu hatte ich Sehnsucht nach meiner Mutter, die nur selten zu Besuch kommen konnte. Meine Seele rebellierte. Ich wurde Bettnässer.
Am Tag der Einweisung hatten die Nonnen gesagt, dass es am nächsten Morgen in aller Frühe zur Messe ginge. Als Leipziger Kind freute ich mich auf den Besuch der berühmten Messe, auf die Aussicht, Karussell zu fahren. Das böse Erwachen kam am nächsten Morgen in der kalten Kirche. Da dämmerte mir, dass ein neuer Lebensabschnitt begonnen hatte.
Weil ich mich auflehnte, bekam ich die Unerbittlichkeit der Macht, das Wegsperren, das Bestrafen, bald zu spüren, verbunden mit dem ohnmächtigen Gefühl, einer unentrinnbaren, kalten Instanz hilflos ausgeliefert zu sein. Dass die Mutter uns besuchte, so oft es ihr möglich war, machte den Aufenthalt, das Heimweh nur noch schlimmer. Nicht nur einmal rissen wir, meine Schwester und ich, aus, schlugen uns ohne Geld mit der Straßenbahn und zu Fuß nach Hause durch, standen vor verschlossener Tür. Einmal ließ uns eine Nachbarin herein, aber wir warteten vergeblich auf unsere Mutter, die Nachtschicht in der Gaststätte im Zoo hatte.
Diesmal erhielten wir keine Strafe, als wir ins Heim zurückgebracht wurden. Die bekam ich für viel kleinere Vergehen. Einmal wurde ich auf dem dunklen Dachboden eingesperrt. Die Angst des fünfeinhalbjährigen Mädchens, nicht zu wissen, ob es jemals wieder herauskommt, ob es vergessen wird, vielleicht verhungert oder verdurstet oder ob ein Ungeheuer es verschlingt, war so groß, dass ich sie bis heute spüren kann.
Meine Einschulung erlebte ich noch als Heimkind in Engelsdorf. Ich kam in dieselbe Schule, in die meine Schwester bereits ging. An die Schule selbst habe ich keine deutlichen Erinnerungen mehr, wohl aber daran, dass meine Mutter da war und ich eine prall gefüllte Zuckertüte bekam. Damit hatte ich nicht gerechnet, denn meine Schwester war bei ihrer Einschulung leer ausgegangen – für solche Extras war kein Geld da. Das tut mir noch heute weh. Bei mir hatten es sich ein paar Nenntanten nicht nehmen lassen. Ich sollte nicht stigmatisiert werden, aber das war ich bereits.
Weil ich wegwollte aus dem Heim, zurück zu meiner Mutter, es aber nicht durfte, fand ich in mir einen Ausweg. Ich sang. Wenn ich sang, ging es mir besser. Dann fühlte ich mich lebendig, konnte vergessen, wo ich war. Die quälende Ungewissheit, ob diese Zeit der Trennung jemals enden würde, schwand vorübergehend.
Über zwei Jahre dauerte unser Zwangsaufenthalt, für ein Mädchen von fünf bis sieben Jahren eine endlose Zeit. Doch dann holte uns unsere Mutter zurück. Ein Festtag! Clärchen war sich jetzt gewiss, der schweren...