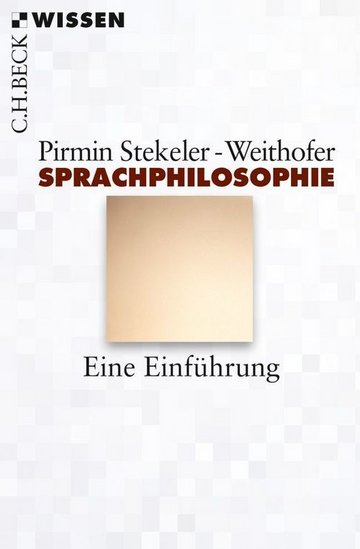I. Sprache und Bewusstsein
1. Das Innere der Seele
Dass es unser Verstand, unsere Vernunft, unser Denken oder unser Bewusstsein sei, das uns Menschen vom Tier unterscheidet, ist eine uralte Lehre. Aber wovon sprechen wir, wenn wir von der menschlichen Seele, dem atman des Menschen oder dem Ich sprechen? Was meinen wir, wenn wir von unserem Verstand, unserer Vernunft, unseren rationalen Fähigkeiten reden? Die Frage nach diesen Begriffen führt jeden, der nachdenkt, fast unmittelbar zu einem der wichtigsten Sonderthemen der Sprachphilosophie. Denn die logische Klärung dieser Begrifflichkeiten ist zentral für eine wirklich wissenschaftliche, und das heißt, sich ihrer Methoden der Darstellung von Wissen bewusste Anthropologie, Psychologie und Kognitionsforschung. Nur in einer begrifflich aufgeklärten Philosophie des Geistes kann aus bloßen Sammlungen empirischer Einzelkenntnisse über ‹intelligentes› Verhalten ein Wissen über unsere geistigen Fähigkeiten werden. Schon weil empirische Sachverhalte und sogar statistische Häufigkeiten sich rein zufällig ergeben können und daher jeder Einzelbericht über Historisches bloß erst als Anekdote zu werten ist, ist es eine irreführende Ausdrucksweise, wenn man sagt, die Sätze der Naturwissenschaft seien empirisch. Empirisch im engeren Sinn sind bloße Erzählungen a posteriori oder Aufzählungen von Daten. Empirisch sind auch einzelne Erwartungen, wie gut sie auch immer begründet sind. In der Wissenschaft formulieren wir aber allgemeine Aussagen, keine Berichte darüber, was einzelne Wissenschaftler empirisch wahrgenommen haben, und keine Prognosen, was bloß im Einzelfall geschehen wird. Die Theoreme sind als Ausdrücke für allgemeine Normalfallschlüsse unter entsprechenden Bedingungen zu lesen. Das heißt, wissenschaftliche Sätze artikulieren allgemein im Urteilen verwendbare Schlussformen. Theorien sind satzartige Beschreibungen von Modellen und anderen allgemeinen Orientierungshilfen. Sie sind nie rein schematisch zu gebrauchen, so wenig wie irgendeine Landkarte.
Eine zentrale Frage sprachphilosophischer Sinnanalyse, die in gewissem Sinn mit einer Logik im allgemeinsten Sinn des Wortes zusammenfällt, ist daher: Wie gelangen wir auf vernünftige Weise zu allgemeinen Wahrheiten? Die Frage ist wichtig, da diese Wahrheiten materialbegriffliche Voraussetzungen sinnvoller empirischer Aussagen sind. Sie leiten unser Schließen und Rechnen mit Möglichkeiten, auch in prognostischen Erwartungen. Denn wir verstehen empirische Aussagen nur, wenn wir schon wissen, wovon die Rede ist und was aus dem Gesagten normalerweise materialbegrifflich folgt. Sprachphilosophie wird hier zur Methode der sinnkritischen Analyse wissensbezogener Redeformen. Eine solche ist besonders wichtig für eine Aufhebung traditioneller Mystifizierungen unserer Rede über geistige Fähigkeiten, über geistige Inhalte und damit über uns selbst. Sie ermöglicht eine Kritik an der Überschätzung rein behavioraler, auch rein statistischer, erst recht bloß physiologischer Betrachtungsweisen von uns selbst. Die bloße Reaktion auf Wahrgenommenes ohne Urteil ist noch kein Wissen, keine Erkenntnis. Daraus ergibt sich eine Kritik an der naiven Unterstellung eines unmittelbaren Zugangs zur Welt. Dabei ist allgemeines Wissen von der Frage zu unterscheiden, was ein Einzelner über die Welt, dann aber auch über seine und unsere mentalen und schließlich unsere geistigen Eigenschaften, Fähigkeiten und Zustände weiß. Ein Einzelner kann nur wissen, was man wissen kann: Die Wahrheit seines Wissensanspruchs liegt nicht in seiner Macht, noch nicht einmal dessen allgemeine Anerkennbarkeit.
Mit der Frage nach der Wahrheit eng verbunden ist die ontologische Frage, was Natur, Welt und Wirklichkeit sind, also was wir mit diesen Titelwörtern begrifflich überschreiben. Wenn wir zum Wissen, Denken und Bewusstsein übergehen, fallen wir leicht auf die Metapher von einem Inneren herein, wie sie in unseren reflexionslogischen Reden praktisch überall auftritt. Indem man sie wörtlich nimmt, sucht man den Geist oder das Erkennen im Inneren des Leibes, heute vorzugsweise im Kopf, und identifiziert ihn sogar mit den Gehirnprozessen. Dabei lautet die wohl richtigere Antwort schon bei Heraklit, dass der Geist sich nicht in uns, sondern zwischen uns befindet – und dass das Besondere am menschlichen Bewusstsein und an seinen geistigen Fähigkeiten ganz eng mit der Sprachkompetenz zusammenhängt. Was dem Menschen als Geist oder daimōn erscheint, ist sein ēthos, sein charakteristisches soziales Benehmen und, beim Einzelnen, sein besonderer sozialpsychologischer Charakter, vermittelt durch Gewohnheiten. Wesentliches Moment des höheren Geistes, des Verstandes und der Vernunft, ist der logos, die Kompetenz des Erwerbs und der Beherrschung von Sprache.
Es ist selbstverständlich, dass das Gehirn gesund, also normal funktionsfähig sein muss, damit man geistige Fähigkeiten erwerben und erhalten kann. Doch die Untersuchungen der Normalfunktionen des neurophysiologischen Apparats liefern nur notwendige, noch keine hinreichenden Bedingungen des Denkvermögens und höheren Bewusstseins. Nur wenn wir mental und psychisch gesund sind, sind wir geistig gesund. Aber man kann auch ohne jeden neurophysiologischen oder mentalen Defekt geistig ‹verrückt› sein. Leibliche und psychologische Normalitäten sind keine hinreichenden Bedingungen für geistige Kompetenz – was man schon an Kaspar-Hauser-Fällen sehen kann. Kaspar Hauser konnte nicht sprechen und ebendeswegen vieles nicht verstehen. Es gibt vielerlei Arten kultureller, bildungsbezogener und ethischer Defekte, sogar im Kollektiv.
Zudem begann Platons Sokrates, die Schwierigkeiten unserer sprachlichen Artikulation geistiger Kompetenz zu erkennen. Er nennt dabei die Logik eines vernünftigen Dialogs «dialektikē technē». In dieser dialogischen Kunst entwickelt er unsere Fähigkeit, auf inhaltsrelevante Formen des richtigen Redens und Argumentierens zu achten. Dabei geraten immer mehr die Formen der Sprache in den Blick, wie sie auch schon der Herakliteer Kratylos thematisierte, wenn auch noch recht unvollkommen. Platon erkennt gegen die Rhetorik so genannter Sophisten, dass eingeschliffene Schemata des Urteilens und Folgerns in die Irre führen oder missbraucht werden können, wobei z.B. schon Parmenides auf das Prekäre der schematischen Unterstellung hingewiesen hatte, jeder Satz sei wahr oder falsch, ein Drittes gebe es nicht (‹tertium non datur›). Ein schönes Beispiel liefert die folgende Frage eines sophistischen Anwalts: «Hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen, ja oder nein?» Solche «paradox» genannten Fälle gehen vorbei (para) an der normalen Meinung (doxa), man könne stets mit «ja» oder «nein» antworten. Der Befragte muss daher die Frage und damit das ‹Prinzip› des Neuen Testaments ‹Eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein› zurückweisen.
Viele rein syntaktisch wohlgebildeten Sätze erfüllen das Prinzip Tertium non datur nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass sie oder ihre Verneinung (in jeder oder der relevanten Äußerungssituation) als wahr gelten können. Daher ist unbedingt zwischen einem bloß syntaktisch wohldefinierten Satz und einer semantisch wohldefinierten Aussage zu unterscheiden. Für Aussagen oder Propositionen muss also gelten, dass entweder sie selbst oder die negierte Aussage wahr ist. Ist das nicht der Fall, liegt ein Kategorienfehler vor. Solche Falschheiten nannte man früher unendlich falsch – Platon zeigt in seinem dem Parmenides gewidmeten Dialog viele Beispiele dafür. Es ist daher auch zu unterscheiden zwischen einem bloß phatischen Akt des reinen Sagens und einem schon rhetischen Akt des sinnvollen, gegebenenfalls behauptenden Aussagens, wie viel später John Longshaw Austin es nennen sollte. Aber schon Platons Dialektik erweist sich vor diesem Hintergrund als sinnkritische Reflexion auf Argumentationsschemata besonders des ‹indirekten Schließens›, also der ‹Begründung› einer Aussage durch Widerlegung des verneinten Satzes. So kann man z.B. aus der Falschheit des Satzes «Pegasus ist flügellos» nicht schließen, dass Pegasus Flügel hat und obendrein noch existiert.
2. Sprache als Thema einer philosophischen
Anthropologie
Die Sprache als Thema einer philosophischen Anthropologie tritt bei Aristoteles in besonders prägnanter Form auf. Der Mensch ist, wie Aristoteles einen Gedanken Heraklits in einer Art gnomischem Orakel oder philosophischem Merksatz zusammenfasst, dasjenige animalische Wesen, das Sprache besitzt. Das Wort «Tier» wäre hier irreführend, da es als Übersetzung des Wortes «bestia» in klarem Kontrast steht zum Begriff des Menschen. In der lateinischen Formel des «animal rationale» als Übersetzung von «zōon logon echōn» ist außerdem der explizite Bezug auf die Sprache verloren gegangen. Denn das Wort...