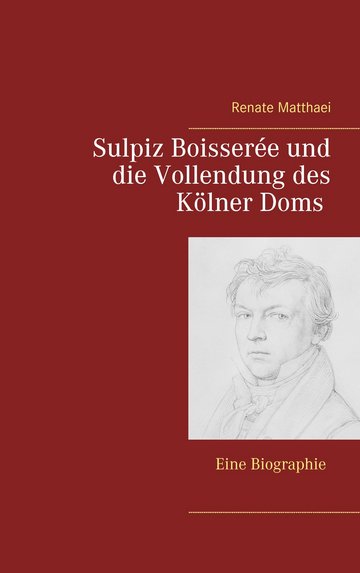Reise in die Romantik 1803 – 1804
Die Rückkehr in den Kölner Alltag war schwierig. Die Stadt kam Boisserée »öde« vor. Wahrscheinlich war sie das schon vorher gewesen, aber erst jetzt, im Vergleich mit der lebendigen Handelsstadt Hamburg, musste er sich eingestehen, dass die »längst verödete alte Reichsstadt« nun auch noch zu einer »französischen Provinzialgrenzstätte herabgesunken« war. Köln war an Anregung und Abwechslung noch ärmer geworden Die ständische Festgesellschaft mit den mehreren hundert kirchlichen und städtischen Feiern, die die Stadt als Gemeinschaft zusammengebracht hatten, war von den Franzosen aufgelöst worden. Neues war nicht an ihre Stelle getreten. Auch die Universität, die Impulse der Erneuerung an die Stadt hätte weiterleiten können, gab es seit 1798 nicht mehr. Die Selbstorganisation der Bürger in Gesellschaften und Vereinen, die sich später so zahlreich in Köln ausbreiten sollte, hatte noch nicht begonnen. Ein schmerzlicher Verlust kam hinzu: während Boisserées Abwesenheit war sein Freund und Lesepartner Schüll gestorben. Boisserée fühlte sich in dem »beschränkten Verhältnis« allein, auch das »Einerlei« in dem sonst so gemütlichen Familienkreis ging ihm auf die Nerven.
Die älteren Brüder versuchten, ihm den Übergang zu erleichtern. Sie räumten ein paar Zimmer in einem alten Gartenhaus frei, in die er sich mit seinen Studien zurückziehen konnte. Mit Perthes, der ihm »ausgesuchte Lektüre« schickte, hielt er engen Kontakt. Auch an seine Gesundheit wurde gedacht: ein Reitpferd sollte Bewegung und Zerstreuung verschaffen. Doch es half nichts, im Winter, als Boisserée die Lage als besonders drückend empfand, brach ein altes Leiden aus – ein Flechtenausschlag, der ihn schon in der Kindheit gequält hatte und ein Symptom einer ihn immer wieder heimsuchenden Verstimmung blieb. Gleichzeitig flüchtete sich seine Unruhe in die Fantasie. Er träumte von einem Leben in England, von großen Seereisen, von einer großartigen Veränderung jenseits der tristen Realität.
Tatsächlich ließ der Moment, der sein Leben in eine völlig neue Richtung lenken sollte, nicht lange auf sich warten. Köln hatte keine Sortimentsbuchhandlung, wohl aber Buchbindereien. Nach der Ostermesse trafen die literarischen Neuerscheinungen ein, um in der Buchbinderei zum Lesen »handbar« gemacht zu werden. Hier begegnete Boisserée eines Tages Johann Baptist Bertram, einem Jurastudenten, der ihn durch sein lebhaftes Benehmen und seine »geistreichen, oft kühnen Äußerungen über Literatur« sofort fesselte. Der Umgang mit älteren Männern, von denen er lernen konnte, war ihm vertraut. Aber noch nie hatte er einen jüngeren Mann (Bertram war damals 26) kennengelernt, der mit so viel Geist, Bildung und Überzeugungskraft sprach wie Bertram. Sofort zeigte sich, dass sie aus verschiedenen literarischen Lagern kamen. Bertram sprach mit Begeisterung von den Brüdern Schlegel, Boisserée, ganz Hamburger Schule, berief sich auf die Klassik Goethes und Schillers. Aus diesem Streit entwickelte sich ein Dauergespräch und sehr bald eine folgenreiche Freundschaft.
Bertram hatte in Erlangen Jura studiert und nebenher Vorlesungen über Kant und Fichte gehört. Er war ganz auf der Höhe des philosophischen Disputs und wusste von seinen Studien und dem Studentenleben so lebendig zu erzählen, dass etwas in Boisserée in Bewegung kam. Hatte er sich für den falschen Beruf entschieden? Er wusste, die trockene kaufmännische Arbeit lag ihm nicht, er wollte die geistige Auseinandersetzung, irgendeine Art wissenschaftlicher Tätigkeit. Bertram redete ihm zu, für ein Studium sei es mit seinen 19 Jahren noch nicht zu spät. Boisserée geriet in einen heftigen inneren Zwiespalt. Dann entschloss er sich, den Beruf aufzugeben und zu studieren. Über die Kämpfe, die anschließend in seiner Familie ausbrachen, gibt er nur spärlich Auskunft. Die Brüder waren enttäuscht, sie hatten mit seiner Mitarbeit im väterlichen Geschäft gerechnet, er hatte einen »guten Anlauf« gemacht und nun die Ungewissheit einer Laufbahn, deren Erfolg man nicht berechnen konnte. Schließlich gab die Entscheidung der Großmutter den Ausschlag. Sie besprach sich mit dem Mitvormund, einem Kölner Rechtsgelehrten, und beide gaben ihre Zustimmung. Er konnte studieren.
Von jetzt ab beschleunigten sich die Ereignisse. Bertram war, bewusst oder unbewusst, der Initiator. Boisserée wollte im Herbst 1803 in Jena studieren, Bertram hatte vor, ihn zu begleiten. Inzwischen war auch Melchior von Bertram beeindruckt. Er interessierte sich für Naturwissenschaften und hatte an der Zentralschule die Fächer Mathematik, Physik und Chemie gewählt. Er war damals gerade 17, und Literatur und Philosophie waren ihm weitgehend fremd. Bertram gelang es jedoch, das in kurzer Zeit zu ändern. Mit seinem ganzen pädagogischen Eifer gewann er Melchior für all die Ideen und Fragen, die ihn und Sulpiz umtrieben. Das war der erste Schritt zu einer ungewöhnlichen Dreiergemeinschaft, von der die Beteiligten damals noch nichts wussten.
Bertram war es auch, der vor dem Aufbruch nach Jena eine »kühne« Idee hatte: Sulpiz und er sollten vorher noch eine kurze »Ferienreise« nach Paris machen. Sulpiz war sofort dafür, Melchior wurde beredet mitzukommen. Paris, die »neue Weltstadt«, war damals begehrtestes Reiseziel, ein Muss vor allem für Künstler und Kunstinteressierte. Das Louvre-Museum zeigte zum ersten Mal die während der Revolution und unter Napoleon geraubten Kunstwerke, darunter die berühmtesten Gemälde aus Italien und den Niederlanden. Die alte religiöse Kunst, die vorher an den verschiedensten Orten in Europa verteilt gewesen war, konnte jetzt in großer Überschau an einem Platz besichtigt werden. Zusätzlich lockte nach Paris, dass sich Friedrich Schlegel dort seit über einem Jahr aufhielt. Er hatte als erster die entführten Gemälde, darunter auch einige altdeutsche Werke, in der neuen, von ihm redigierten Zeitschrift Europa beschrieben. In seiner komplexen Darstellung, die Historisches, Theoretisches und Ästhetisches verband, gab er den Bildern den Glanz eines völlig neuen Interesses. Boisserée war darauf inzwischen bestens vorbereitet. Er hatte, angeregt von Bertram, Wackenroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders und Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen gelesen. Beide Werke, die ersten »romantischen«, 1797 und 1798 erschienen, kamen spontan seinen eigenen Gefühlen entgegen. Sie entdeckten die Kunst und Architektur des deutschen Mittelalters neu, eingehüllt in den Nimbus eines religiös getönten Überschwangs. Wackenroder und Tieck hatten gemeinsam in Erlangen und Göttingen studiert und auf ihren Wanderungen den Reiz der in ihre Vergangenheit versunkenen Städte erlebt. Der wird für sie zum Auslöser eines Mythos der »goldenen Zeit«, mit Nürnberg und Dürer, dem »außerordentlichen Geist«, in dem »Kunst und Religion« sich vereinigten, als Mittelpunkt.
Auch Köln war in großen Teilen noch eine mittelalterliche Stadt, und die eigentümliche Mischung von Enge und monumentaler Größe hatte Boisserée schon als Kind erlebt und seine Aufmerksamkeit für die »großartigen Kirchen, namentlich den Dom« erregt. Die »öde« Stadt hatte auch diese Seite, und es muss ihn tief berührt haben, dass Ludwig Tieck in seinem Sternbald den Bildhauer beim Anblick des Straßburger Münsters sagen lässt: »… ich knie in Gedanken vor dem Geiste nieder, der diesen allmächtigen Bau entwarf und ausführte«. Und auch den »unvollendeten, mächtigen Bau in Köln« zählte Tieck zu den »hellsten Sternen« der gotischen Baukunst, »zu diesen Gebäuden, die vielleicht allein den Deutschen angehören, den Namen des Volkes unsterblich machen müssen«. Gleichzeitig hatte Boisserée die kunsttheoretischen Schriften Goethes und der Brüder Schlegel noch einmal mit neuer Aufmerksamkeit gelesen. Er verstand sich jetzt als Student, er wollte auch in der Kunst dazu lernen.
Paris war für ihn Pilgerfahrt und Bildungsreise zugleich. Die Familie erfuhr nichts von dem dreiwöchigen Abstecher, den die Drei als »Jugendstreich« interpretierten. In Düsseldorf besorgten sie sich bei einem der Kreditinstitute, die das Handelshaus Boisserée kannten, Geld, und dann ging es statt nach Jena los: über Aachen und Brüssel nach Paris. Am 20. September kamen sie an. Die »ungeheure« Stadt machte großen Eindruck. Eifrig arbeiteten sie das ganze Programm ab, das man von Parisreisenden damals erwartete: »… die großen Paraden des Ersten Consuls im Hof der Tuilerien, die Spuren der Revolution mit ihren schwarzen Inschriften: »Liberté, Egalité ou la mort: die Gärten, die Boulevards, die Theater, Bibliotheken und Kunstsammlungen, die Schlösser« usw. Auch Schlegel hatten sie ihre Aufwartung gemacht und waren von ihm und Dorothea Veit »wohlwollend« empfangen worden. Damit war die Zeit herumgeflogen, und es war wirklich nicht mehr als eine Bildungsreise gewesen.
Dann passierte etwas, das Boisserée in seinen Aufzeichnungen mit dem Sprichwort »Der Mensch denkt und Gott lenkt« umschrieben hat. Boisserée wurde krank, das Hautleiden brach aus, an Reisen war nicht zu denken. Jetzt kam das eigentliche Motiv der Reise wieder zum Vorschein. Schlegel fiel ihnen ein, und dass in seiner großen Wohnung noch einige Zimmer leer standen. Sie »fassten das Vertrauen«, Schlegel den Vorschlag zu machen, den Winter über bei ihm zu wohnen und seine Vorlesungen über Literatur zu hören. Alles »hart in Gold vorausbezahlt«, wie Helmine von Chézy, die als Auslandskorrespondentin der Cottaschen Allgemeinen Zeitung bei den Schlegels lebte, mitteilt. Sie war es auch, die die beiden Besuche der Kölner in ihren »Denkwürdigkeiten« beschrieben hat. Beim ersten Mal hatte der Portier »drei...