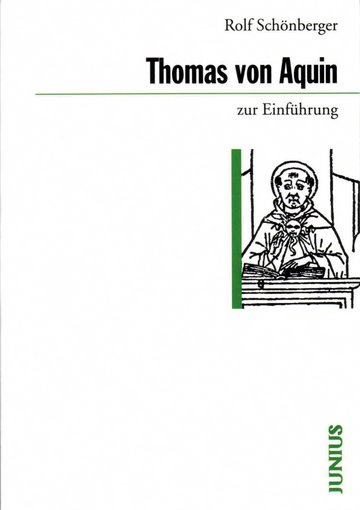2. Glaube und Vernunft, Theologie und Philosophie
Wir sagten, Thomas sei und verstünde sich als Theologe. Seine Theologie steht dabei jedoch dann auch noch vor der Herausforderung des wiederentdeckten Aristoteles. Erstens geht es in den Kontroversen des 13. Jahrhunderts fast immer auch darum, welches das rechte Verhältnis zum Aristotelismus als einer herausragenden Manifestation menschlicher Rationalität ist.
Was die Aristotelische Weltdeutung bedeuten könnte, war zunächst eine offene Frage. Mehrfach wurde versucht, der Gefahr, der konkurrenzlosen Attraktivität dieser Philosophie zu erliegen, dadurch zu begegnen, daß man die universitäre Auseinandersetzung damit unterbunden hat. Das Verbot öffentlicher Lektüre in Paris ist, als seine Aussichtslosigkeit klar geworden war, nach einiger Zeit gemildert und schließlich aufgehoben worden.
Albertus Magnus hat das Problem überhaupt erst gesehen, daß eine eigenständige Aneignung des Aristoteles, die sich auch gegenüber der arabischen Auslegungstradition und ihren möglichen Mißdeutungen zu behaupten vermag, erst noch zu leisten ist. Das ausdrücklich zur Aufgabe gestellte Vorhaben, Aristoteles den Lateinern verständlich zu machen, ist als eines der wenigen der scholastischen Riesenunternehmen tatsächlich vollendet worden. Erst in seiner späten Zeit hat dann auch Thomas sich der immensen Mühe der Aristoteles-Kommentierung unterzogen. Er tat dies dann, als bereits weitere antike Kommentare durch Wilhelm von Moerbeke in lateinischer Übersetzung zugänglich waren. Nirgends gibt er allerdings auch nur den leisesten Hinweis darauf, aus welchen Gründen er so handelte. Die Qualität dieser Kommentare wurde allseits anerkannt – trotz aller Kontroversen um einzelne Deutungen des Textes.
Zweitens geht die Philosophie schon in die Konstitution der Theologie selbst mit ein: Durchgängig kehren die Begriffe, die Beispiele, die Argumente des Aristoteles, aber auch anderer klassischer Autoren wieder. Die Theologie wird im 13. Jahrhundert Wissenschaft. Dies hat es zuvor nicht gegeben. Wissenschaft setzt nicht nur ein Bewußtsein von Methode voraus, sondern in diesem besonderen Fall auch die Bereitschaft, die eigene Unternehmung unter allgemeine Maßstäbe zu stellen. In den – nicht erst bei Thomas – angestellten Untersuchungen darüber, ob die Theologie eine Wissenschaft ist, wenn ja, in welchem Sinne, ist bereits allenthalben die Aristotelische Begrifflichkeit präsent.
Drittens ist die Philosophie aber nicht bloß ein Instrumentarium. Jede denkende Aneignung einer Philosophie modifiziert diese. Gedanken sind nicht identisch wiedergebbare Informationen. In seiner Aneignung der antiken Philosophie hat Thomas eben gerade nicht nur einen gewissermaßen diplomatischen Ausgleich gesucht, sondern seine eminent philosophische Begabung eingesetzt und eine neue Konzeption von Metaphysik entwickelt. Diese trockene Versicherung wird im nächsten Kapitel in ihrer Berechtigung vorgeführt werden. Ihr Inhalt ergibt sich jedoch niemals aus dem Begriff der Philosophie, den Thomas expliziert. Allenfalls in der faktischen Durchführung kann man sehen, daß er keineswegs sich dazu verpflichtet sieht, nur das Philosophie zu nennen, was sich auch selbst so nennt; er kennt – wie auch Albertus Magnus – einen normativen Gebrauch des Wortes. Man kann, glaube ich, den Grund, warum dem so ist, genau angeben. Wo er von der Inanspruchnahme der Philosophie spricht, meint er keine faktisch bereits vorliegende Größe, er versteht unter Philosophie einen Anspruch auf rationale Begründetheit – von dem immer noch zu prüfen ist, ob er denn zu Recht besteht. So kann er sagen: »Wenn sich aber unter den Aussagen der Philosophen etwas dem Glauben Entgegengesetztes findet, so ist dies nicht Philosophie, sondern vielmehr ein Mißbrauch der Philosophie, durch einen Mangel der Vernunft.« (In de trin., 2, 3; ed. Leon. L, 99)18 Das soll nicht heißen, unter dieser Voraussetzung ließe sich dann so etwas wie eine »christliche Philosophie« konzipieren. Dies wollte ganz offenkundig keiner der scholastischen Theologen, nicht weil alle dies abgelehnt hätten, sondern weil es für sie gar keine benennbare Möglichkeit war. Es kommt, wie aus jenen Texten ersichtlich werden soll, darauf an, wirklich philosophisch zu denken. Nur dann kann man sich darauf berufen. Die mittelalterliche Scholastik versteht also Philosophie nicht als einen vorliegenden Bestand, dessen Möglichkeiten sie sich instrumentalisierend bemächtigt, aber auch nicht als etwas, was in selbständigen Lehrbüchern neu formuliert werden sollte. Dies hat erst die Barockscholastik (Suarez) getan.
Thomas nimmt die mit dem Aristotelismus gegebene Herausforderung an. Ausgangspunkt hierfür muß aber die sachliche Frage sein: Wie verhalten sich Glaube und Vernunft zueinander? Diese, die christliche Tradition seit der durch Paulus initiierten Missionierung der hellenistischen Welt bewegende Frage wird im 13. Jahrhundert durch die Frage erweitert: Wie verhalten sich Theologie und Philosophie zueinander? Es ist für den modernen Leser vielleicht überraschend, aber eben doch sehr bezeichnend, daß Thomas die Notwendigkeit der Offenbarung angesichts der Philosophie zu begründen sucht. Die Summa theologiae beginnt mit der Frage: »Ist es notwendig, neben den philosophischen Disziplinen noch eine weitere Lehre zu haben?« (Sth. I, 1, 1) Dies setzt offensichtlich ein Verständnis von Philosophie voraus, das näher bei der Antike als der Neuzeit liegt. Philosophie hat ursprünglich den Charakter einer Lebensweise, sie ist nicht ausschließlich oder gar primär eine Disziplin des Wissens. Dieses Verständnis der Philosophie ist auf die Bestimmung des Menschen bezogen, genauer auf den Anspruch der Philosophie, den Menschen zu seiner Bestimmung zu führen. Die Frage, die Thomas hierbei stellt, lautet: Wenn die Philosophie den Menschen über seine letzte Bestimmung zureichend und angemessen aufzuklären vermag, führt sie ihn dann auch real zu dieser Bestimmung?
Philosophie und Theologie treten also mit Bezug auf die Sinnbestimmung des menschlichen Daseins in Konkurrenz. Für ein bewußtes Wesen ist aber ein Ziel nur dann erreichbar, wenn es auch erkannt wird. Die Frage nach der Kompetenz der Philosophie knüpft Thomas daher an die Erfüllbarkeit dieser Bedingung: Läßt sich die Bestimmung des Menschen so wissen, daß der Mensch, daß alle Menschen diese auch zu erreichen vermögen? Thomas’ Antwort ist eine doppelte: Er zeigt hier die Grenzen der menschlichen Vernunft. Dies sind aber weniger – wie etwa in der Kantischen Kritik – strukturelle Grenzen der Vernunft als Vermögen sowie immanente Gründe der Selbsttäuschung über diese Grenzen. Es sind dies vielmehr Defizienzen im faktischen Vernunftgebrauch. Das Gelingen menschlicher Einsicht dort, wo es ums Ganze der Wirklichkeit und seine Existenz geht, ist in der Philosophie an so anspruchsvolle Bedingungen geknüpft, daß die meisten Menschen faktisch von dieser Bestimmung ausgeschlossen blieben. Die Offenbarung macht nach Thomas prinzipiell allen Menschen möglich, was die Vernunft schon als abstraktes Vermögen genommen nur partiell, aber auch faktisch selbst im Glücksfall lediglich einzelnen vorbehielte. »So würde also, wenn einzig der Weg der Vernunft zum Erkennen Gottes offenstünde, das Menschengeschlecht in der größten Finsternis der Unwissenheit verbleiben, da die Gotteserkenntnis, die den Menschen im höchsten Maße vollkommen und gut macht, nur einigen wenigen, und auch diesen erst nach langer Zeit, zuteil würde.« (ScG I, 4 [24])
Die prinzipiellen Grenzen menschlicher Einsicht sind durchaus weiter gesteckt als das Niveau, das bei der vernünftigen Wahrheitssuche der Menschen in aller Regel erreicht wird. Philosophische Einsicht ist an eine bestimmte Begabung gebunden – die bei weitem nicht alle Menschen haben; Einsicht in die Bestimmung des menschlichen Lebens ist Resultat einer langen Bemühung – das menschliche Leben selbst ist aber kurz; das Erreichen des Ziels darf daher nicht an ganz seltene Glücksumstände gebunden werden. Und schließlich ist die Philosophie immer auch dem Irrtum ausgesetzt; das Vorgebrachte bleibt vielfach kontrovers: »[…] von Verschiedenen, die Weise genannt werden, wird Verschiedenes gelehrt.« (ScG I, 4 [25]) Man wird vielleicht einwenden, dies sei eben ein Kennzeichen des Wissenschaftsbetriebes. Doch dieser Einwand verkennt, daß es hier nicht um das Entwickeln von Theorien, um das kultivierte Erwägen von Problemlagen geht, sondern um nichts Geringeres als die Bestimmung des Menschen. Dieser Gesichtspunkt entspricht jedoch durchaus dem Selbstverständnis der antiken Philosophie, derjenigen also, die Thomas vor Augen hatte.
Die Maßstäbe dieser Diskussion sind ganz offensichtlich. Der Mensch soll seine Bestimmung nicht bloß per Zufall und insofern nur ausnahmsweise erreichen. Die Weise, wie ihm sein Ziel präsent ist, muß prinzipiell allen Menschen die Möglichkeit eröffnen, es zu erreichen. Diese universelle Form ist der Glaube. Dabei ergibt sich folgende paradoxe Proportion: Dem Inhalt nach ist die Wahrheit des Glaubens absolut untäuschbar, weil...