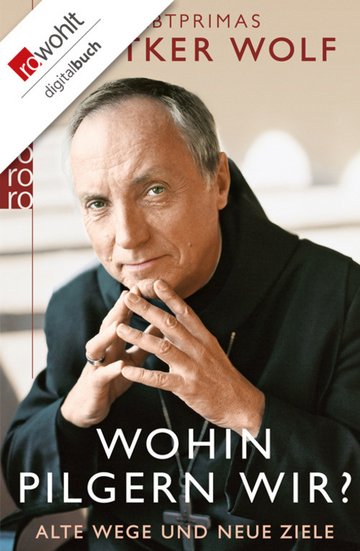1. «Ich bin aus meinem Jahrhundert ausgetreten»
Von dem Mut zum Experiment mit sich selbst
Kann man sich den Glauben erlaufen? Erwandern? Erpilgern? Kann man auf einer Pilgerfahrt Gott ganz unbeabsichtigt begegnen – oder überhaupt nicht?
Damals, mit sechzehn Jahren, als ich meine erste Wallfahrt antrat, hätte ich solche Fragen gar nicht verstanden. Der Glaube war unser Antrieb, unser Ansporn – was sonst hätte uns zu einem frommen Unternehmen beflügeln sollen, bei dem man Wind und Wetter und müden Knochen und Blasen an den Füßen trotzen musste? Und Blasen bekam man; die waren bei dem Schuhwerk, in dem wir uns auf den Weg machten, garantiert. Nein, wir verstanden uns als begeisterte Christen, die aus Kirche und Gemeindesaal ausbrechen und sich singend und betend die Landstraße erobern wollten, als wanderndes Gottesvölkchen gewissermaßen, auf dem Weg zu einem verheißungsvollen Ziel. Wobei wir es nicht wirklich auf eine Kraftprobe ankommen lassen wollten. Bei meiner schmächtigen Statur lag mir Heldentum ohnehin fern, auch frommes Heldentum. Mit dem Auto hätten wir unser Ziel in zwei Stunden erreicht. Aber wir wollten den Glauben mit einem besonderen Erlebnis, mit einer körperlichen Anstrengung und anderen Erfahrungen verbinden, die man im gewohnten Gemeindeleben nicht machen konnte, und all das war auch auf den hundertzwanzig Kilometern von München nach Altötting schon zu haben.
Wir liefen also los, in Doppelreihe, am Rand der Landstraße, etwa hundert junge Leute aus verschiedenen Orten, ein Kaplan vorweg. Es war das Jahr 1957, und es war die erste von drei Wallfahrten, die ich nach Altötting unternommen habe. Ich muss dazusagen: Ich gehörte damals der Legio Mariae an. Der Legion Mariens. Ein etwas kriegerischer Name, der sich der Marienbegeisterung der Iren verdankte. Dort, in Irland, war die Legio Mariae in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts als katholische Laienbewegung gegründet worden, und was mir daran gefiel, war die Kombination aus regelmäßigem Gebet und strategisch geplantem Einsatz für die Schwachen, für Alte und Kranke. Wer der Legio Mariae beitrat, der musste ran und wollte das auch, der investierte ein Gutteil seiner Freizeit in den Dienst am Nächsten, und ein Nebeneffekt unseres Eifers war diese Wallfahrt zum Marienheiligtum Altötting. Wie man jetzt unschwer errät, hatte ich damals eine Vorliebe für die Muttergottes, und die habe ich mir bis heute bewahrt. Ich gebe zu: Diese Vorliebe entsprang zu keiner Zeit einer hohen Theologie. Sie war und ist Ausdruck einer Alltagsfrömmigkeit, die sich nicht vom Verstand maßregeln lassen will, die schlicht und einfach aus dem Herzen kommt: Maria hat sich als Mutter um Jesus gekümmert, jetzt möge sie sich bitte auch um mich kümmern – so habe ich damals gedacht, so denke ich immer noch.
Gut, wir zogen also über Land, in langer Doppelreihe am Rand der asphaltierten Straße, von Autos weitgehend unbelästigt, denn der Verkehr war Ende der fünfziger Jahre spärlich. Da es zur Pfingstzeit war, mussten wir mit Regengüssen rechnen, hatten deshalb alle unsere Regenschirme dabei, und mit einem dieser Regenschirme dirigierte der Mann an der Spitze auch unseren Wechselgesang. Es wurde nämlich, solange wir liefen, fast ohne Unterlass gebetet und gesungen. Abwechselnd ging der Schirm nach rechts oder nach links, je nachdem, welche Reihe dran war. Das Vaterunser wechselte nach der Hälfte die Seite, das ganze Rosenkranzgebet verteilte sich auf rechts und links, und wenn die eine Reihe sich mit «Gegrüßet seist du, Maria» vernehmen ließ, antwortete die andere Seite mit «Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder». Und zwischendurch Marienlieder und Gotteslob, bis wir das halbe Gesangbuch durchhatten. Es kam vor, dass sich der Himmel verdunkelte und tatsächlich ein Schauer niederging; dann funktionierte die saubere Stimmentrennung nicht mehr, und eine gewisse Konfusion trat ein – was wir lustig fanden. Aufhalten aber konnte uns der Regen nicht.
Vorneweg wurde ein Kreuz geschleppt. Ein schweres Holzkreuz. Das wechselte jeweils nach einer Weile von einer Schulter auf eine andere, und wer es nicht mit großem Geschick ausbalancierte, den warf es um. Wir haben uns ordentlich damit herumgequält. Warum? Vielleicht, um schon mal etwas abzubüßen. Es mag sein, dass wir außerdem ein oder zwei Fahnen dabeihatten. Sicher bin ich mir nicht, aber wenn es so war, dann haben wir sie nicht als Triumphzeichen verstanden, sondern als weithin sichtbaren Ausdruck unserer Freude. Denn Freude hat es uns allen gemacht, das Laufen und Beten und Singen und Schleppen; die Pausen nicht zu vergessen, die Verschnaufpausen im kühlen und – was uns bisweilen noch willkommener war – trockenen Innenraum einer Kirche, mitunter auch an einem Wegkreuz oder einem Waldrand, wo man sich wieder sammelte, betete und meditierte oder einfach plauderte, bis die letzten Nachzügler eingetrudelt waren.
Ich erinnere mich gut, und ich erinnere mich gern an diese frühen Wallfahrten, und in besonders angenehmer Erinnerung sind mir die Übernachtungen geblieben. Am Ende des ersten Tages kamen wir in einer Schule unter, die von Schwestern geleitet wurde. Matratzen und Luftmatratzen waren in den Klassenräumen ausgelegt, und vor dem Schlafengehen bewirteten uns die freundlichen Ordensfrauen mit Malventee, wobei es jedes Mal hieß: «Darf ich noch etwas lauwarm nachgießen?» Und da wir in diesem Fall alle beisammen und noch durchaus munter waren, wurden nun zur Abwechslung weltliche Lieder gesungen, harmlose Fahrtenlieder, die sich unser Kaplan gleichwohl tagsüber streng verbeten hatte.
Am nächsten Abend wurden wir auf Privatleute verteilt, die sich – so war das damals – geehrt fühlten, junge Wallfahrer beherbergen zu dürfen. Der Name des Dorfs will mir nicht mehr einfallen, wohl aber erinnere ich mich deutlich an das Glück, das mir und meinem Freund (der heute Abt in Ostafrika ist) in jener zweiten Nacht beschieden war: In einem Krämerladen etwas außerhalb der Ortschaft erwartete uns eine liebe alte Dame mit Franzbranntwein und Heftpflaster und einem guten Essen. Sie ließ es sich nicht nehmen, unsere geschundenen Füße eigenhändig einzureiben und die Blasen vom Laufen in den harten Lederschuhen selbst zu verarzten, so besorgt war sie um uns. Auch die zwei Betten in der Schlafkammer über ihrem Tante-Emma-Laden sehe ich noch vor mir: alte Holzkistenbetten mit dreiteiliger Matratze und Plumeaus, in denen man schier ertrank. Hundemüde, wie wir waren, haben wir vorzüglich darin geschlafen.
Am späten Vormittag des dritten Tages war unser Ziel erreicht: Altötting, das traditionsreiche bayerische Marienheiligtum, auch damals schon der bedeutendste Wallfahrtsort in Deutschland. Und es tat gut, am Ziel zu sein. Allerdings wollten wir uns nicht gleich der Hochstimmung der Ankunft überlassen und drehten mit unserem Kreuz auf der Schulter noch etliche Runden um die Wallfahrtskirche, bevor wir uns auf dem Vorplatz der Basilika mit einer zweiten Pilgerschar aus Regensburg vereinigten. Als wir dann in die Basilika einzogen, waren wir eine ansehnliche Truppe. Die machte schon was her.
Den anschließenden Gottesdienst habe ich als erhebendes Erlebnis im Gedächtnis. Wir feierten die Messe als eine Gemeinschaft von jungen Leuten, die alle das Gleiche durchgemacht hatten, in der jeder die Erinnerungen an die Strapazen – und die Gebete – der letzten Tage mit dem anderen teilte. Und in die Genugtuung, nun am Ziel zu sein, dürfte sich ebenfalls bei jedem ein Quäntchen Stolz gemischt haben. Nach der Messe löste sich alles auf, das heißt, wir verteilten uns auf die umliegenden Wirtschaften, tranken unser erstes Bier, taten uns an Weißwürsten und hausgemachten Brezen gütlich, schrieben um die Wette Ansichtskarten und machten uns schließlich auf den Heimweg, vom Bahnhof aus, mit dem Zug. Mir steht noch das schwere Holzkreuz im Gang vor unserem Abteil vor Augen.
Ich befürchte, die Geschichte meiner ersten Wallfahrten wird ziemlich harmlos und doch irgendwie befremdlich in den Ohren moderner Menschen klingen, antiquiert wahrscheinlich und beinahe rührend. Und ich gebe zu: Der Anblick, den wir seinerzeit geboten haben, und der fromme Überschwang, mit dem wir unsere Lieder und Gebete zum nicht immer blauen bayerischen Himmel gesandt haben, das alles unterscheidet sich beträchtlich von dem Bild, das heutige Pilger mit ihren Hightechschuhen und Spezialrucksäcken bieten, wenn sie still für sich oder in kleinen Gruppen auf einer der mittlerweile so beliebten alten Pilgerrouten unterwegs sind, Hunderte von Kilometern vor sich und dabei so kräftig ausschreitend, dass ich selbst nicht lange mithalten könnte. Doch scheint mir die eine Art des Pilgerns mit der anderen mehr zu tun zu haben, als man auf den ersten Blick vermuten sollte. Sicher, unsere Wallfahrten damals waren Demonstrationen unseres Glaubens, und dass dieser Glaube eine fröhliche Angelegenheit war, durfte jeder mitbekommen. Aber was mir als beglückend daran in Erinnerung geblieben ist, sind Erfahrungen, die ein ungläubiger Mensch genauso schön gefunden hätte.
Allein schon, wie gelassen man mit einem Mal wird, mit wie viel Humor man die ganzen Widrigkeiten des Unternehmens auf die leichte Schulter nimmt, die schmerzenden Füße, die patschnassen Socken nach einem ergiebigen Schauer – als Pilger geht es einem eben doch um etwas anderes, etwas Höheres und Ernsteres, selbst wenn man dabei gar keinen Gedanken an Gott verschwendet. Uns hat jedenfalls keine Unbill etwas ausgemacht, und wenn einem doch mal der Mut zu sinken drohte, wurde er von Leidensgefährten mit stabilerem Gemüt wieder aufgemuntert.
Dann das Erlebnis der Gastfreundschaft. Von wildfremden Menschen bewirtet und umsorgt zu werden, so wie wir die...