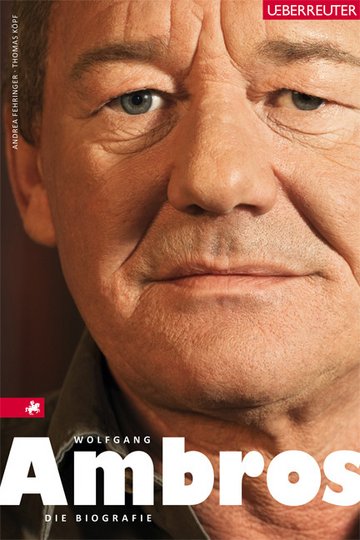1
Feuer und Flamme
Ich habe mein Leben lang mit dem Feuer gespielt. Und zwar allumfassend, im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinn. Was immer nur brandheiß oder gefährlich ausgeschaut hat, hat mich schon interessiert. Dass es mich heute, mit sechzig, überhaupt noch gibt, ist eigentlich ein Wunder.
Katzen haben sieben Leben. Ich habe offenbar zwölf. Ich bin fast in einer Regentonne ersoffen, ich hab mich ums Haar mit Tollkirschen vergiftet, mich hat’s mit dem Roller zerfetzt, ich bin beinah an der Malaria krepiert, mich hat’s von der Leiter gewichst, ich hab mich mit dem Auto überschlagen, mich hat’s von einem Denkmal runtergehaut, ich bin mit dem Motorboot auf einen Felsen gekracht, mich hat’s mit den Skiern zerrissen, ich hab den Krebs besiegt, ich hab mich verbrannt und dann hab ich mich in die Luft gesprengt.
Leser: »Ja, richtig, das war doch bei dem Grillunfall vor ein paar Jahren.«
Siehst du, und genau das wurmt mich. Dass alle Zeitungen geschrieben haben: Grillunfall, Grillunfall. Stimmt nicht. Es war kein Grillunfall. Weil Grillen kann ich nämlich wirklich gut, man kann sagen, da bin ich ein Weltmeister. An diesem Tag, es war der 30. April 2004, war ich daheim, damals noch in der Pfalzau bei Pressbaum, und das Ganze ist nur passiert, weil ich mich über eine Frau geärgert hab.
Über eine gewisse Ingold. Ich war gerade frisch von meiner damaligen Frau, der Margit, getrennt, das heißt, sie hat mich kaltherzig verlassen, und das mit der Ingold war so eine On-off-Beziehung, nichts Ernstes, ich war eigentlich nicht unzufrieden. Bis das Telefon scheppert, mich aus dem Schlaf reißt und die Ingold mir erzählt, wie müde und fertig sie ist. Ich frag noch blöd: Warum? Und erfahre, dass sie und eine Freundin, die sich auch immer wieder was eingebildet hat bei mir, die halbe Nacht irgendwelche Spielchen veranstaltet haben, von der Sorte, die man als Mann überhaupt nicht braucht. Ein echter Bringer um neun in der Früh.
»Na, super, you made my day, danke«, sag ich zur Ingold, hau das Telefon weg und bin schon angefressen.
Ich geh zum Fenster und schau hinaus in meinen Garten, die Sonne scheint, es ist schon ziemlich heiß für April. Ich zieh mir eine kurze Hose und ein Leiberl an, seh den Berg an stattlichem Grünschnitt und sonstigem Geäst, der so übers Jahr zusammenkommt, und sag zu ihm: So, und jetzt bist du dran.
Das Haus in der Pfalzau steht mitten im Wald. Was sich da auf den dreitausend Quadratmetern Grund von den Hecken, Bäumen und Sträuchern ansammelt, werfe ich über den Bach und verbrenne es. Unter Zuhilfenahme von fünf Litern Benzin, normalerweise im November. Aber in dem Winter hat es schon sehr früh geschneit und das Zeug war so nass, dass man es nicht anzünden konnte, deshalb ist der Haufen noch im April da gewesen.
Ich marschiere also in die Garage, hole den Kanister und denke überhaupt nicht weiter. Zum Beispiel, dass es nicht vier, fünf, sechs Grad hat wie im November, sondern schon zwanzig. Eine Temperatur, bei der Benzin verdampft. Ich sehe nur, dass der Haufen gut abgetrocknet ist, weil es die ganze Woche lang schön war und die Sonne draufgeschienen hat, und trotzdem glaube ich, ich mache alles wie gewohnt.
Ich leer den Sprit drauf, pass aber in meinem Zorn nicht genau auf, wie viel. Ich leg die Lunte, ein bissel zu kurz. Ich spür, es ist windstill, aber eine leichte Strömung ist immer, und die kommt auch noch unüblicherweise von Osten. Ich steh genau in der falschen Richtung und noch dazu mitten in einer Benzinwolke, die ich nicht wahrnehme, sauer, wie ich bin. Ich zünde das Streichholz an, zack, schmeiß es hin und wusch, kommt mir eine Feuerzunge entgegen. Sie leckt mich genüsslich ab, von unten nach oben. Und dann fliegt das Ganze in die Luft.
Mich schleudert es weg, ins taufeuchte Gras, in dem ich mich geistesgegenwärtig wälze und damit selber lösche. Vor mir brennt das Feuer hinauf, kerzengerade, eine flammende Säule von sieben, acht Metern. Und ich lieg da am Rücken auf dem nassen Boden und denk mir: Das ist das schönste Feuer, das ich je gemacht hab.
An sich bilde ich mir ein, dass ich ein wirklich guter Feuermacher bin. Ich mache Feuer, seit ich denken kann. Und alles, was ich da falsch gemacht habe, habe ich auch gewusst, ich hab’s nur nicht bedacht nach dem depperten Telefonat.
Jedenfalls, ich rapple mich irgendwie auf, stolpere ins Haus, natürlich kein Mensch daheim, gehe ins Badezimmer und sehe mich im Spiegel. Aha, die Augenbrauen sind weg. Sonst hat es nicht so arg ausgeschaut, alles einigermaßen rot halt. Trotzdem ist mir klar: So ganz von allein wird das wahrscheinlich nicht weggehen. Und dann rufe ich die Rettung.
»Stellen Sie sich unter die Dusche«, sagt mir der Notarzt am Telefon, »in nicht zu kaltes Wasser, sonst kriegen Sie einen Herzinfarkt, kühlen Sie die Haut, die brennt sonst nach.«
»Leiwand«, sage ich und geh mich brausen.
In dem Haus in der Pfalzau ist das Bad so gebaut, dass du durch ein riesiges Fenster direkt auf die Einfahrt siehst. Eine Großzügigkeit, die insofern möglich war, als wir hinter einer hohen Hecke versteckt sind und kein Fremder Zublick hat. Bis die Rettung kommt, bin ich schon immer dunkler geworden, und der Schock hat auch nachgelassen. Sie bandagieren mir das Gesicht und legen überall Mull auf, dann höre ich, wie ein Sanitäter nach einem Hubschrauber telefoniert.
Wie der da ist, geht alles ganz schnell. Sie verfrachten mich hinein, geben mir eine Spritze, ich spüre, dass ich ganz diesig werde, und falle fast in Ohnmacht, denk mir aber: Es wird schon gehen, es wird schon gehen.
Es ist eigentlich nicht gegangen. »Da dürften wir gerade noch einmal Glück gehabt haben«, sagt mir der Primar im Allgemeinen Krankenhaus in Wien zwar, aber an den Seiten, an den Füßen, an den Oberarmen und im Gesicht bin ich völlig verbrannt. Am schlimmsten am Ellbogen. Dreißig Prozent der Haut hin, ein Raub der Flammen. Da ist klar: Wir müssen operieren.
Die Notärztin erklärt mir sinngemäß: Wir können das nicht einfach verheilen lassen, das wird so schiach, das verschrumpelt mir komplett. Entweder können sie Kunsthaut verpflanzen, gezüchtete Hautzellen, die in eine Flüssigkeit eingelegt wurden und sich dort vermehren. Wenn das nicht geht, das könne man aber erst feststellen, wenn ich schon im Koma bin, dann müssen sie mir was vom Hintern herausschneiden und transplantieren, deswegen brauchen sie von mir vorher die Genehmigung.
Sage ich zur Ärztin: »Geh, wenn Sie das verhindern könnten, mein Arsch ist mein Kapital.«
Bevor man mich noch in den OP schiebt, bringen sie die ganze Geschichte schon im Radio. Grillunfall, der Ambros hat sich angezündet. Und dann in allen Medien. Grillunfall, Grillunfall. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wenn du so willst.
Die paar Tage bis zur Operation wollen sie mich ruhig stellen und mir sogar die Leibschüssel unterschieben. Ich hänge zwar am Tropf, aber bewegen kann ich mich, also gehe ich allein aufs Klo. Ich mach die Tür auf, steh direkt vorm Spiegel und seh einen Neger. Das darf man an sich nicht mehr sagen, aber ich pfeif auf diese ganze Political Correctness. So lange, wie ich schon zeitweise in Afrika lebe, ist das bei mir kein Schimpfwort. Jedenfalls, ich schau mein Gesicht an und ich bin schwarz. Über Nacht hat sich das aufs Tiefste verfärbt. Habe die Ehre, denk ich mir, super, mein Lieber, mhm.
Zwei Wochen später sitze ich auf der Bühne in Purkersdorf, bei strömendem Regen. Und ich sage bewusst: sitze, weil mir die künstlichen Hautzellen den Arsch gerettet haben. Im Publikum klatscht das halbe Spital, meine Krankenschwestern und Ärzte waren alle zu dem Konzert eingeladen. Sie haben mich wunderbar hingekriegt. Nur meine Augenbrauen sind nimmer dieselben und ich stecke teilweise in einer fremden Haut.
Leser: »Seit dem Grillunfall.«
Sehr witzig. Also bitte, noch einmal: Ich war schon selber schuld an dem Unfall, keine Frage. Aufgrund meiner emotionalen Aufgewühltheit war ich sehr unvorsichtig, wie man halt so ist, wenn man etwas sehr gut kann.
Feuer machen ist eine Kunst, und um die zu beherrschen, musst du ein paar grundlegende Sachen wissen. Die hab ich quasi studiert, über Jahrzehnte hinweg. Pass auf, ich sag sie dir:
Die sieben Regeln für das perfekte Lagerfeuer
- Das klassische Lagerfeuer beginnt damit, dass man den Platz, auf dem es brennen soll, einkreist. Man muss eine Fläche festlegen, sie ebnen, von Unrat befreien, respektive säubern, und dann das Ganze mit Steinen umgrenzen. Je größer das Feuer, desto größer die Steine.
- Danach macht man sich auf die Suche nach dem Holz. Die Wahl des Holzes ist das Um und Auf, ganz generell. Du nimmst trockenes, nach Möglichkeit am Baum verdorrtes Holz, das ist das allerbeste. Wenn du so was nicht findest: Such einfach weiter. Der Wienerwald zum Beispiel besteht hauptsächlich aus Buchen, es gibt schon Nadelhölzerbereiche, aber der Hauptanteil sind Buchen. Die sind insofern perfekt, weil sie hartes und fast rückstandsfrei verbrennendes Material darstellen. Jetzt gibt es in Buchenwäldern einen brutalen Verdrängungswettbewerb. Manche Buchen werden groß und viele, die aufgehen, wachsen in die Höhe, aber die anderen wachsen schneller, und irgendwann decken die einen die anderen zu. Dann kriegen sie kein Licht mehr und verdorren, bleiben aber als Stecken stehen. Das ist das Nonplusultra. Weil so ein Stecken in der Luft getrocknet ist und nicht auf dem Boden liegt, wo er von unten wieder feucht wird. Das ist der Idealfall.
- Man sucht also genau...