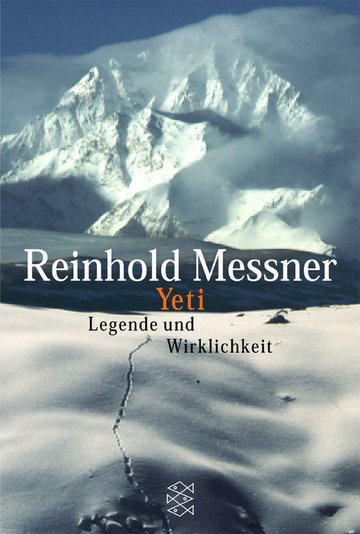Irgendwo in Tibet
An einem Hochsommernachmittag 1986, als mich das steigende Schmelzwasser des Mekong immer tiefer in eines seiner zahllosen Nebentäler trieb, gab es nur noch eines für mich: Ich mußte durch dieses tosende Wasser hindurch. Doch war ich wirklich auf dem richtigen Weg? Wo weiter? Und wie? Die Schlucht, in der ich mich befand, war so tief in den Fels eingeschnitten, daß ich die Übersicht verloren hatte und ziemlich ratlos war.
Die Gewalt der Strömung drohte mir bei jedem Schritt die Beine wegzureißen. Das eine mußte erst Halt finden, alle Kräfte spüren, bevor ich das zweite entlasten konnte. So stand ich, gestützt auf einen mannslangen Ast, schräg gegen die Strömung gestemmt, mitten im Wildbach und machte mir selbst Mut. Nein, zurück ging es nicht.
Das Ufer vor mir, einen Steinwurf weit entfernt, lag als dunkler Streifen zwischen Nadelbäumen und naßschwarzem Gestein. Die Flut war grau wie Nebel, kalt und so schnell, daß ich nicht hineinsehen durfte, um nicht schwindlig zu werden. Die Wasserspritzer schmeckten nach Fels und faulem Schnee. Zum Glück hatte ich die Schuhe anbehalten, als ich ins Wasser gestiegen war. So hatte ich wenigstens einen etwas festeren Stand zwischen den Steinen, doch jeder Schritt war gefährlich. Seit mir nach der Nanga-Parbat-Expedition 1970 sieben Zehen amputiert worden waren, hatte ich beim Durchqueren von Bergbächen Schwierigkeiten. Zudem war ich erschöpft und ganz auf mich allein gestellt.
Vorsichtig setzte ich den nächsten Schritt. Mit den Augen einen Stein am Ufer fixierend, schob ich den rechten Fuß in eine Mulde zwischen einigen Steinen unter dem brodelnden Wasser. Wenn der Schuh flach stand, galt es auszubalancieren und dem Untergrund zu vertrauen. Das rechte Bein belastend, den linken Fuß nachziehend und wieder zwischen Felsen schiebend, die ich vor mir unter dem Schmelzwasser ertastete, kam ich zentimeterweise voran, diagonal zur Strömung und flußaufwärts.
Von den Knien abwärts waren meine Beine gefühllos vor Kälte, im Gesicht stand mir der Schweiß. Meine Arme waren erschöpft vom Klammern und Stützen und dem Rudern in der Luft. Als ich mich endlich dem dunklen Ufer näherte, glühte ich vor Aufregung.
Wo genau ich war, wußte ich nicht. Ich kam von Qamdo und wollte weiter nach Nachu. Ich hatte die Täler einiger der größten Ströme Asiens gequert: Yangtse, Mekong, Salwen. Die Bergketten zwischen den von Norden nach Süden verlaufenden Flußtälern waren so zerklüftet und steil, daß Menschen nur an wenigen Stellen siedeln konnten. Von Dorf zu Dorf hatte ich mich durchgefragt und war oft zwei Tage lang marschiert, ohne einer einzigen Menschenseele zu begegnen.
Abseits der Straßen sind die Berge im Osten von Tibet schier unüberwindlich. Mit einer Yak-Karawane kam einer weiter oder mit den zähen tibetischen Ponys; allein und zu Fuß jedoch nur derjenige, der auf jeden Komfort verzichten konnte. Einen Schlafsack hatte ich im Rucksack, eine Stablampe, Speck und hartes Brot, ein Taschenmesser und einen Regenumhang. Aber keine Zahnbürste und kein Zelt. Wenn ich nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit in einen Weiler kam, schlief ich im Freien, in einer Höhle oder unter einem Baum.
Ich setzte mich auf einen trockenen Stein wenig oberhalb des Ufers und zog mir die Schuhe aus. Während ich die Strümpfe auswrang, wurde mir allmählich etwas wärmer. Wie beruhigend das Rauschen des Wassers jetzt klang! Vor mir lag ein unvorstellbar dichter Hochwald unter einer schrägstehenden Sonne. Dieser Wald war zu schaffen, wenn ich ihn vor dem Dunkelwerden durchsteigen konnte. Ich zog die nassen Strümpfe und die Schuhe wieder an, stand auf und nahm den Rucksack, der nach der Rast viel schwerer auf meinen Schultern lag als beim Überqueren des anschwellenden Gletscherwassers. Ich hatte unterschätzt, wie mühsam es war, eine Route durch das düstere Schattenreich zu finden, zwischen Unterholz, Felsen und Baumstämmen einen Weg zu bahnen und voranzukommen.
Diesmal war ich nicht nach Tibet gereist, um einen Berg zu besteigen oder eine Wüste zu durchqueren, ich wollte jenen Weg verfolgen, den das Volk der Sherpa bei seiner Flucht aus dem Gebiet von Dege über Qamdo, Alando, Lharigo, Lhasa, Tingri bis ins Khumbu-Gebiet genommen hatte: eine Völkerwanderung, die in vielen Überlieferungen der Sherpa immer noch nachklang. Diese Geschichte lag inzwischen ein paar Jahrhunderte zurück, doch ich wollte herausfinden, wie weit die Bilder aus der Überlieferung mit der Wirklichkeit übereinstimmten.
Zwischen Rhododendronbüschen und Berberitzen gab es kaum ein Vorwärtskommen. Das Dickicht war undurchdringlich wie ein tropischer Urwald. Ich versuchte mich zu erinnern, was mir die Einheimischen in den letzten Hütten auf meine Fragen nach dem Weiterweg geantwortet hatten.
Es war jetzt ganz still. Einzelne weiße Wolkenknäuel standen hoch oben über den schrägen Wipfeln der Koniferen. Im Himmel, der greifbar nahe schien, schwebten wie verloren ein paar Vögel über der Schlucht. Kaum ein Windhauch regte sich. Hatte nicht einer der Einheimischen, ein Yak-Hirte, angedeutet, das falsche Bachbett führe hinauf ins Nirgendwo? Zu Steinschlag und Lawinengefahr? In den Schluchten unterhalb der vergletscherten Bergkämme sollten sogar Ungeheuer leben, seltene Tiere, die zwischen dem Steppenland weiter im Norden und dieser zerklüfteten Gebirgslandschaft hin- und herwechselten!
Noch war Tag und gutes Wetter! Also stieg ich weiter, als ob ich auf der einzig richtigen Route wäre. Zwischen Felsen und den Stämmen jahrhundertealter Himalaja-Zedern kam ich jetzt besser voran als in Flußnähe, wo Hydrangien, Gänsekräuter, Dentzien, Clematis zwischen Rhododendrondickicht und Ahorn jede Spur überwucherten. Obwohl mich normalerweise tagsüber auch an den entlegensten Orten der Welt keine Ängstlichkeit befällt, suchte ich an diesem Tag immer öfter nach einem Wegzeichen, irgendwelchen Anhaltspunkten, nach einer Art Vergewisserung. Warum war ich so unruhig? Wann immer eine Steilstufe zu überwinden war, blieb ich stehen. Oft sank ich dabei in meiner Erschöpfung vornüber: die eine Hand aufs Knie gestützt, rastete ich unter der Last des Rucksacks und zählte meinen Puls. Aber der Blick auf die Schlucht brachte mir zu Bewußtsein, daß ich mich am Rand der Welt befand. Es war der 19. Juli, und ich war unterwegs nach Tschagu. Falls ich auf der richtigen Route war!
In all den Wochen, die ich schon zu Fuß unterwegs war, hatte ich Pfaden oder Steigspuren folgen können, mehrere Male hatte ich mich Yak-Karawanen angeschlossen, und immer hatte mir jemand den Weiterweg beschrieben, bevor ich allein zum nächsten Dorf aufgebrochen war. In Alando jedoch, wo ich eine Siedlung erwartet hatte, war kein Mensch gewesen, den ich hätte fragen können. Alando war nur ein Ort, kein Dorf. Kein einziges Haus war zu finden gewesen. Nicht einmal Steinmauern hatte ich gesehen und keine einzige Feuerstelle.
Auf einem moosbewachsenen Felsbrocken sitzend, holte ich eine Landkarte aus der Deckeltasche meines Rucksacks und schaute auf ein Gewirr von blauen und roten Linien auf braunem Grund; dazwischen Zahlen und Ortsnamen. Es war jedoch vollkommen aussichtslos, meinen Platz einem Punkt auf dem Papier zuordnen zu wollen. Wer hier verlorenging, den fand keiner mehr. Unschlüssig hockte ich da und starrte in die Hochgebirgswelt, aus der ich kam – Erinnerungen an anstrengende Tage drängten herauf. An manchen von ihnen war ich sechzehn Stunden auf den Beinen gewesen und hatte nicht einmal genug zu essen gehabt.
Zwischen die hohen Bäume fiel jetzt kein Sonnenstrahl mehr. Es war so kalt geworden, daß sich meine Haut unter dem schweißnassen Hemd zusammenzog. Gleichmäßig rollte irgendwo im Schluchtgrund das Schmelzwasser, das bald seinen Höchststand erreichen würde. Bevor es dunkel wurde, mußte ich irgendwo ankommen. Also weiter, ins nächste Dorf oder bis zu einer Alm über der Waldgrenze.
Als ich aufstand und mich bergwärts wandte, glänzten die vergletscherten Bergspitzen im Osten im schrägen Licht der Abendsonne, am Waldboden aber lag schon die Dämmerung. Im Augenblick, als ich mich in Bewegung setzte, sah ich keine zehn Schritte höher oben einen Steig. Hinter Bäumen und Unterholz war eine seichte Geländestufe zu erkennen. Ich stieg schneller. Fast mechanisch setzte ich meine Schritte und trat aus dem wuchernden Gestrüpp auf eine Waldlichtung: Da war deutlich ein Pfad, und mein Weg hatte wieder eine klare Richtung.
Endlich waren da Menschenspuren und der Weg, nach dem ich lange gesucht hatte. Ohne zu zögern, folgte ich ihm. Vorangetrieben von dieser Entschlossenheit, stieg ich, jetzt auf festem Grund, Tschagu entgegen, dem imaginären nächsten Dorf. Jetzt war das Steigen eine Lust, die mit jedem Atemzug noch wuchs und beim Ausatmen manchmal als tiefer Brustton aus mir herausbrach. Und dann, lautlos wie ein Gespenst, trat etwas Großes, Dunkles in eine Nische zwischen das Rhododendrongestrüpp, hinter dem sich der Steig dreißig Schritte weiter vorne verlor. Ein Yak, dachte ich und freute mich schon auf die Begegnung mit Tibetern, eine warme Mahlzeit am Abend sowie eine Behausung für die Nacht. Aber es blieb ganz still, kein Grunzen war zu hören und kein Pfeifen der Treiber. Lautlos und weich glitten behaarte Füße über den Waldboden, verschwanden, tauchten wieder auf, wurden schneller. Keine Äste und keine Gräben behinderten dieses Dahingleiten! Ein Yak konnte das nicht sein!
Ich war stehengeblieben. Mit angehaltenem Atem verfolgte ich die huschende dunkle Masse hinter einem Vorhang aus Laub und Astwerk. Was hatte diese Unruhe zwischen Ästen und Unterholz zu bedeuten? Wer oder was trabte da durch den Wald, allein und geschützt in der Dämmerung? Oder...