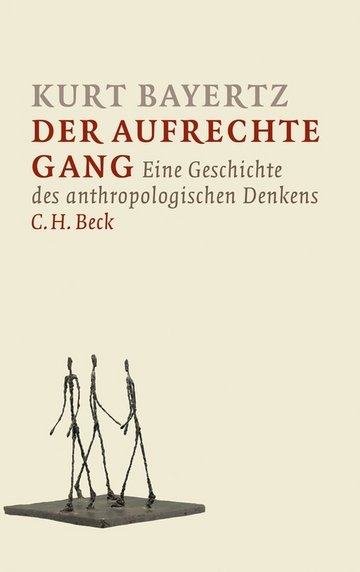1. Die Wendung nach innen
Aber das eigentliche Wesen des Menschen und was ihm demgemäß im Unterschied von den anderen zu tun oder zu leiden zukommt, das ist es, wonach [der Philosoph] sucht und unermüdlich forscht.
Platon
Obwohl die Wurzeln der von Ovid poetisch reformulierten klassischen Selbstdeutung des Menschen weit zurückreichen, wahrscheinlich über die Anfänge der Philosophie hinaus in den Mythos, sollte es sehr lange dauern, bis diese Selbstdeutung theorieförmig ausgearbeitet wurde. Von einem ausgeprägten Interesse am Menschen kann in der frühen Phase des philosophischen Denkens keine Rede sein. Wenn es eine Art natürlicher Reihenfolge gibt, in der die Dinge zu Bewusstsein kommen und zum Gegenstand des Denkens werden, dann steht der Mensch selbst nicht an ihrer Spitze! Die griechische Philosophie hat sich ihm erst spät zugewandt und an ihrer Entwicklung ist gut nachzuvollziehen, wie voraussetzungsreich die Idee des Menschen ist, wie lange es gedauert hat und wie viel Mühe aufgewandt werden musste, um sie klar zu erfassen. In seinen Anfängen richtete sich das griechische Denken bekanntlich vor allem auf die überwältigenden Phänomene ‹da draußen›, auf die leuchtenden Himmelskörper etwa, die ihre regelmäßigen Bahnen am nächtlichen Himmel ziehen. Es fragte also nach dem, was wir heute ‹Natur› nennen, und suchte sich ihre vielfältigen Erscheinungsformen zurechtzulegen. Wenn es richtig ist, dass die Philosophie mit der Verwunderung begann, so gehörte der Mensch damals nicht zu den Gegenständen, die Verwunderung hervorriefen. Bei genauerem Zusehen gibt es auch keinen Grund, etwas anderes zu erwarten. Denn was könnte gewöhnlicher und daher weniger verwunderlich für den Menschen sein, als jene Wesen, unter denen er aufgewachsen ist, mit denen er sein alltägliches Leben verbringt und von denen er selbst eins ist? Während die äußere Welt täglich aufs Neue Staunen hervorrufen und zum Anstoß des theoretischen Denkens werden konnte, gab sich der Mensch selbst keine Rätsel auf. Noch im fünften vorchristlichen Jahrhundert, als die allererste Jugend der Philosophie längst verstrichen war, charakterisierte Demokrit den Menschen als das Wesen, das wir alle kennen.[2] Warum hätte man über etwas eingehend nachdenken sollen, das alle kennen?
Dieses Desinteresse illustriert auch jene berühmte Anekdote aus vorsokratischer Zeit, die Platon im Theätet erzählt. Ihr zufolge war Thales von den Phänomenen am Himmel derart in Anspruch genommen und so sehr in den Blick «nach oben» vertieft, dass er einen Brunnen vor seinen Füßen übersah und hineinfiel. Eine Magd habe ihn daraufhin ausgelacht und ihm vorgehalten, das Studium der himmlischen Dinge halte ihn von der Erkenntnis dessen ab, «was vor der Nase und vor den Füßen liege». Dieser Spott, so lässt Platon sein Sprachrohr Sokrates kommentieren, passe auf jeden, der sich ganz der Philosophie verschrieben habe, denn ein solcher habe «keine Ahnung von seinem Nebenmann und Nachbar, nicht nur, was er betreibt, sondern beinahe, ob er überhaupt ein Mensch ist oder was sonst für eine Kreatur». (Tht. 174a-b) Die oft nacherzählte und gedeutete Thales-Anekdote macht auf den Gegensatz aufmerksam, der zwischen einer theoretischen Einstellung zur Welt und dem praktischen Leben in dieser Welt besteht; und auch auf die Risiken, die für den Theoretiker damit verbunden sind. Thales ist von seinen theoretischen Interessen so sehr absorbiert, dass er stürzt und sich vor der Magd lächerlich macht. Die Entfremdung des Theoretikers von den Menschen, die sich hier eher komödiantisch-harmlos ausnimmt, weist auf einen weit ernsteren Konflikt voraus, der dann später zur Verurteilung und Hinrichtung des Sokrates führen sollte. – Die Anekdote kann aber auch anders verstanden werden. Wir erfahren aus ihr ja, dass die theoretische Einstellung zur Welt und die Konzentration auf den Himmel mit einem theoretischen Desinteresse an dem scheinbar so naheliegenden Gegenstand ‹Mensch› verbunden war. Solange der Blick «nach oben» gerichtet bleibt, rangiert der «Nebenmann und Nachbar» unter den vielen Dingen, die zu sehr «vor der Nase und vor den Füßen» liegen, um mehr als nur beiläufig wahrgenommen zu werden. So verstanden, identifiziert die Anekdote einen Grund für das anthropologische Defizit der vorsokratischen Philosophie. Dass der Mensch in ihr nur am Rande vorkommt, ist kein Zufall, sondern Konsequenz einer bestimmten Ausrichtung der theoretischen Aufmerksamkeit.
Der anschließende Satz, den Platon Sokrates in den Mund legt, beginnt daher mit einem «aber» und plädiert für eine Neuausrichtung dieser Aufmerksamkeit. Er gibt eine Ultrakurzfassung des sokratischen Theorieprogramms: «Aber das eigentliche Wesen des Menschen und was ihm demgemäß im Unterschied von den anderen zu tun oder zu leiden zukommt, das ist es, wonach er sucht und unermüdlich forscht.» Die Theorie soll sich vom Himmel ab- und dem Menschen und seinen Angelegenheiten zuwenden. Damit wird ein Schritt in Richtung auf eine Theorie des Menschen getan und einige Interpreten haben tatsächlich von einer ‹anthropologischen Wende› bei Sokrates und der Sophistik allgemein gesprochen. Doch es war nur ein Schritt, der hier getan wurde, denn es geht Sokrates um das «eigentliche Wesen des Menschen» weniger aus anthropologischem als aus ethischem Interesse. Seine Fragen richten sich vornehmlich auf das, was dem Menschen aufgrund seines Wesens «zu tun oder zu leiden zukommt». Erst viele Jahrhunderte später, in der frühen Neuzeit, wird sich das Interesse am Menschen verselbstständigen; wird sich das anthropologische Denken von den ethischen, kosmischen oder theologischen Bezügen emanzipieren, an die es bis dahin gebunden war, und einen separaten Zweig der Theoriebildung austreiben. Davon ist Sokrates noch weit entfernt. Immerhin aber spricht er ausdrücklich vom «eigentlichen Wesen des Menschen» und wirft damit das Problem auf, das den Kern des anthropologischen Denkens bildet. Und zumindest in einem Dialog richtet er die von ihm in den Mittelpunkt seines philosophischen Ansatzes gerückte ‹Was-ist›-Frage auch auf den Menschen selbst.
Dabei handelt es sich um den im Altertum mit dem Untertitel Über die menschliche Natur versehenen Dialog Alkibiades I, der heute nicht mehr als authentischer Platon-Text gilt; da seine Entstehung im Umkreis der Akademie jedoch außer Zweifel steht, kann er als ‹platonisch› in einem weiteren Sinne gelten. In ihm stellt Sokrates direkt die Frage nach dem, was doch alle kennen: «Was ist nun also der Mensch?» (129e) Damit ist die Frage nach einer Definition des Menschen in der Welt; und es wird von nun an nicht an Bemühungen um eine Antwort fehlen. – Natürlich gibt Sokrates in Alkibiades I eine solche Antwort. Genauer: Er lässt eine Antwort geben. Zunächst konfrontiert er die Titelfigur des Dialogs mit drei Möglichkeiten: Der Mensch sei entweder Seele; oder Körper; oder aus beidem zusammengesetzt. Nachdem Alkibiades dies zugegeben hat, lenkt Sokrates das weitere Gespräch so, dass die zweite und dritte der genannten Möglichkeiten ausgeschieden werden. Es bleibt dann nur noch die erste, nämlich «daß die Seele der Mensch ist». (130b–c) Das ist natürlich eine eher einseitige Bestimmung. Sie geht weit über den ohnehin schon berüchtigten Leib-Seele-Dualismus hinaus, da sie den Körper und seine Gestalt für vollkommen irrelevant erklärt; irrelevant zumindest als definitorisches Merkmal. Uns interessiert hier aber nicht der darin liegende Extremismus, sondern der darin liegende Übergang von außen nach innen: Die Definition nimmt allein auf etwas Inneres, den Sinnen verborgenes Bezug. Wenn er zum Gegenstand des philosophischen Denkens wird, ergeht es dem Menschen nicht anders als beliebigen anderen Gegenständen: Seine sinnlich wahrnehmbare Gestalt tritt in den Hintergrund und eine hinter ihr liegende, ontologisch und epistemisch grundlegende Dimension wird hervorgehoben. Das körperliche Dasein des Menschen erscheint als eine bloße Oberfläche, hinter die zurückgegangen werden muss, um zu seinem «eigentlichen Wesen» vordringen zu können.
Mehr oder weniger stark ausgeprägt finden wir diese Tendenz auch im nachfolgenden anthropologischen Denken. Aristoteles, der die Frage ‹Was ist der Mensch?› häufiger stellt als sein Lehrer Platon, vollzieht in seinen berühmtesten und wirkmächtigsten Definitionen einen ähnlichen Übergang von der physischen Seite auf ein dahinterliegendes ‹Wesen›. Der Mensch wird in ihnen durch seine Vernunft- und Sprachbegabung (zoon logon echon) oder durch sein soziales Wesen (zoon politikon) bestimmt.[3] Beide Definitionen sind bis heute eng mit dem Namen Aristoteles’ verbunden und vor allem die erste von ihnen hat in der Philosophiegeschichte über viele Jahrhunderte hinweg eine geradezu kanonische Geltung besessen. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass wir uns (in der Innenperspektive) als denkende und sprechende Wesen erleben und diesen Tätigkeiten große Bedeutung zuschreiben. Zum anderen liegt es daran, dass wir (in der Außenperspektive) mit dem Rückgriff auf die...