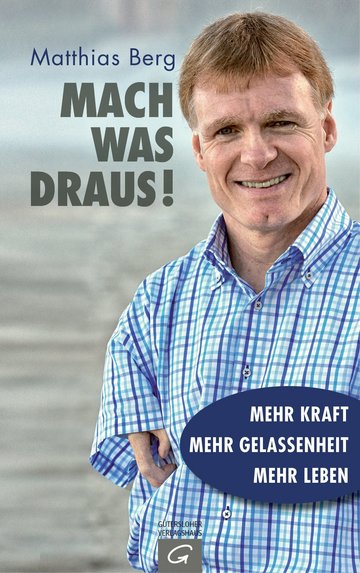MEDIZINISCHE EXPERIMENTE
Unterbrochen wird diese Unbeschwertheit der 60er Jahre von Zeit zu Zeit durch allerlei medizinische Tests, die an uns Contergan-Kindern vorgenommen werden. Schließlich wollen die Ärzte ja nur das Beste für uns – und da wird man dann ja wohl noch ein bisschen experimentieren dürfen! In Münster gibt es ein solches Experimentierzentrum. Wir werden dort immer wieder zusammengezogen, damit man den Eltern und uns zeigen kann, wie aus uns richtige Menschen werden können. Und ein richtiger Mensch hat nun mal eben alle Gliedmaßen, keine Diskussion, Basta! Also muss man doch für diese missgestalteten Menschlein künstliche Arme, Beine, Finger, Füße und was sonst noch fehlt, basteln und mit Schlingen, Lederriemen, Schnallen, Ösen und Metallgeschirren am kleinen Körperchen festzurren dürfen, bis sie kaum noch Luft kriegen. Das müssen die doch mögen, gefälligst! Man will ja nur, dass aus denen mal was wird!
Doch wie heißt es so treffend: Das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Es ist damals sehr schwer bis unmöglich, einige vom Experimentierwahn, Technik- und Fortschrittsglauben besoffene Ärztinnen und Ärzte davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, erst den Verstand einzuschalten, bevor man Eltern bevormundet und kleine Kinder quält. Leider setzen sich zu häufig die Halbgötter in Weiß durch. Und so ist man dann dort auf Station, mal nebeneinander liegend in Reih und Glied, mal über den Boden kriechend, mal stapft jemand auf stelzenartigen Metallstangen vorbei und meistens weint jemand irgendwo. Es ist eine ziemliche Schinderei, zuerst den Oberkörper eingegipst zu bekommen, damit die Passform stimmt, dann mit harten Riemen und Metallschnallen die Haut zuweilen wund zu scheuern, damit die bleischwere Prothese auch sitzt. Und mit den gummiüberzogenen Metall-Greiffingern, die sich durch Ein- und Ausatmen öffnen und wieder schließen, sieht man dann aus wie ein verzerrter Captain Hook-Verschnitt.
Wir Contergan-Kinder bieten so manchem Arzt hervorragende Profilierungschancen – die von diesen auch weidlich genutzt werden. Zur Ehrenrettung des gescholtenen Berufsstandes sei gesagt, dass dies natürlich eine holzschnittartige Pauschalierung ist und viele Ärztinnen und Ärzte den Kindern und Familien wichtige und hervorragende Unterstützung gegeben haben. Aber in den Kliniken habe ich vor allem die anderen kennengelernt.
Neben Profilierungsdrang und Allwissenheitsphantasien gibt es in dieser Zeit einen fatalen Denkfehler der Ärzte – manchmal auch der Familien. Es gibt nämlich einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen einer Behinderung, die jemanden im Verlauf des Lebens ereilt, und einer Behinderung von Geburt an: Im ersten Fall kennen Körper und vor allem das Gehirn den »Urzustand«, der sich durch ein Ereignis verändert. Jede Bewegung und jeder Gedanke unterliegt deshalb dem permanenten Abgleich von »alt«, so war es vorher = gut, und »neu«, so ist es heute = es fehlt etwas. Da macht es Sinn, alle Anstrengungen zu unternehmen, den Körper und das Gehirn durch Hilfsmittel wieder möglichst nah an den Urzustand zurückzuführen.
Bei einer Behinderung, die von Geburt an vorhanden ist, ist das aber anders. Der »Urzustand« ist der Zustand mit Behinderung. Körper und Gehirn bewerten diesen als »Original« und nicht als aufgezwungene Veränderung. Es gibt deshalb kein »alt« = gut und »neu« = es fehlt etwas. Diese Unterscheidung gibt es nur von außen betrachtet. Der Mensch, der von außen auf diesen Menschen mit Behinderung schaut, nimmt nämlich einen anderen Vergleich vor: Er oder sie vergleicht den einen Menschen mit einem anderen Menschen und stellt fest, dass bei dem einen etwas fehlt, was der andere hat. Also müsse es doch logisch und folge-»richtig« sein, dass man da etwas hinbastelt oder repariert, damit dieser Mensch so ist wie der andere.
Genau das ist aber der entscheidende Denkfehler, der dann auftritt, wenn man ein Problem nicht zu Ende denkt. Zur wahren Meisterschaft in Sachen Perspektivenwechsel bringt man es, wenn es gelingt, bei einem Menschen, der seine Behinderung von Geburt an hat, herauszufiltern, welche Art von Unterstützung dem aktuellen Zustand tatsächlich und wirklich förderlich ist. Dazu bedarf es einer Menge Feingefühl und der Fähigkeit, in die Haut des anderen zu schlüpfen und gedanklich mit seinen Sinnen wahrzunehmen, also mitzufühlen, ohne mitzuleiden.
Dieses Kunststück ist meinen Eltern ausgesprochen gut gelungen, vor allem, was den Zustand meiner Arme und Hände anbelangt. Sie sehen mit klarem Verstand, dass ich mit den Armen und Händen all das unternehmen kann, was auch meine beiden Geschwister machen: spielen, basteln, malen, essen, trinken und vieles mehr. Bis auf eine Ausnahme. Sie sehen, dass ich mich als Rechtshänder schwertue, Dinge mit der rechten Hand zu greifen. Das liegt an dem »Daumen« dieser Hand, der am mittleren Finger-Gelenk rechtwinklig und versteift abknickt, am Nagel in einer Art »Doppelfinger« endet und nur am Handansatz eine geringe Beweglichkeit hat. Zudem ist der Finger nicht im Gegengriff wie ein Daumen.
Diesen Finger lassen meine Eltern, als ich acht Jahre alt bin, in der Handklinik in Hamburg bei Prof. Dr. Buck-Gramcko operieren. Dieser ist spezialisiert auf Kinder-Handchirurgie, und er macht seine Sache hervorragend. Nach diversen Voruntersuchungen und in einer etwa sechsstündigen Operation setzt er den Finger in einen 90 Grad Gegengriff und begradigt und stabilisiert ihn mit diversen Nägeln. Auch wenn die Umstände des Aufenthalts in der Hamburger Klinik, vorsichtig formuliert, schwierig sind. Man legt mich dort direkt neben die Pathologie und will meiner Mutter den Besuch auf die damals üblichen zwei Stunden pro Tag reduzieren. Die aber kämpft wie eine Löwin und schleudert den Stationsschwestern entgegen, dass Grünenthal ihr Kind bereits körperlich verhunzt habe, sie lasse es sich jetzt nicht auch noch seelisch verhunzen. Damit war das Thema eingeschränkte Besuchszeiten erledigt, und sie war die meiste Zeit bei mir. Ich lag ja auch tatsächlich recht einsam – die Zimmernachbarn in der Pathologie waren nicht sonderlich gesprächig.
Die Zeit in Hamburg war eine ziemliche Schinderei, Tropf im Fußrücken, rechte Hand eingebunden, täglicher Verbandswechsel, bei dem jedes Mal die frisch operierte Haut bzw. der Schorf abgerissen wurde, das alles habe ich in äußerst schmerzhafter Erinnerung, wenngleich Prof. Buck-Gramcko täglich mit einem kleinen Spielzeugtier vorbeikam und sehr geduldig und freundlich war. Einige Schwestern waren übellaunige Furien. Nichtdestotrotz: Das Ergebnis und der neue Daumen sind ein voller Erfolg und im Alltag ein Segen.
Zu dieser Zeit bin ich am Ende der 2. Klasse in der Grundschule in Heiligenkirchen. In der ganz normalen Grundschule, nicht in der Sonderschule. Für diese Zeit ist das etwas Außergewöhnliches, denn meine Eltern haben bei der Schulanmeldung als Erstes zu hören bekommen, dass es für Kinder mit Contergan-Behinderung und kurzen Armen schließlich extra Sonderschulen gebe. Doch da kennen diese Herrschaften meine Mutter schlecht. Sie kontert damit, dass ich auf dem Büchenberg mit meinen Freunden zusammen sei und alles mitspielen würde, was die anderen Kinder so treiben, dass ich Stifte halten und damit malen und schreiben könne, dass ich ein aufgewecktes Kerlchen sei und dass es keinen vernünftigen Grund gebe, mich auf eine Sonderschule zu schicken. Ganz abgesehen davon wolle sie nicht, dass ich in aller Herrgottsfrühe von zu Hause weggekarrt und erst abends spät wieder zurückgebracht würde und aus dem Freundeskreis ebenso herausgerissen würde wie aus dem Familienleben.
Überraschenderweise ist es gar nicht mal die Grundschule, die sich querstellt, sondern es sind einige der anderen Eltern, die sich gegen meine Einschulung stemmen – natürlich hätten sie nichts gegen Behinderte, schon gar nicht gegen behinderte Kinder, aber für so was gebe es schließlich die Sonderschulen. Und dass die nächste Einrichtung für Contergan-Kinder im eineinhalb Stunden entfernten Münster sei, dafür könnten sie ja nichts, aber hier in der Grundschule sei eben nicht der Platz für so einen wie mich. Dahinter steckt die diffuse Angst, ein Mensch mit Behinderung sei per se schon mal nicht so leistungsfähig wie ein anderer. Mit einem solchen Kind in der Klasse gehe also alles ein wenig langsamer, der Lehrer müsse sich diesem Kind besonders zuwenden, dadurch stehe der Lernerfolg des eigenen Kindes auf dem Spiel und natürlich auch die Entwicklung und die Chancen im Leben allgemein. Im Ergebnis also: Ist behindert = wird aussortiert.
Aber nicht mit meiner Mutter. Sie spricht an der Stelle vor, an der die Entscheidung fällt, nämlich beim künftigen Klassenlehrer, Herrn Müller. Ihre Argumente fallen bei ihm auf fruchtbaren Boden. Durch seine langjährige Erfahrung als Lehrer in Brasilien schreckt ihn so schnell nichts mehr. Dort hatte er ein Sammelsurium aller nur vorstellbaren Schicksale in der Klasse versammelt, da ist so eine Körperbehinderung wie die meine eher undramatisch. Er hat deshalb den Mut und die Weitsicht, den Eltern und der verunsicherten Schulleitung zu sagen: »Jetzt schauen wir uns das mal ein halbes Jahr an und dann sehen wir weiter.« Damit fängt er geschickt auch die Gegnerinnen (es sind leider gerade die ehrgeizigen Mütter, die sich gegen meine Aufnahme wehren) ein. Also komme ich mit meinen Freunden vom Büchenberg in dieselbe Schule und alles geht glatt und reibungslos, eine Diskussion um mich findet nie wieder statt, der Sturm zieht sich ins Wasserglas zurück und verebbt. Dank des Einsatzes meiner Mutter ist damit eine wichtige Hürde genommen, die sicherlich meinen weiteren Weg ganz wesentlich beeinflusst. Und auch die...