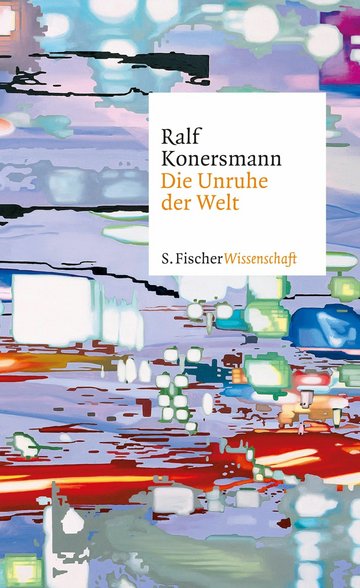Einleitung Der Genius der Unruhe
Was ist das glückliche Leben? Sorgenlosigkeit und beständige innere Ruhe.
L. Annaeus Seneca, Briefe an Lucilius (92,3)
Die Unruhe ist ein Daseinsgefühl, eine Welt voller Phantasien, voller Verheißungen und Pläne. Ihre Wucht und Überzeugungsstärke bezieht die Unruhe aus einer geläufigen Prosa des Begehrens, die sich in Bildern der Erneuerung und der Belebung ausspricht. Was den Ökonomen die Konkurrenz, der Aufschwung und das Wachstum, das ist den Künstlern die Steigerung des Ausdrucks und eine urwüchsig geltende Kreativität, die sich in Einzelprojekten auslebt und beweist, aber niemals verausgabt und erschöpft.
All dies versteht sich von selbst, geschieht beiläufig, jederzeit und überall. Bildungsziele kommen und gehen, Geschlechterrollen wechseln, Familienbilder wanken, und Religionen, einst auf Fels gebaut, definieren sich neu, als wäre das gar nichts. Der verbreitete Glaube an eine ursprüngliche Gefügigkeit der Dinge kennt kein größeres Ärgernis als das, was sich gleichbleibt. Verwaltungen und Behörden, eben noch der Inbegriff der Schwerfälligkeit und der lähmenden Vorschriften, sind in eine Endlosschleife aus Reform und Kontrolle eingetreten, und im Supermarkt um die Ecke veranschaulichen gewitzte Warenaufsteller von Woche zu Woche die verkaufsstrategische Variante der einst von bolschewistischen Aufrührern verbreiteten Parole der wahren, der permanenten Revolution.
Die Unruhe ist ein hoffnungsfrohes Taumeln, ein massenhaftes Sehnen und Drängen, das die Unterscheidung zwischen Treiben und Getriebensein nicht kennt. Ein weltlicher Adventismus regiert und macht sich selbst zum Zweck, die Welt erstrahlt in freudiger Erwartung. Handlungsziele treten zurück und weichen dem Bemühen, etwas – irgendetwas – zu bewegen und in ständiger Bewegung zu halten.
Die Konsequenzen dieser Grundausrichtung reichen weit. Aus der Warte der einmal angestoßenen, der sich selbst befeuernden Unruhe erscheinen Ziele als Ärgernisse, als Endpunkte und Hemmschwellen, an denen der kollektive Schwung erlahmt. In der Denkwelt der Unruhe haben deshalb Ziele allenfalls als Orientierungspunkte Bedeutung – nicht als Ankünfte, sondern als Übergänge. Nichts illustriert eindrucksvoller den Trend als die Ungeduld, mit der die Kunstszene heute verabschieden will, worum es Malern und Dichtern seit Menschengedenken gegangen war: um die Gestalt der gültigen Aussage, um das Werk. Die Hervorbringungen der Kunst sollten einmal schroff und unversöhnlich sein, terminale Erscheinungen und, so der junge Thomas Mann, »bürgerlich indiscutabel«. In der Welt der Unruhe ist es damit vorbei. Unter dem Regime der Unruhe wird gerade dies, nämlich der Aussage eine kühne und klarumrissene Gestalt zu geben, als unerträglich empfunden. Auf die Idee des Kunstwerks, gegenüber der Vergänglichkeit der Welt ein selbständiges, ein von Nutzanwendungen freies und in sich geschlossenes Sein zu statuieren, antwortet der Genius der Unruhe mit transitorischen Gebilden, mit der Proklamation des Unvollendeten, des Brüchigen, des Interaktiven und zartlinig Hingestrichelten. Die Unruhe löst die Kunstwerke aus dem Rahmen und revolutioniert damit zugleich deren Begriff. Wo einmal das Werk war, soll nun die Aktion sein, und wo das künstlerische Sprechen dicht und welterschließend sein wollte, genügt jetzt der Effekt der Verunsicherung. Das Kunstwerk, das selbst einmal etwas sein wollte, stellt sich als Medium zur Verfügung, als kreativer, auf die Bedingungen der Unruhe abgestimmter Interaktionsanreiz. Inzwischen endet kein Song mehr mit Schlussakkorden, die Stücke fransen einfach aus, und kein Regisseur käme mehr auf die Idee, das ›Ende‹ seines Films sichtbar anzuzeigen, um es zu vollziehen.
In der Summe verleihen diese kleinen und kleinsten Signale der stillschweigenden Überzeugung Ausdruck, dass nicht dieser Augenblick zählt, das Hier und Jetzt, sondern immer nur der nächste. Die Unruhe kennt keine Resultate, sondern nur lose Enden, die neue Anfänge, Übergänge und Anschlüsse sind. Sie ist der Aufbruch in Permanenz, die systemische Ziellosigkeit. Natürlich will auch sie etwas bewirken, auch sie lockt mit der Aussicht auf Erfüllung. Viel näher aber liegt der Unruhe die Sorge, die Bewegung könnte stocken und überhaupt zum Stillstand kommen. Daher die gereizten Reaktionen auf alles, was nach einer klaren Entscheidung, nach Festlegung und Endgültigkeit aussieht. Unter dem Regime der Unruhe weicht die hergebrachte Orientierung an Zielen und Zwecksetzungen, an Bleibendem und Dauerndem, einer authentischen Ethik des grenzenlosen Wandels und des fortgesetzten Aufschubs, die nur noch Vorläufigkeiten kennt. Es gehört zu den Eigenwilligkeiten dieses metamorphen Geschehens, dass selbst diejenigen es vorantreiben, die sich ihm – aus welchen Gründen auch immer – in den Weg stellen. Als naher Verwandter der Unruhe trägt der Widerstreit das Seine dazu bei, dass die Gesamtbewegung im Schwung bleibt, anders gesagt: dass von den Vorläufigkeiten kein Weg zu den Endgültigkeiten zurückführt.
Gerade da, wo er am heftigsten ist, kehrt sich der Widerstand gegen sich selbst und wird der Unruhe zur leichten Beute. Die Folge ist, dass die Aktionen sich von selbst verstehen, zumal in der Politik. In der Sprache des Politischen ist die Unruhe unmittelbar wertebildend und hat Aktionsbereitschaft und Zustimmungsfähigkeit, energischen Veränderungswillen und demokratisches Selbstverständnis miteinander verschmelzen lassen. Die klassische Unterscheidung von Links und Rechts, von überzeugten Veränderern und bekennenden Bewahrern, hat darüber jeden Sinn verloren. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt wie es ist, schrieb Giuseppe Tomasi di Lampedusa in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, muss sich alles ändern. Das aktionistische Kalkül des konservativen Schriftstellers ist aufschlussreich. Es zeigt, wie konsequent die Gebote der Mobilmachung die überkommenen, auf Geltung und Bewahrung bedachten Orientierungen aus den Angeln gehoben und Zug um Zug entwertet haben.
Dabei lebt die Politik den negativen Konsens der unbedingten Vermeidung von Staus und Stillständen nur exemplarisch und im Rampenlicht der Medienbühne weithin sichtbar vor. Weniger spektakulär, aber umso durchgreifender regiert die zeitgenössische Kardinaltugend der Flexibilität. Wer flexibel sein will, muss bei der Wahl seines Arbeitsplatzes, seines Wohnortes und seines Lebenspartners beweglich und jederzeit bereit sein, die einmal getroffene Entscheidung zu überdenken. Flexibilität verlangt ironische Selbstdistanz, pragmatischen Werterelativismus, ein ausgeprägtes Faible für Neues und Anderes, die Sicherstellung sowohl der Leistungsfähigkeit als auch der Erreichbarkeit, die grundsätzliche Bereitschaft zu körperlicher und geistiger Optimierung sowie eine kritische Aufmerksamkeit für Fixierungen, Blockaden und Routinen. Der Strenge dieses Forderungskatalogs unterliegen auch die gesellschaftlich anerkannten Auszeiten. Erschöpfungspausen – Sonntage, Freizeiten, Urlaube – dienen nicht der Muße, die vorzeiten einen schmerzfreien Körper und ein sorgenfreies Gemüt versprach, sondern der Wiederherstellung der Kräfte. Die Auszeit ist ein Intervall, das wir uns zugestehen, solange nur die Verbindung mit dem Trubel nicht abreißt. Und hat man nicht die Langeweile und sogar die Faulheit und den Müßiggang gepriesen, weil sie produktiv seien, produktiver noch als die Arbeit, die Fitness und der Fleiß? Im Zeichen der creative economy haben sich Ökonomen und Kulturmanager, Betriebspsychologen und Unternehmensberater zusammengetan und das einst von Romantikern ersonnene Paradox des schöpferischen Nichtstuns ausgegraben, um es nun erneut als das Mittel der Wahl zu empfehlen. Es gilt, den Erfindungsgeist anzustacheln, neue Ressourcen zu erschließen und die Effizienz nochmals zu steigern. Die Begeisterung für kreative Impulse ist grenzenlos: Kreativ ist, wer das Unerwartete, das schlechthin Andere wagt und uns die Welt interessant zu machen weiß. Allerdings soll der kreative Input nachhaltig sein, und wenigstens auf der Steuerungsebene möchte man unterscheiden können zwischen blindem Aktionismus und durchgreifender Veränderung, zwischen »rasendem Stillstand« und echter Innovation. Sobald der Unterschied entfällt und die Veränderung eins wird mit ihrer Simulation, sind die Anhänger des Fortschritts vor das Problem der Authentizität gestellt.
Die Stärke ihrer Attraktion ist überwältigend und trägt die Unruhe über Bedenklichkeiten mühelos hinweg. Die Erwartungen, die wir der einzelnen Aktion und dem Wandel ganz allgemein entgegenbringen, die Selbstverständlichkeit, mit der wir uns für welche Veränderung auch immer bereithalten, und die Gründlichkeit, mit der wir sogar die Auszeiten einer Art Aktivismus der Ruhe unterwerfen – all dies sind Indizien für das unbedingte Kulturprimat der Unruhe. Die Kritik mindert die normative Kraft des Phänomens keineswegs. Die Unruhe ist ein Kult, dessen Rituale befolgt und nicht nur strengstens eingehalten, sondern auch fraktionsübergreifend bejaht und eingefordert werden. Eines Programms oder förmlichen Bekenntnisses bedarf es nicht. Die Unruhe ist eine Macht, die ihre Wirkung im Stillen entfaltet – eine Macht, die keine Geschichte hat und ebenso wenig ein Gesicht. Umso ungestörter beherrscht die Unruhe das Terrain der stillschweigenden Übereinkünfte, die, noch bevor wir die Argumente wägen und unsere Entscheidungen treffen, unserem Handeln vorgegriffen und uns ihren Rhythmus auferlegt haben.
Die folgenden Seiten...