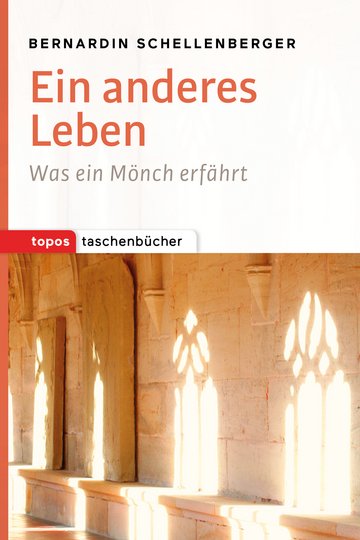I. Ein ganz anderes Leben
Das romantische Missverständnis
Vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhundert gehörte zum Bestand der höfischen Parks und Anlagen neben dem Gehege mit seltenen exotischen Tieren eine malerisch eingerichtete Einsiedelei, nach Möglichkeit mit einem „richtigen“ Eremiten. Diese „Ziereremiten“, wie man sie in England nannte, sind sozusagen die Vorläufer unserer Gartenzwerge. Ziereremit zu sein war ein regelrechter Beruf, und wenn eine Stelle vakant geworden war, konnte es geschehen, dass der Arbeitgeber durch eine Zeitungsannonce einen neuen Mann suchte. In einem Inserat Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb Charles Hamilton für die Eremitage im Park von Pain’s Hill in Surrey folgende Bedingungen aus: „Der Eremit soll mindestens sieben Jahre in der Eremitage bleiben. Er wird mit einer Bibel, mit optischen Gläsern, einer Fußmatte, einem Betschemel, einem Stundenglas, mit Wasser und Nahrung vom Hause versehen werden. Er muss eine Kamelottrobe tragen und darf sich nie, unter keinen Umständen, das Haar, den Bart oder die Nägel schneiden, noch den Grundbesitz von Mr. Hamilton verlassen oder mit dessen Dienern sprechen.“ Nach sieben Jahren Eremitenlebens sollten diesem Einsiedler 700 Pfund ausgezahlt werden. Der schließlich eingestellte Eremit musste aber schon nach drei Wochen wieder entlassen werden, weil er unerlaubterweise in ein Wirtshaus geschlichen war. Mr. Hamilton legte offensichtlich Wert auf ein „authentisches“ Eremitenleben.
Ließ sich kein lebendiger Einsiedler anheuern, so tat es auch eine lebensgroße Einsiedlerfigur. Jean Paul beschreibt 1793 die Bayreuther Eremitage: „… neun bemooste Klafter Holz […] Die Klafter umrangen eine Klause, die man – weil am ganzen Hofe keine Seele zu einem lebendigen Einsiedler Ansatz hatte – einem hölzernen anvertraute, der still und mit Verstand darin saß und so viel meditierte und bedachte, als einem solchen Manne möglich ist. Man hatte den Anachoreten aus der Scheerauischen Schulbibliothek mit einigen aszetischen Werken versehen, die für ihn recht passten und ihn zu einer Abtötung des Fleisches ermahnten, die er schon hatte …“
Diese Einsiedelei besuchten die Damen und Herren des Hofes, wenn sie im Park lustwandelten, um sich von einem romantischen heiligen Schauer anrühren zu lassen. In Bayreuth spielte Anfang des 18. Jahrhunderts der Markgraf Georg Wilhelm mit seiner Gemahlin Wilhelmine – der Schwester des aufgeklärten Friedrich des Großen – und seinem Hof zuweilen gar selbst Eremit. Die ganze Gesellschaft hüllte sich in malerische Einsiedlerkutten, logierte in kleinen, aus Tuffstein gebauten Höhlen, die über den Wald verstreut und durch unregelmäßig geschlängelte Pfade mit dem Hauptbau verbunden waren, und ein Glöcklein rief die Herrschaften zum Gebet.
Den Sinn einer solchen Einrichtung gibt C.C.L. Hirschfeld in seinem umfassenden Werk „Theorie der Gartenkunst“ (Leipzig 1780) an: Die beim Anblick solcher Einsiedeleien erwachende Erinnerung habe „eine Kraft zu Rührungen, die ein Herz, das nicht allein für die Welt empfindet, gern bei sich unterhält. Ich weiß nicht, warum wir solche Bilder nicht wieder erneuern sollen, die Veranlassung zu sanften und der menschlichen Würde so angemessenen Empfindungen sind. Es ist schon eine Äußerung von Tugend, wenn uns die Denkmäler der Tugend erwärmen; und man nähert sich schon um einige Schritte der Frömmigkeit, wenn man den Ort ehrwürdig findet, wo ein frommer Mann in Anbetung liegt.“ In der Eremitage im Park zu Hagley fand sich eine Inschrift nach Miltons „Penseroso“, die Hirschfeld so „sehr passend“ fand, dass er sie abdruckte: „Möchte ich doch in meinem entkräfteten Alter eine ruhige Einsiedelei, ein schlechtes Kleid und eine bemooste Zelle finden, wo ich sitzen und über jeden Stern des Firmaments, über jedes vom Tau befeuchtete Gras nachdenken kann, bis ich eine vieljährige Erfahrung und dadurch gleichsam einen prophetischen Geist erreiche. Dies Vergnügen gewähre mir, Melancholie, so will ich gerne mit dir meine Tage beschließen.“1
Das hier beschriebene romantisch-sentimentale Verständnis, von Carl Spitzweg, Ludwig Richter, Moritz von Schwind und vielen anderen anmutig ins Bild gebracht und von Wilhelm Busch karikiert, hat bis in unsere Tage die landläufige Vorstellung vom Mönchs- und Eremitenleben beeinflusst, und noch heute gehört das Rückenfoto des Mönchs mit großer Kapuze, der melancholisch in eine weite Landschaft oder über einen stillen See blickt oder in einem alten Buch liest, zum festen Bestand der Broschüren und Bildbände, in denen wir unsere Lebensweise der Öffentlichkeit darstellen. Es fehlt dann nicht an Menschen, die uns ihren Dank und ihre Wertschätzung aussprechen, dass es uns Mönche „noch“ (!) gibt, und die uns sagen, sie beneideten uns aufrichtig um unsere Möglichkeiten zu einem intensiveren, erfüllteren, stilleren Leben, nach dem auch sie sich sehnen. So nähren wir immer wieder selbst ein „ziereremitisches“ Missverständnis des Mönchslebens: Wir verkörpern und bestätigen bestimmte Sehnsüchte, Wünsche, Träume und Illusionen, die in vielen Menschen stecken – Sehnsüchte und Träume, die diese Menschen freilich niemals allen Ernstes zur bestimmenden Form ihres eigenen Lebens machen würden, weil nämlich, wie sie doch richtig spüren, diese Lebensform so gar nicht lebbar ist, sondern am ehesten von ausgestopften oder gemalten Eremiten verwirklicht werden kann.
Ein Ideal fern der praktischen Alltagserfahrung
In den Augen ernsthafter, nüchterner Menschen und Christen stellt ein solches Mönchsleben ein Kuriosum ohne echte Glaubwürdigkeit und Aussagekraft dar. Es ist sicher kein Zufall, dass im Fernsehen vor einigen Jahren der Film über ein italienisches Kartäuserkloster in der Sendereihe „Reservate“ gezeigt worden ist.
Wäre das nur die Folge einer Fehlinterpretation durch Außenstehende, ein Verkannt- und Missverstandenwerden durch schlecht Informierte, dann könnte man das als unvermeidlich betrachten. Schwerer wiegt, dass wir selbst immer wieder solche Vorstellungen unterstützen, weil wir auch selbst mit ihnen zu kämpfen haben und oft viel Energie dafür verbrauchen, den weiten Abstand zwischen einem illusionären Ideal und unserer Wirklichkeit, wie wir sie tagtäglich erfahren, auszuhalten. In wie viele Konflikte, in welche Berufskrisen hat es schon geführt, und wie viele Berufungen sind schon in der Enttäuschung gescheitert, weil Mönche und Nonnen nach ihrer Noviziatszeit feststellen mussten, dass aus ihnen recht schnell alles andere als stille, beschauliche und in heiliger Muße lebende Menschen wurden und dass ihre Gemeinschaft durchaus kein immer harmonisches, friedvolles Miteinander war. Das aber sollten sie doch sein und darstellen. So beschreiben es zahllose Texte aus der Tradition, und so erwartet man es auch heute in der Kirche von ihnen.
Papst Paul VI. zum Beispiel hat in seiner Predigt am 24. Oktober 1964 auf Monte Cassino gesagt: „Ja, die Kirche und die Welt haben es nötig, dass der heilige Benedikt in der Gemeinschaft der Kirche und der Gesellschaft neu auftritt, sich umgibt mit seinem Gehege von Einsamkeit und Schweigen und von dort her den bezaubernden Klang seines friedvollen und tiefen Gebets verlauten lasse; dass er uns von dort her sozusagen betöre und uns in seine klösterlichen Heiligtümer rufe, um uns das Muster einer Werkstätte des ‚Göttlichen Dienstes‘ vor Augen zu führen, eine kleine ideale Gesellschaft, wo endlich die Liebe herrscht, der Gehorsam, die Unschuld, die Freiheit von allen Dingen und die Kunst, sie gut zu gebrauchen, der Vorrang des Geistes, der Friede – mit einem Wort: das Evangelium.“
Jeder „Insider“ wird auf eine solche Beschreibung je nach Temperament mit Wehmut, Resignation, Sarkasmus oder Gleichgültigkeit reagieren, weil das Bild und das Ideal freilich irgendwie „stimmen“, aber zugleich auch nicht stimmen und ein bisschen weit weg von der praktischen Alltagserfahrung des Klosterlebens sind. Natürlich ist unser Ideal und unser Ziel die volle Verwirklichung des Evangeliums, mit allen Früchten der Liebe, des Friedens und der Freude, die ihr verheißen ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem besteht darin, dass wir uns unter dem Druck fühlen – oder uns selbst unter diesen Druck setzen –, dieses Ideal als schon hier und heute erreicht erfahren und darstellen zu müssen und deshalb uns selbst und andern immer wieder etwas vorzumachen. Das lähmt uns eher, als dass es uns Mut und Schwung verleiht.
Anders gesagt: Uns fehlt ein realistisches Konzept vom Mönch, wie er hier und heute tatsächlich leben kann, ein Modell, mit dem wir uns wirklich identifizieren können. Und weil dieses Konzept fehlt, kommt es zu den typischen Reaktionen, die ein unrealistisches Ideal hervorruft. Da gibt es einerseits die „Unverbesserlichen“, die diesem Ideal treu bleiben und es von Weitem mit Schuldgefühlen, mit Enttäuschung oder mit Unzufriedenheit über ihre...