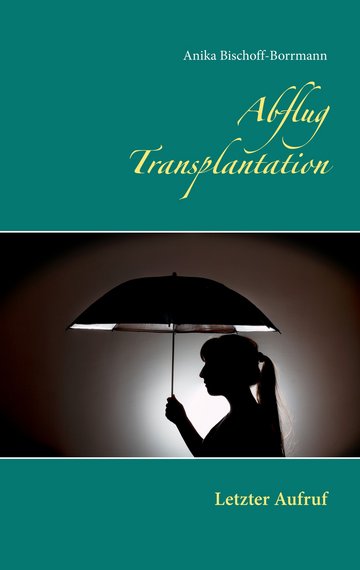Januar-Februar 2015
Die nasale Beatmung reichte nicht mehr aus. Ich wurde nun per CPAP Maske beatmet. Die Maskenbeatmung wurde meine Fessel. Ich bekam unter der Maske zwar Luft, aber ansonsten konnte ich nichts mehr machen. Nahm ich die Maske ab, bekam ich sofort einen Hustenanfall und meine Luft blieb weg. Niemals zuvor kannte ich derartige Atemnot oder hatte nur die leiseste Ahnung, wie sich diese anfühlte. Nun konnte ich ein Lied davon singen, wie es sich anfühlte zu ersticken und von welcher Panik dieses Gefühl begleitet wurde. Leider musste ich die Maske auch mal abnehmen. Wie sollte ich sonst essen und trinken? Das Essen verging mir recht schnell, ich wurde dünner und dünner. Mein Durstgefühl blieb, aber ich reduzierte das Trinken nur auf das Nötigste. Immer wieder keine Luft zu bekommen und diese Panik zu ertragen, hielt ich einfach nicht aus. Nachts lag ich wach, ich war durstig, meine Lippen trocken und dennoch verkniff ich mir zu trinken. Ich wollte die Maske nicht abnehmen. Man weiß gar nicht, wie viel Kraft und Atemluft man benötigt um zu trinken, bis sie einen genommen wird. Das Sprechen viel logischer Weise unter der Beatmung auch flach, also hatte meine Familie die Idee, dass ich per Block mit ihnen kommuniziere. Sie brachten mir ein kleines Ringbuch mit. Es hatte einen fröhlichen Delfin auf dem Blockdeckel. Dieses Ringbuch wurde nun zu meiner Stimme. So langsam begann ich den Ernst der Lage meines Zustandes zu verinnerlichen. Eine Embolie war kein Thema mehr. Ich hatte eine Lungen- und Leberentzündung. Und meine Lunge arbeitete gezielt auf ein Lungenversagen hin. Ich bekam von den vielen Untersuchungen und Arztgesprächen wenig mit. Durch die ständige Luftnot, bekam ich täglich allerhand Mittel gespritzt. Morphin wurde zu meinem besten Freund. Immer wenn ich es brauchte, hielt ich meine Hand ähnlich wie eine Pistole an meinen Kopf. Dort war der Zugang. Dann wusste der Pfleger, was ich von ihm wollte. Morphin half mir bei der Luftnot, ließ mich aber auch immer wieder einschlafen und sofort träumen. Ich hörte oft Stimmen vom Personal oder von Frank, wenn ich wach wurde, war aber niemand da. Ich träumte von meinem Leben, wie ich mit Mandy Schuhe kaufen ging und wie viel Spaß wir hatten. Als ich erwachte und realisierte, dass dies nur ein Traum gewesen war, ich in Wirklichkeit sterbenskrank war und mit Maschinen am Leben erhalten wurde, hätte ich heulen können. Aber auch zum Heulen braucht man Kraft und Atemluft, welche ich nicht mehr hatte. Mein Arzt Dr. S. von der Mukoviszidose Station kam oft vorbei. Er war bisher immer ein freundlicher, netter Arzt, der einen immer Hoffnung machen konnte. Jetzt betrat er mein Zimmer und lächelte nicht mehr. Ich fragte ihn jedes Mal, ob die Antibiotika anschlugen. Jedes Mal schüttelte er langsam den Kopf und sagte, dass sie die Medikamente erneut umstellen müssten, weil nichts half. Die gute Seele des Hauses, die Psychologin Frau W. kam mich regelmäßig besuchen. Bei ihr fühlte ich mich wohl, auch wenn sie nicht viel mehr für mich tun konnte, außer mir Mut zuzusprechen. Meine Mama und Frank kamen jeden Tag. Ich sah oft die Fragezeichen und die Verzweiflung in ihren Gesichtern. Irgendwas musste passieren, aber was? Nicht nur meiner Lunge ging es schlecht, auch meinem Darm. Ständig war ich aufgebläht, hatte keinen Appetit und bekam so allerhand Abführmittel. Husten und Abführmittel sind eine schlechte Kombination. Es endet damit, dass man hustet und dabei einmacht. Man kann es nicht verhindern. Mittlerweile machte ich also regelmäßig ins Bett und wurde dann vom Pflegepersonal - was auch noch Mitte 20 war – frisch gemacht. Ich wäre gern im Erdboden versunken. Ich schämte mich so. Täglich wurde ich trotz ECMO mobilisiert. Das sah dann so aus, dass mich bis zu vier Leute aus dem Bett zogen, ich mit Hilfe ein paar Mäuseschritte lief und auf einen Stuhl gesetzt wurde. Dort blieb ich dann 1–3 Stunden sitzen und wurde dann wieder ins Bett getragen. Diese Prozedur war sehr anstrengend, so dass ich nach dem Zurückheben ins Bett völlig fertig war und schlafen musste. Täglich musste ich auch eine Rüttelweste anziehen, welche Vibrationen an meine Bronchen abgaben. Diese sollten den Schleim lösen. Bei mir tat sich nicht viel. Die Lunge war einfach zu krank. Außerdem war das Tragen dieser Weste sehr anstrengend. Ich sollte diese Therapie am besten ohne Maske durchführen, also hatte ich erneut Atemnot. Ich empfand alles wie in einem Albtraum. Frank fragte mich, wie mein Tag gewesen war und ich schrieb folgende Zeilen in den Block: „Mein Tag: Morgens gleich Sessel, dann waschen, dann schlafen, dann Rüttel und dann war ich so K.O., dass ich etwas bekam.“
Langsam begann ich meinen Verstand zu verlieren, ich hielt diese ständige Luftnot einfach nicht mehr aus. Ich schrieb in meinen Delfinblock: „Panikattacken Luftnot den ganzen Tag.“ Die Stationsärzte machten mir eine Ansage, ich solle mich nicht so hyper verhalten, sie würden alles für mich tun. Angst und Panik waren aber zu meinen täglichen Begleitern geworden. Was sollte ich machen? Ich konnte mich ohne Medikamente nicht ablenken und entspannen. Luftnot geht an die Seele, geht an die Substanz. Meine Mutter konnte sich das nicht mehr mit ansehen und schlug ein Tracheostoma vor. Ein wenig Hoffnung, in der Hölle sozusagen. Ein Tracheostoma ist ein Schnitt im Hals zur Luftröhre. Man bekommt eine Kanüle in die Luftröhre, welche an die Beatmungsmaschine angeschlossen wird. Die Maschine bläst dann die Lungenflügel auf und man bekommt Luft. Man hätte wieder ein freies Gesicht und könnte essen und trinken. Nachteilig wäre, man könnte nicht mehr sprechen. Ich wollte dieses Tracheostoma, ich hatte zwar Angst, aber ich wollte es. Ich wollte einfach wieder Luft bekommen. Ich wollte nur dieses Panikgefühl von der Luftnot wegbekommen, ich hielt diesen Zustand einfach nicht mehr aus. Die Ärzte waren spontan einverstanden und sagten, sie würden die OP dafür noch heute Abend durchführen. Gott sei Dank, ich wollte keine Sekunde mehr warten. Als sich meine Mutter von mir an diesen Tag verabschiedete, streichelte sie mich und sagte: „Hab keine Angst, ich verspreche dir, danach kannst du wieder atmen.“ Sie küsste mich und war weg. Abends sollte die OP stattfinden, aber es passierte nichts. Irgendwann kam eine Schwester und sagte: „Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die Gute ist, du hast heute keine OP. Die Schlechte ist, dass du kein Tracheostoma bekommst. Die Ärzte haben sich um entschieden.“ Hatte die Frau den Verstand verloren? Das war meine einzige Hoffnung! Panik stieg in mir hoch. Ich fühlte mich machtlos, konnte ja nicht mal sprechen. Ich nahm meinen Block und krakelte hektisch, dass ich es aber will, dass es mir versprochen wurde, dass ich keine Luft bekomme. Sie war sichtlich überfordert und holte den Arzt. Der Arzt erzählte mir dann, dass diese Option doch nicht die Beste für mich sei, ich sollte lieber täglich versuchen den Schleim mittels Rüttelweste herauszubekommen und lauter solcher Sachen. Er stieß auf taube Ohren. Ich konnte es nicht fassen. Ich verstand nicht, warum man mir das antat. Ich bekam seit Wochen schwer Luft. Ich. Nicht er. Und jetzt stand er da und wollte es nicht genehmigen. Völlig aufgelöst schlief ich unter Medikamenten ein. Mir war so zum Heulen zumute, aber dafür hatte ich ja keine Luft zur Verfügung. Als meine Mutter am nächsten Tag kam, sah sie mich entsetzt an, weil ich nicht tracheostomiert wurde. So langsam verlor ich meine Hoffnung. Die Tage waren so anstrengend, obwohl ich kaum etwas machte. Alles viel mir schwer. Ich fühlte mich nicht mehr wie Anika, sondern wie eine Hülle. Eine kranke Frau, welche an Maschinen hängt, regelmäßig erbricht, regelmäßig in Bett macht und dessen Lebenslicht langsam erlischt. Frank erzählte mir zur Ablenkung viel aus seinem Alltag von seiner Arbeit. Ich konnte ihm immer weniger Folgen. Die vielen Medikamente und Schlafmittel setzten meine Konzentrationsfähigkeit auf ein Minimum herunter. Wir hielten uns an den Händen und jeder spürte die Verzweiflung des anderen. Vier Tage später drehte sich der Wind und das Tracheostoma wurde erneut Gesprächsthema und genehmigt. Ich war froh. Einen Tag vor meinem Geburtstag, am 10.01. bekam ich die Kanüle. Am 11.01. hatte ich Geburtstag. Ich war noch sehr sediert von den Mitteln, bekam nicht viel mit. Ich erinnere mich, dass meine Tante Susi da war. Sie hatte eine weiße Stoffente dabei. Diese Ente war ein Stofftier aus meiner Kindheit. Sie wedelte mit der Ente vor meinem Gesicht herum und rief lachend: „Rate mal, wie Enti heißt!“ Das war ein Insider Witz, den ich trotz meines Zustandes noch wusste und verstand. Als ich Kind war, habe ich mit dieser Ente vor dem Gesicht meines jüngeren Cousins herumgewedelt und genau diesen Satz gesagt. Die Pointe des Witzes war, das die Ente Enti hieß. Ich hatte den Namen also schon vorweg verraten. Als ich das nächste Mal erwachte sah ich Frau Dr. K am Fenster stehen. Neben ihr standen meine Mutter und Frank, beide schauten mich an und weinten. Meine Mutter sah mich an und fragte mich weinend: „Willst du transplantiert werden?“ So stand es also um mich. Lungenversagen. Alle Therapiemöglichkeiten waren ausgeschöpft. Ich war austherapiert. Sterben wäre also die nächste Station. Ohne Nachzudenken nickte ich energisch. Bald bekam ich die Einwilligung zur...