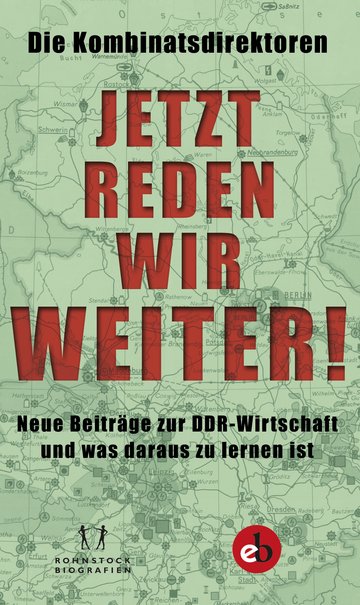Die Energieversorgung I
In eine Lehrerfamilie 1938 hineingeboren, absolviert Eckhard Netzmann mit vierzehn eine Lehre als Werkzeugschlosser. Im Alter von zwanzig Jahren erlangt er den Ingenieursabschluss auf dem Gebiet der Umformtechnik. Nach dem Studium arbeitet er zwanzig Jahre im VEB Schwermaschinenkombinat »Ernst Thälmann« (SKET) in Magdeburg. Dort schließt er 1966 sein Fernstudium an der Technischen Universität Dresden als Diplom-Ingenieur ab. Seine Laufbahn im SKET gliedert sich in vier Hauptetappen: Er beginnt als Technologe, arbeitet dann als Chef des Walzwerkbaus, später als Werkdirektor im Zementanlagenbau Dessau und schließlich bis 1979 in der Position des Generaldirektors.
Darauf folgen vier Jahre als Stellvertretender Minister für Schwermaschinen- und Anlagenbau – sie enden 1983 »misslich« mit der fristlosen Entlassung. Nach einem Tag Arbeitslosigkeit geht er zum VEB Kombinat Kraftwerksanlagenbau in Berlin. Hier ist Eckhard Netzmann zunächst Mitarbeiter für Planung und Bilanzierung (zuständig für Feuerungsroste und Mannlochklappen), dann Leiter des Dampferzeuger- und Feuerungsanlagenbaubetriebes. Unter Manfred Dahms wird er Stellvertretender Generaldirektor und erhält 1987 den Auftrag, als Sonderbevollmächtigter das letzte Kraftwerk der DDR »Block V« in Greifswald ans Netz zu nehmen.
Nach der Wende wird der Engineering-Bereich des Kombinats in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die Eckhard Netzmann als Vorstandsvorsitzender leitet. Zwei erfolglose Privatisierungen veranlassen ihn zu gehen. Von 1999 bis 2006 arbeitet Eckhard Netzmann in Personalunion als Vorstandsvorsitzender der Riesaer Beteiligungs AG und als Geschäftsführer von sechs der AG unterstellten GmbHs. Seit 2007 ist er als selbständiger Unternehmensberater tätig.
Energie ist Macht
Im Herbst 2015 schrieb Helmut Schmidt, es müsse ein Prozess der Einheit, der weiteren Annäherung stattfinden. Es ist – und bleibt – ein zäher Prozess, weil ich feststelle, dass auch 25 Jahre nach der sogenannten Vereinigung unabdingbare Fakten, die man in Ost und West wissen sollte, nicht bewusst sind oder nicht akzeptiert werden. Ich will zwei Beispiele nennen. Vielleicht die Hälfte derer, die hier im Saal sitzen, waren unlängst Zeugen eines Ost-West-Wirtschaftsforums, das Rohnstock Biografien und der Verein Lebenserinnerungen im September 2015 veranstalteten. Wenn der West-Manager Heinz Dürr dort ernsthaft glauben macht, die Züge der Deutschen Reichsbahn seien mit 15 Kilometer pro Stunde durch die Gegend gezuckelt, dann können wir nur mit dem Kopf schütteln. Und wenn der von mir hochgeschätzte Ex-Siemens-Vorstand Heinrich von Pierer öffentlich bezweifeln darf, ob es in der DDR ordentliche Kalkulationen gab, dann darf ich erwidern: Wir arbeiteten im Turbinenbau Görlitz mit Kostenstellen-, Kostenarten- und Kostenträgerrechnungen und ohne Zweifel auch mit Nachkalkulationen. Abgesehen davon, dass das Geld in der DDR eine völlig andere Rolle spielte als in der BRD, hatten wir in unseren Betrieben eine exakte Buchhaltung und eine detaillierte Kostenzuordnung.
Leider ist die Meinungsbildung über beide Gesellschaftssysteme abgeschlossen und zuungunsten historischer Tatsachen verfestigt. Das gilt für Ost und West gleichermaßen. Deshalb dürfen wir uns heute nicht auf vermeintlich historisch verbürgte Mutmaßungen verlassen, sondern müssen Zahlen, Fakten und Zusammenhänge zusammentragen.
Ich freue mich, unter den Anwesenden Zeitzeugen auszumachen, die sich Jahrzehnte unter schweren Bedingungen konstruktiv für eine stabile Strom- und Wärmeversorgung in der DDR eingesetzt haben. Energie ist heute das zentrale Thema. Ohne Energie, ohne Wärme, ohne Strom kann niemand arbeiten. Energie ist Macht!
Die Ausgangslage
Nach dem Zweiten Weltkrieg war sowohl im Osten wie im Westen ein Großteil der energetischen Basis der Wirtschaft zerstört. Die wenigen erhaltenen Anlagen waren verschlissen. Dabei verfügte Ostdeutschland von vornherein über ein geringeres wirtschaftliches Potenzial. Hinzu kommen die vergleichsweise hohen Reparationsleistungen in der SBZ: Etwa 40 Prozent der industriellen Ausrüstungen – das Transportwesen eingeschlossen – wurden demontiert. Durch die Teilung wurde der Osten vom flächendeckenden Gas- und Stromnetz des vormaligen Deutschen Reiches abgekoppelt. Steinkohlevorkommen waren marginal, Gasförderung und Wasserkraft quantitativ kaum nennenswert. Der einzig relevante Energieträger, der den Osten Deutschlands versorgen konnte, war die Braunkohle.
Der Westen verfügte hingegen über zahlreiche Steinkohlevorkommen (vor allem im Ruhrgebiet) sowie über Braunkohlereserven mit Flözstärken von bis zu 300 Metern. (Im Osten waren es im Schnitt 30 Meter!) Zusätzliche Steinkohle- und Ölimporte verhalfen dem Westen in Verbindung mit dem Marshallplan zu wesentlich besseren Startbedingungen für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung – einschließlich einer sicheren Strom- und Wärmeversorgung. Um die Energieversorgung sicherzustellen, sahen sich die Verantwortlichen in der SBZ und frühen DDR gezwungen, 30 bis 45 Prozent aller Industrieinvestitionen in die Energiewirtschaft zu stecken – das Drei- bis Vierfache vergleichbarer Investitionen im Westen Deutschlands.
Obwohl diese Ausgangsbedingungen weitestgehend in Vergessenheit geraten sind, dominierten sie die gesamte Investitionsstrategie der DDR bis 1989. Partei- und Staatsführung mussten permanent Beschlüsse fassen, um Finanz- und Material-Ressourcen zu mobilisieren. Vor diesem Hintergrund wird einmal mehr deutlich, wie oberflächlich die Behauptung ist, die DDR sei eine Miss- und/oder Zwangswirtschaft gewesen. Natürlich gab es notwendige Prämissen: Deren wichtigste bestand in der Erzeugung von ausreichend Wärme und Energie – eine Prämisse die, wie wir gesehen haben und sehen werden, unter denkbar ungünstigen Vorzeichen stand.
Die Braunkohle
In keinem Land Europas war die energiepolitische Lage nach dem Zweiten Weltkrieg so angespannt wie in der DDR. Der mittlere Teil des vormaligen Deutschen Reiches hatte von der Steinkohle aus dem Ruhrgebiet und aus Oberschlesien gelebt. Von diesen Ressourcen war die SBZ/DDR abgeschnitten. Sich im Kalten Krieg auf Lieferungen aus dem Ruhrgebiet zu verlassen, war ein Vabanquespiel. Es blieb uns nichts anderes übrig: Wir mussten auf die heimische Braunkohle zurückgreifen. Und das war teuer, weil sich die seit Jahrzehnten ausgebeuteten, flach gelegenen Braunkohletagebaue im Bezirk Halle erschöpft hatten und neue, tief gelegene Lagerstätten im Bezirk Cottbus, die die Beseitigung gewaltiger Abraummengen notwendig machten, erschlossen werden mussten. Das Verhältnis Abraum-Kohle lag 1956 bei knapp 4:1 und verschlechterte sich bis 1962 auf knapp 6:1.
Die Hauptvorkommen lagen in Mitteldeutschland, dem Bitterfelder Raum und in der Lausitz. Insgesamt betrugen die abbauwürdigen Vorräte circa 24 Mrd. Tonnen – eine überschaubare Größe, aber für die kleine DDR bedeuteten sie eine Absicherung über viele Jahre. Förderten wir 1945 85 Mio. Tonnen, waren es 1970 bereits 260 Mio. Tonnen. Während der 1970er Jahre blieb die Fördermenge aufgrund des Einsatzes von Öl und der beginnenden Nutzung von Kernkraft konstant. Als sich Mitte der 70er Jahre die Ölpreise drastisch erhöhten, wurde das Krisenprogramm Energieträgerumstellung aufgelegt. Selbst kleinere Verbraucherstellen wie Krankenhäuser und Schulen erhielten mit Braunkohle befeuerte Heizwerke, die »kleinteilige Anwendung« entstand.
Da ich ab 1983 in einem Betrieb des Kombinats Kraftwerksanlagenbau, im Dampferzeugerbau, für die Bilanzierung von Feuerungsrosten und Mannlochplatten zuständig war, erlebte ich die Auswirkungen dieser Krise aus unmittelbarer Nähe. Die Energieträgerumstellung kostete unglaubliche Kapazitäten materieller, technischer und finanzieller Art. Erst Mitte der 1980er Jahre war der Prozess abgeschlossen. Im Zuge der Energieträgerumstellung nahm die Braunkohleförderung von 258 Mio. Tonnen (1980) auf 315 Mio. Tonnen im Jahr 1989 zu.
Im Vergleich zur Steinkohle besaß die DDR-Braunkohle nur ein Viertel bis ein Drittel des Heizwertes. Ihr Wassergehalt betrug bisweilen über 50 Prozent. Das machte den Kohletransport im Winter – bei minus 20, 25 Grad Celsius – zu einer technischen und logistischen Herausforderung. Um einen Kubikmeter Kohle zu fördern, mussten im Schnitt sechs Kubikmeter Wasser abgepumpt werden. Die Abraummengen betrugen in den Startjahren das Zweieinhalbfache der abgebauten Kohle. Im Lauf der Jahre verschlechterte sich das Verhältnis zum Teil bis hin zum viereinhalbfachen Abraumvolumen. Unvorstellbar, welche Erdmassen in den Braunkohlekombinaten in Senftenberg und Bitterfeld zu bewegen waren, welches technische Know-how, welche Arbeitsleistung diese Form des Bergbaus erforderte.
Bedingt durch die Minderwertigkeit der Kohle fielen jährlich etwa 17 Mio. Tonnen Asche an, die nur zum Teil industriell oder als Baumaterial verwendet wurde. Ein Großteil musste als Abraum verbracht werden.
Für den Prozess der Veredelung spielte zudem der Schwefelgehalt eine Rolle. Er lag zwischen ein Prozent in der Lausitz und bis zu drei Prozent in Bitterfeld. Je niedriger der Anteil, desto geringer war der Aufwand der synthetischen Verarbeitung.
Die Qualität der geförderten Kohle verhielt sich umgekehrt proportional zur...