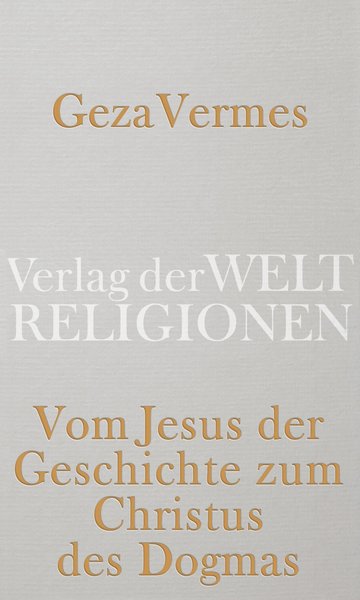Über vierzig Jahre ist es her, seitdem ich mich erstmals auf das Gebiet der Jesusforschung gewagt habe, ein Unternehmen, das 1973 von Jesus the Jew (dt.: Jesus der Jude, 1993) gekrönt wurde. Nach der Publikation von zwölf weiteren Büchern zum Thema kam mir 2008 der Gedanke, die Reihe mit einem ganz andersartigen Werk abzurunden: einem Versuch, die historischen Verbindungslinien zwischen Jesus, wie er in seiner galiläisch-charismatischen Umwelt dargestellt wird, und dem ersten Ökumenischen Konzil von Nizäa im Jahr 325 n. Chr. zu skizzieren, das feierlich seine Göttlichkeit zum christlichen Dogma erhob.
Bei diesem Unterfangen, dem Entwicklungsbogen nachzuspüren, werde ich besonderen Nachdruck auf die Frage legen, wie Jesus und das aufkommende palästinische Christentum durch das charismatische Judentum geprägt wurden. Genauso wichtig zu beachten ist der Einfluss, den die hellenistische Gedankenwelt und Mystik auf die frühen Gemeinden ausübten, die innerhalb weniger Jahrzehnte nach der Kreuzigung in Sprache und Denken weitgehend griechisch wurden. Diese Tendenz setzte mit Paulus und dem Vierten Evangelium ein und war ab dem zweiten Jahrhundert für die Einwirkung platonischer Philosophie auf die Formulierung christlich-theologischer Vorstellungen verantwortlich. Den letzten, entscheidenden Anstoß gab Kaiser Konstantin, der Druck auf die Bischöfe des Konzils von Nizäa ausübte und sie zwang, die Folgen ihres nicht enden wollenden religiösen Streits für den inneren Frieden des römischen Staates zu bedenken.
Um das vollständige Bild zu erfassen, betrachten wir zunächst das Judentum. In religiöser Hinsicht waren damit im Wesentlichen Menschen gemeint, die in das jüdische Volk hineingeboren wurden. Auch Jesus hat sich seinerseits ausschließlich an Juden gerichtet und seinen Abgesandten aufgetragen, sich nur an die »verlorenen Schafe des Hauses Israel« zu wenden. Freilich hieß das Judentum auch heidnische Proselyten willkommen, die bereit waren, die Einzigkeit Gottes zu bekennen und sämtliche religiöse Verpflichtungen des Mosaischen Gesetzes auf sich zu nehmen. Die rituelle Initiation erfolgte durch die Proselytentaufe, die an Anwärtern wie Anwärterinnen vollzogen wurde, und durch die Beschneidung aller männlichen Bewerber. Es versteht sich von selbst, dass in verschiedenen Epochen der jüdischen Geschichte einschließlich des Zeitalters Jesu in gewissem Umfang eine Missionstätigkeit unter Heiden entfaltet wurde; aber wie weit verbreitet sie in jenen Tagen war und wie tief die eschatologische Vorstellung von Israel als dem Licht der Völker in das jüdische Bewusstsein eindrang, bleibt in der Forschung weiterhin umstritten.1 Der Aufnahme von Heiden in die älteste judenchristliche Gemeinde ging ursprünglich wohl die Bekehrung zum Judentum voraus. Dass ein Nichtjude ihr Glaubensgenosse wird, war für die ersten Anhänger der Jesusbewegung kaum vorstellbar. Doch keine zwanzig Jahre nach der Kreuzigung lenkten die Spitzenvertreter der Kirche auf Druck des Paulus ein und schafften die Vorbedingung ab, wonach zuerst das Mosaische Gesetz angenommen werden müsse, einschließlich der Beschneidung für Konvertiten. Sie verpflichteten Heiden, die zur Gemeinde gehören wollten, lediglich dazu, einige wenige Grundregeln zu beachten, ähnlich den Noachitischen Geboten, die Götzendienst, Blutverzehr und bestimmte Formen des Sexualverhaltens, die den Juden ein Gräuel waren, untersagten.
Unterhalb des im Wesentlichen am Gesetz orientierten Judentums gab es auch eine weniger formelle Frömmigkeitsströmung, die sich mit den Propheten verband und sich von ihnen, den einflussreichen Sprachrohren Gottes, inspirieren ließ. Charismatische heilige Männer hielten sie bis hinab ins Zeitalter der Rabbinen lebendig. Diese Religiosität verlangte eine fromme Haltung gegenüber der Gottheit, deren Schutz vor Krankheit, vorzeitigem Tod, Ungerechtigkeit und Krieg ebenso erbeten wurde wie ihre Obhut für Arme, Witwen und Waisen. Nach Gottes Gunst trachtete man auch für ein langes, glückliches Leben und für das Wohlergehen der Familie und in spätbiblischer Zeit gelegentlich für den Vorzug, auf irgendeine rätselhafte Weise der Unterwelt zu entkommen und jenseits des Grabes in irgendeiner Form von Leben nach dem Tod bei Gott zu sein.
In den frühen Stadien der biblischen Geschichte stand das Judentum weniger für den Monotheismus – den Anspruch, dass es nur einen einzigen Gott gibt – als für die Monolatrie, was bedeutet, dass die Juden nur ihren eigenen Gott verehrten und das Pantheon der anderen Völker praktisch unbeachtet ließen. In der Bibel findet sich keine vernunftgemäße Widerlegung des Polytheismus; die schlichte Behauptung, die fremden Götter seien von Menschen aus Holz, Stein oder wertvollen Metallen hergestellte Götzenbilder, kann kaum als intellektueller Beweis für die Nichtexistenz anderer Gottheiten gelten (obwohl sie noch jahrhundertelang von Juden und Christen nachgesprochen wurde). Konkret hatten Juden der gesellschaftlichen und politischen Attraktivität der Religionen ihrer Nachbarvölker (Kanaanäer, Philister) zu widerstehen und noch viel mehr denen ihrer Oberherren: Ägypter, Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen und Römer. Die Verehrung fremder Götter wurde nicht so sehr als ein Irrtum angesehen denn als Bruch einer mystischen monogamen Ehe zwischen dem Himmelskönig und seiner Braut, dem erwählten Volk Israel. Erst unter dem Einfluss der Propheten der exilisch-nachexilischen Zeit im sechsten vorchristlichen Jahrhundert trat Monotheismus im eigentlichen Sinne – der Gedanke eines einzigen Gottes, der für die Schöpfung der Welt und die Erschaffung des Menschen verantwortlich ist – ins jüdische Bewusstsein, zusammen mit der Überzeugung, dass nur dieser Gott zuletzt von der gesamten Menschheit in gebotener Weise anerkannt werden wird. Monotheismus blieb der Kampfbegriff der Juden, während den Christen sowohl von Juden als auch von Heiden die Kritik entgegenschlug, ihr monotheistischer Anspruch sei unberechtigt.
Bezüglich der Eigenart der jüdischen Religion ist eines gewiss unstrittig: Intellektuelle religiöse Spekulation als solche spielte in der hebräischen und aramäischen jüdischen Literatur, die in der Zeit des Zweiten Tempels nach dem Babylonischen Exil und in den späteren Jahrhunderten der Mischna, des Midrasch und des Talmud verfasst wurde, keine Rolle. Die Werke Philos von Alexandrien und Josephus' Schrift Gegen Apion bilden in der Antike die wichtigsten Ausnahmen auf diesem Gebiet. Sie waren jedoch auf Griechisch verfasst, entweder für heidnische Leser oder für durch und durch hellenisierte Juden. Vor dem zehnten nachchristlichen Jahrhundert brachten Juden keine theologischen Traktate in einer semitischen Sprache hervor mit der einen möglichen Ausnahme der – in die Handschrift der Gemeinderegel aus Höhle 1 von Qumran aufgenommenen – ›Unterweisung über die zwei Geister‹ beziehungsweise ›Zwei-Geister-Lehre‹ aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert, worin der göttliche Schöpfungszweck und die Geschicke der Menschheit zusammenfassend dargelegt werden.
Das Judentum war in erster Linie eine Religion der Tat. Abgesehen von der Zustimmung zu der einen Lehraussage bezüglich der Einzigkeit Gottes lief es im Wesentlichen auf eine Lebensform hinaus. Im Tempel oder in der Synagoge, zuhause oder am Arbeitsplatz wurde Religion durch den Gehorsam gegenüber den Satzungen praktiziert, von denen man glaubte, dass sie von der Gottheit erlassen worden seien. Diese Vorschriften, vor allem das Gesetz Moses, wurden von der Kaste der levitischen Priester, die als die von Gott ernannten Wächter von Gerechtigkeit und Frömmigkeit galten, weitergegeben und interpretiert. Ihr Monopol blieb bis ins zweite vorchristliche Jahrhundert unangefochten, als Laienintellektuelle – die Pharisäer, die ihre Autorität ihrer Gelehrsamkeit verdankten – es ihnen streitig zu machen begannen. Die Führerschaft über die Pharisäer sollte nach der Zerstörung des Tempels an ihre Erben übergehen, die Rabbinen.
Die Religion Jesu war im Wesentlichen ein Aufruf zur eschatologischen Tat; aber das anschließende Christentum, obwohl es ebenfalls auf Werken bestand und noch eine Zeitlang eschatologisch blieb, wurde von Paulus und Johannes in eine Religion des Glaubens umgestaltet. Ungeachtet seiner jüdischen Wurzeln entwickelte es sich in eine fundamental eigenständige Bewegung, die sich bereits bei Ignatius von Antiochien zu Beginn des zweiten Jahrhunderts n. Chr. auf ein Bekenntnis gründete, und nahm mit Justin in der Mitte des zweiten Jahrhunderts eine philosophische Wendung. Die das Christentum beherrschenden Merkmale waren der Glaube bezüglich des Wesens der Gottheit, die genaue Bestimmung von Jesu Christi Person und Heilswerk und die erlösende Funktion der einen, wahren Kirche. Von rechtem Glauben hing ab, ob einer dazugehörte oder draußen war. Das persönliche Verhalten auf religiösem Gebiet stand demgegenüber erst an zweiter Stelle. Buße, obwohl von frühchristlichen Rigoristen nur ein einziges Mal nach der Taufe zugelassen, konnte Sünden heilen, und durch tätige Reue ließ sich jedes Unrecht wiedergutmachen, solange der Glaube da war.
Verglichen mit dem Judentum stellte der kosmopolitische Charakter des Christentums einen zweiten wesentlichen Unterschied dar. Schon wenige Jahrzehnte nach der Kreuzigung wandte sich die Kirche vom jüdischen Tempel ab, und bald nach 70 n. Chr. setzte die christliche Ablösungstheorie (›Supersessionismus‹) ein, die sich auf die Ansicht gründete, dass die Zerstörung Jerusalems und seines Heiligtums die...