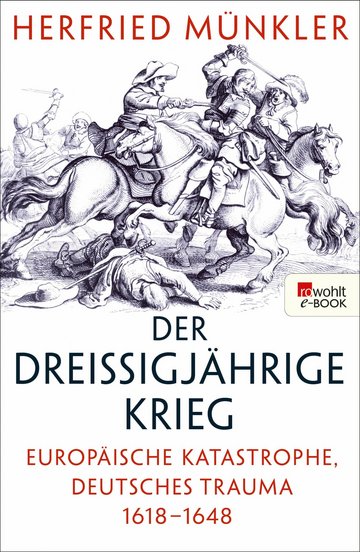Einleitung Deutsche Erinnerung und deutsches Trauma
Die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg war das große Trauma der Deutschen, bis dieses Trauma durch die kollektive Erinnerung an die Gewalt und Zerstörung abgelöst wurde, die mit den beiden Weltkriegen einhergingen. Die Verwüstung der Städte, die Verheerung des Landes und das massenhafte Sterben der Menschen in den Jahren von 1618 bis 1648 standen beispielhaft für die Schrecken des Krieges, doch diente der Dreißigjährige Krieg darüber hinaus als Erklärung dafür, warum die deutsche Geschichte, so die Annahme, seit dem 17. Jahrhundert ganz anders verlaufen sei als die der meisten europäischen Nationen: Während diese politisch handlungsfähige Staaten gebildet und ihre jeweiligen Interessen in gegenseitiger Konkurrenz zur Geltung gebracht hätten, sei Deutschland zum Tummelplatz für die Heere ebenjener Mächte geworden und habe erst mit großer Verspätung einen eigenen Nationalstaat bilden können. Dass die Deutschen unter den Europäern zur «verspäteten Nation» wurden, wie die von dem Soziologen Helmuth Plessner geprägte Formel lautet, hat dieser Erinnerung zufolge ihre Ursache im Dreißigjährigen Krieg, der seinerseits wiederum auf die konfessionelle Spaltung des Landes zurückzuführen sei.
Gemäß dieser Beschreibung ist Deutschland einen «Sonderweg» gegangen: Während sich bei den mächtigen Akteuren der europäischen Politik, bei Frankreich und England, Spanien und Schweden, eine verbindliche Konfession durchsetzte, blieb Deutschland konfessionell gespalten, und im Westfälischen Frieden wurde dies festgeschrieben. Die Spaltung, so die geschichtspolitische Meistererzählung weiter, habe sich im 18. Jahrhundert zum machtpolitischen Gegensatz zwischen dem protestantischen Preußen und dem katholischen Österreich, zwischen der Herrscherfamilie der Hohenzollern und dem Hause Habsburg zugespitzt, der bald zwei Jahrhunderte lang einer deutschen Nationalstaatsgründung entgegenstand. Folgt man dieser Sichtweise, so ist der im Dreißigjährigen Krieg ausgetragene Konflikt erst 1866 in der Schlacht bei Königgrätz (beziehungsweise Sadowa, wie man in Österreich sagt) zugunsten des protestantischen Nordens entschieden worden – geographisch nicht zufällig in Böhmen, also dort, wo der Dreißigjährige Krieg seinen Anfang genommen hat. Der Krieg habe Deutschland gegenüber seinen Nachbarn um zwei Jahrhunderte zurückgeworfen, und deswegen müssten die Deutschen in Jahrzehnten nachholen, wozu andere Jahrhunderte Zeit gehabt hätten. Die Trauma-Erzählung wurde damit zum Beschleunigungsimperativ der Politik.
Als Spätankömmling, so die politische Pointe der Erzählung, habe Deutschland sich seinen Platz unter den europäischen Großmächten nachträglich erobern müssen, und dabei sei es vor allem mit jenen Mächten in Konflikt geraten, die sich im Dreißigjährigen Krieg Einfluss auf die deutsche Politik verschafft und diesen Einfluss im Westfälischen Frieden auf Dauer gefestigt hätten. Die drei Einigungskriege, die Preußen zwischen 1864 und 1870 geführt hat, konnten demnach als Revision der Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges angesehen werden, und die den Deutschen angetane Gewalt wurde zur Rechtfertigung für die nunmehr von den Deutschen den anderen zugefügte Gewalt. Wer sich als Opfer begreift, hat oft keine Probleme damit, andere zum Opfer zu machen. Noch bei Beginn des Ersten Weltkriegs gehörte es zu den gängigen Begründungen für das militärisch offensive Vorgehen der Deutschen, man dürfe nicht zulassen, dass dem neuen Reich dasselbe Schicksal widerfahre wie dem alten Reich im Dreißigjährigen Krieg. Das im kollektiven Gedächtnis der Nation verankerte Trauma wurde zur Rechtfertigung eines aggressiven Auftretens und zum Imperativ, die Wiederholung eines solchen Krieges auf deutschem Territorium unter allen Umständen zu verhindern. Das Mittel, das die Geschichtserzählung nahelegte, war eine Außenpolitik, die vor einem Präventivkrieg nicht zurückschreckte. Dies wiederum, so die Anschlusserzählung von einem zweiten Trauma, habe dazu beigetragen, dass es in Europa im 20. Jahrhundert zu einem weiteren «Dreißigjährigen Krieg» gekommen sei, wie die beiden zu einem Geschehen zusammengefügten Weltkriege bezeichnet worden sind – eine überaus bittere Pointe, wenn vom «Lernen aus der Geschichte» die Rede ist.
Lange Zeit stand neben dem traumagespeisten Imperativ aggressiver Machtpolitik die ebenfalls durch den Rückbezug auf den Dreißigjährigen Krieg gestützte Überzeugung, einen derart langen und gesellschaftlich verheerenden Krieg nicht noch einmal zulassen zu dürfen. Es war der greise Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke, der legendäre Sieger von Königgrätz und Sedan, der am 14. Mai 1890 in einer Reichstagsrede vor einem neuen großen Krieg in Europa warnte, einem Krieg, der nicht «in einem oder in zwei Feldzügen» erledigt sein werde; «es kann ein siebenjähriger, es kann ein dreißigjähriger Krieg werden, – und wehe dem, der Europa in Brand steckt, der zuerst die Lunte in das Pulverfaß schleudert!»
Nahm man diese Warnung ernst, so lief sie darauf hinaus, die Entstehung von politischen Konstellationen zu verhindern, die denen vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges ähnelten. Das konnte zu einer klug angelegten Entspannungspolitik führen, ebenso aber zur Planung kurzer Kriege, die in schnellen Feldzügen entschieden werden sollten. In diesem Fall wirkte das Geschichtsnarrativ des Dreißigjährigen Krieges wie eine Aufforderung, Kriege nach der zügig gesuchten Entscheidungsschlacht umgehend wieder zu beenden. Das Problem der deutschen Politik vor 1914 war, dass sie zwischen beiden Optionen, der Kriegsverhinderung auf der einen und der schnellen Niederwerfung des Gegners auf der anderen Seite, hin und her schwankte. Die Trauma-Erzählung ließ keine eindeutige Entscheidung und Festlegung zu.
Als Helmuth von Moltke vor einem neuen Dreißigjährigen Krieg warnte, äußerte er sich nicht nur als professioneller Militär, sondern brachte auch die Vorstellungswelt des deutschen Bürgertums zum Ausdruck, die durch die Schilderungen des Dreißigjährigen Kriegs in Gustav Freytags weitverbreitetem Werk Bilder aus der deutschen Vergangenheit – erschienen in mehreren Bänden zwischen 1859 und 1867 – geprägt war. «Wie der Kampf», so resümiert Freytag die Situation nach Ende des Krieges, «waren auch die Zustände, welche nach dem Kriege eintraten, außer allem Vergleich mit anderen Niederlagen kultivierter Völker. Gewiß sind in einzelnen Zeiträumen der Völkerwanderung große Landschaften Europas noch mehr verödet worden, zuweilen hat im Mittelalter eine Pest die Bewohner großer Städte ebensosehr dezimiert; aber solches Unglück war entweder lokal oder wurde leicht durch den Überschuß von Menschenkraft geheilt, der aus der Umgegend auf dem geleerten Grund zusammenströmte, oder es fiel in eine Zeit, wo die Völker nicht fester auf dem Boden standen als lockere Sanddünen am Strand, welche leicht von einer Stelle zur andern geweht werden.»
Freytag ging es darum, das Exzeptionelle dieses Krieges herauszustellen, seine Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit vor allem im Hinblick auf das Unglück und Elend, das den Deutschen widerfahren sei: «Hier aber wird eine große Nation mit alter Kultur, mit vielen hundert festgemauerten Städten, vielen tausend Dorffluren, mit Acker- und Weideland, das durch mehr als dreißig Generationen desselben Stammes bebaut war, so verwüstet, daß überall leere Räume entstehen, in denen die wilde Natur, die so lange im Dienste des Menschen gebändigt war, wieder die alten Feinde des Menschen aus dem Boden erzeugt, wucherndes Gestrüpp und wilde Tiere. Wenn ein solches Unglück plötzlich über eine Nation hereinbräche, es würde ohne Zweifel auch eine kleine Zahl der Überlebenden unfähig machen ein Volk zu bilden, ja schon das Entsetzen würde sie vernichten; hier aber hat das allmähliche Eintreten der Verringerung den Überlebenden das Schreckliche zur Gewohnheit gemacht. Eine ganze Generation war aufgewachsen innerhalb der Zeit der Zerstörung. Die gesamte Jugend kannte keinen anderen Zustand als den der Gewalttat, der Flucht, der allmählichen Verkleinerung von Stadt und Dorf, des Wechsels der Konfession.» Gustav Freytags Zeilen können als Kurzfassung der deutschen Trauma-Erzählung gelten.
Das von ihm prominent entfaltete Opfernarrativ hatte eine ambivalente Wirkung: Auf der einen Seite fügte es sich in einen Zustand der Trauer, des melancholischen Erinnerns und der politischen Zurückhaltung; auf der anderen Seite verschaffte es denen, die als Opfer der Geschichte und der geopolitischen Konstellationen vorgestellt wurden, ein gutes Gewissen, wenn es darum ging, die eigenen Ansprüche durchzusetzen: Man war ja Opfer und hatte in der Vergangenheit gelitten, weswegen Gegenwart und Zukunft dafür entschädigen mussten. Je eindringlicher das Opfernarrativ, desto größer der Anspruch auf Ausgleich. Das lässt sich an der Haltung des deutschen Bürgertums beobachten, dem die meisten Leser Gustav Freytags entstammten und von dem er, ein politisch Liberaler, erwartete, dass es im neugeschaffenen Deutschen Reich eine führende Rolle spielen werde. Es war vor allem das Bildungsbürgertum, das die Opfererzählung des Dreißigjährigen Krieges aufsaugte und daraus schlussfolgerte, man dürfe unter keinen Umständen noch einmal in diese Rolle hineingedrängt werden. Man verstand Machtpolitik darum nicht als ein Projekt, dessen Chancen und Risiken, Erträge...